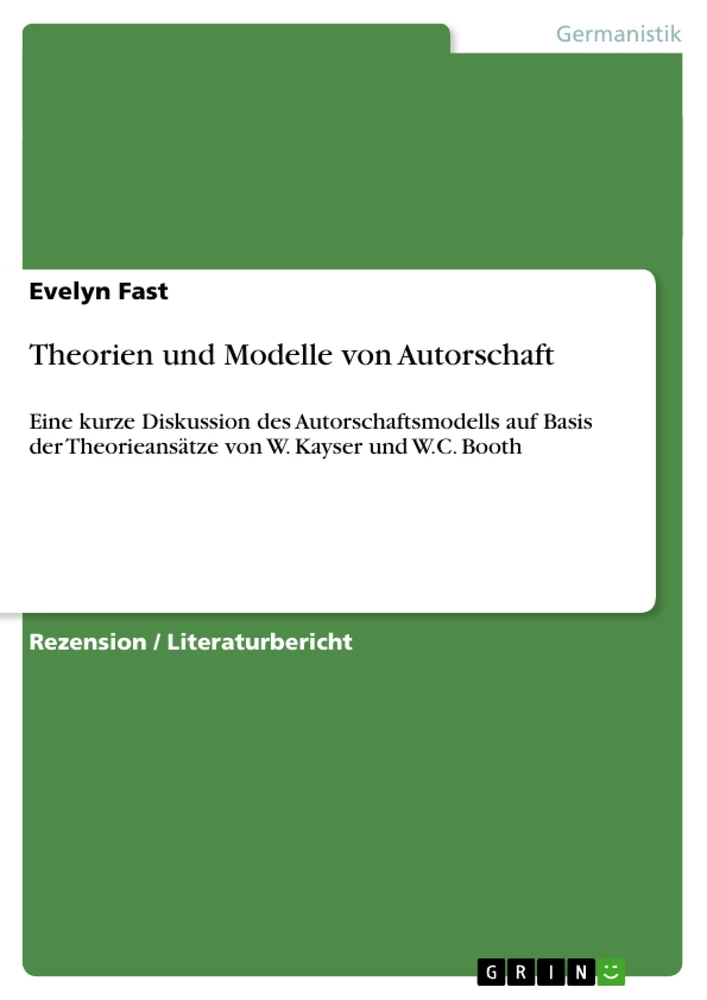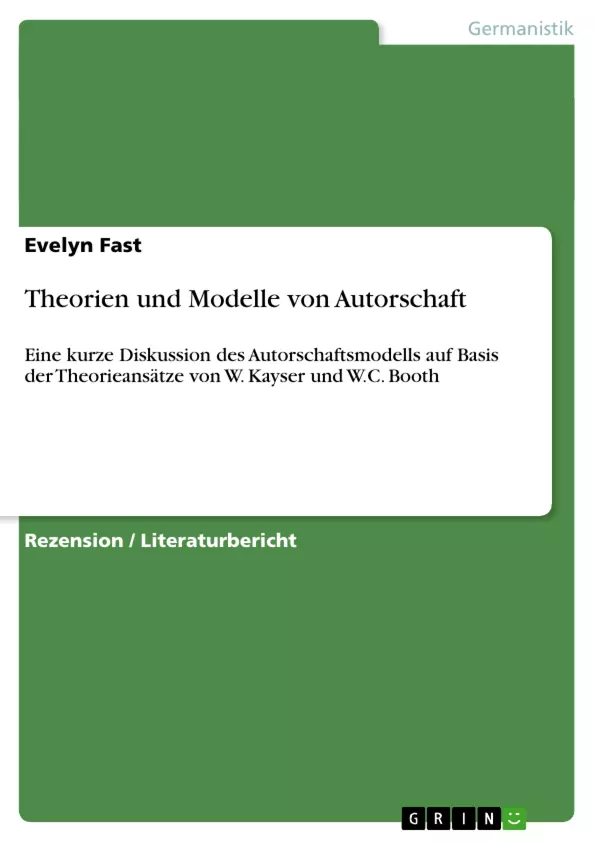Wer erzählt den Roman?
Wolfgang Kayser (1906-1960) beschäftigt sich in seinem Text "Wer erzählt den Roman?" mit eben dieser Frage nach dem Erzähler eines Romans. Er stellt in seinem Text einige Thesen auf, beginnend mit der These: Ein Erzähler ist in allen Werken der Erzählkunst vorhanden, im Epos wie im Märchen, in der Novelle wie in der Anekdote. Daraufhin erschließt sich Kaysers zweite These: Ein Erzähler ist nie der Autor, sondern eine Rolle, die der Autor erfindet und einnimmt. In den fiktionalen Texten der Erzählkunst spricht der Autor also nicht als er selbst, sondern überlässt dem Rollen-Ich eines Erzählers das Wort. An dieser Stelle bringt er das Beispiel des Vaters und der Mutter ein, die wissen, dass sie sich verwandeln müssen, wenn sie ihren Kindern ein Märchen erzählen wollen. Sie müssen ihre überlegene und aufgeklärte Position des Erwachsenen ablegen und sich "in ein Wesen verwandeln, für das die dichterische Welt mit ihren Wunderbarkeiten Wirklichkeit ist." [...]
Wayne C. Booth: Der implizite Autor
Der implizite Autor bezeichnet eine Instanz, die sich sowohl vom realen Autor des Werkes als auch vom fiktiven Erzähler unterscheidet. Der Begriff wird auch als zweites Selbst und als Bild des Autors im Text personifiziert. In Booths nicht immer konsistenten Begriffsbestimmungen erscheint der implizite Autor in der Regel als Textimplikat. Der implizite Autor wird dabei fast ununterscheidbar von der Gesamtbedeutung des Textes. Nach Booth macht sich der Leser immer ein Bild vom impliziten Autor, das sich aus der Art des Schreibens, den enthaltenen Werten und den verborgenen Bekenntnissen zusammensetzt. Der implizite Autor wird als das Bild des realen Autors beschrieben, insoweit es aus dem Text zu erschließen ist.
Inhaltsverzeichnis
- I. Texte zur Theorie der Autorschaft
- 1.1 Wolfgang Kayser: Wer erzählt den Roman?
- 1.2 Wayne C. Booth: Der implizite Autor
- II. Modell kollektiver Autorschaft: Grond Absolut Homer
- 2.1 Was versteht Walter Grond unter einem „transindividuellen Roman\"?
- 2.2 Diskussion des Autorschaftsmodells von „,,Grond Absolut Homer\" aus der Sicht einiger Thesen der Theorieansätze von W. Kayser und W.C.Booth
- III. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Theorie der Autorschaft und untersucht verschiedene Modelle, die die Entstehung und Funktion von literarischen Texten erklären. Im Fokus stehen dabei die Ansätze von Wolfgang Kayser und Wayne C. Booth, die unterschiedliche Perspektiven auf die Rolle des Autors und des Erzählers im Roman entwickeln.
- Der Einfluss des Autors auf die Erzählinstanz
- Die Konstruktion des impliziten Autors
- Das Modell der kollektiven Autorschaft
- Der „transindividuelle Roman“
- Die Grenzen zwischen Autor, Erzähler und Leser
Zusammenfassung der Kapitel
I. Texte zur Theorie der Autorschaft
1.1 Wolfgang Kayser: Wer erzählt den Roman?
Wolfgang Kayser untersucht in seinem Text die Rolle des Erzählers im Roman. Er argumentiert, dass der Erzähler nie der Autor selbst ist, sondern eine fiktive Rolle, die der Autor einnimmt. Kayser beleuchtet die Funktion des Erzählers als Sprecherinstanz und zeigt, dass der Erzähler dem Leser eine spezifische Sichtweise auf die erzählte Welt vermittelt. Er analysiert den Roman „Moby Dick“ von Herman Melville, um die Unterscheidung zwischen Autor und Erzähler zu verdeutlichen. Kayser kommt schließlich zu dem Schluss, dass der Roman selbst der eigentliche Erzähler ist, der sich in einer „mythischen Weltschöpfung“ manifestiert.
1.2 Wayne C. Booth: Der implizite Autor
Wayne C. Booth stellt den Begriff des „impliziten Autors“ vor, eine Instanz, die sich vom realen Autor und dem fiktiven Erzähler unterscheidet. Der implizite Autor ist ein Textimplikat, das der Leser aus dem Text erschließt. Booth betont die Bedeutung des moralischen Charakters des impliziten Autors, der sich vom realen Autor unterscheiden kann. Er untersucht das Werk von Henry Fielding, um die verschiedenen Ausprägungen des impliziten Autors in unterschiedlichen Texten zu zeigen.
II. Modell kollektiver Autorschaft: Grond Absolut Homer
2.1 Was versteht Walter Grond unter einem „transindividuellen Roman\"?
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Modell der kollektiven Autorschaft, das Walter Grond unter dem Begriff „Grond Absolut Homer“ entwickelt hat. Grond argumentiert, dass die Entstehung eines Romans ein gemeinsames Schaffensprozess ist, an dem verschiedene Individuen beteiligt sind.
2.2 Diskussion des Autorschaftsmodells von „,,Grond Absolut Homer\" aus der Sicht einiger Thesen der Theorieansätze von W. Kayser und W.C.Booth
In diesem Kapitel werden die Thesen von Kayser und Booth auf das Modell der kollektiven Autorschaft angewendet. Es wird diskutiert, wie die Konzepte des Erzählers, des impliziten Autors und der „mythischen Weltschöpfung“ im Kontext einer gemeinsamen Autorenschaft interpretiert werden können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Literaturtheorie, wie Autorschaft, Erzählinstanz, impliziter Autor, kollektive Autorschaft, „transindividueller Roman“ und die Grenzen zwischen Autor, Erzähler und Leser. Die Analyse von Texten von Wolfgang Kayser, Wayne C. Booth und Walter Grond sowie die Untersuchung des Romans „Moby Dick“ von Herman Melville beleuchten unterschiedliche Perspektiven auf die Entstehung und Funktion von literarischen Texten.
Häufig gestellte Fragen
Unterscheidet Wolfgang Kayser zwischen Autor und Erzähler?
Ja, Kayser argumentiert, dass der Erzähler nie der reale Autor ist, sondern eine fiktive Rolle, die der Autor erfindet und einnimmt.
Was ist ein „impliziter Autor“ nach Wayne C. Booth?
Der implizite Autor ist ein vom Leser aus dem Text erschlossenes Bild des Autors, das sich vom realen Autor und vom fiktiven Erzähler unterscheidet.
Was versteht Walter Grond unter einem „transindividuellen Roman“?
Grond beschreibt damit ein Modell kollektiver Autorschaft, bei dem die Entstehung eines Werkes als gemeinsamer Schaffensprozess mehrerer Individuen verstanden wird.
Wie wird der Erzähler in Kaysers Analyse von „Moby Dick“ beschrieben?
Kayser nutzt das Werk, um zu zeigen, dass der Roman selbst durch eine spezifische Sprecherinstanz (das Rollen-Ich) eine mythische Weltschöpfung manifestiert.
Warum ist der moralische Charakter des impliziten Autors wichtig?
Nach Booth setzt sich das Bild des impliziten Autors aus den im Text enthaltenen Werten und Bekenntnissen zusammen, was die Wahrnehmung des Lesers maßgeblich beeinflusst.
Können die Theorien von Kayser und Booth auf kollektive Autorschaft angewendet werden?
Ja, die Arbeit diskutiert, wie Konzepte wie die Erzählinstanz oder der implizite Autor im Kontext von Gronds Modell der gemeinsamen Autorenschaft neu interpretiert werden können.
- Citation du texte
- Evelyn Fast (Auteur), 2002, Theorien und Modelle von Autorschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38401