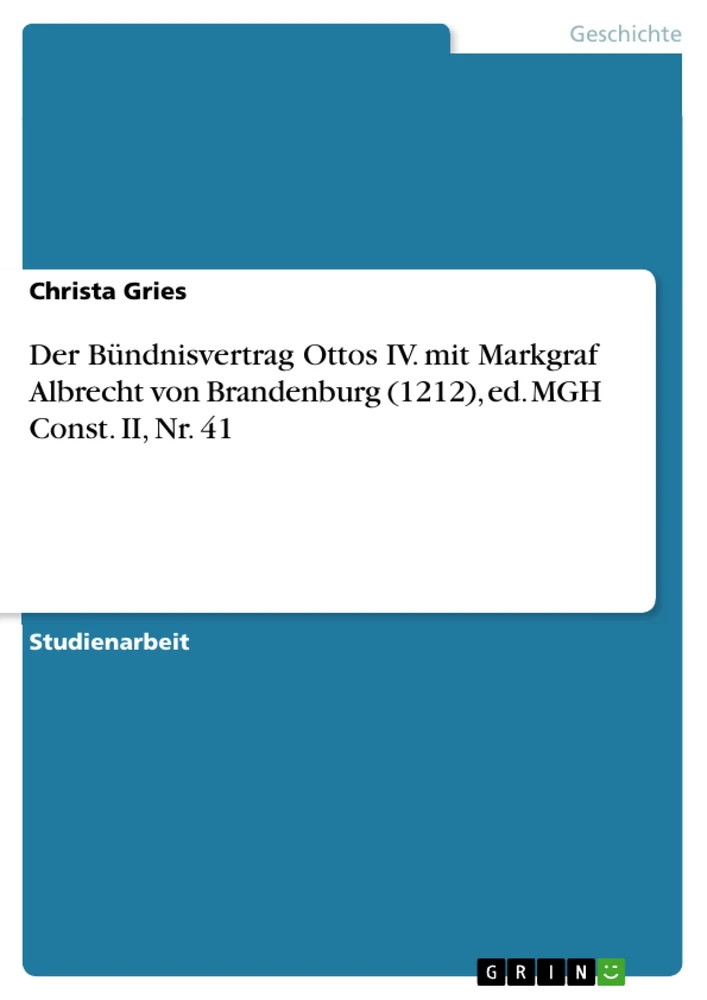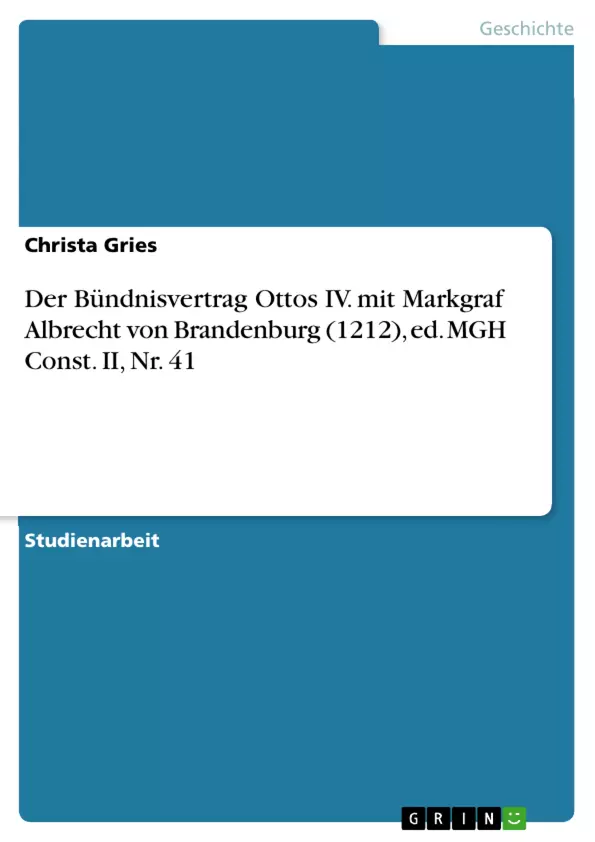Ein Bündnisvertrag Kaiser Ottos IV. mit einem Markgrafen, dem Fürsten eines reichsfernen Landesteils, Brandenburg, am Ostende des deutschen Reiches! Wäre der Markgraf von Brandenburg als Kronvasall nicht sowieso zu Treue und Unterstützung verpflichtet gewesen?
Am 19.5.1209 hatten die Fürsten und Grafen des Nordostens Otto IV., dem Sieger des deutschen Thronstreits, die Treue geschworen. Wie hatte sich die Lage nur drei Jahre später verändert, dass ein solcher Bündnisvertrag nötig war? Wie kam es zu dem Vertrag, was sollte er leisten und wie wurde er gelebt?
Solche Fragen sollen im Folgenden erörtert werden. Dabei wird zu Beginn ein Einblick in die Geschichte des Bündnisvertragswesens im Mittelalter gegeben. Anschließend werden die Bündnispartner im Jahre 1212 vorgestellt. Im Hauptteil soll der Urkundentext kommentiert und zuletzt geschildert werden, wie der Vertrag umgesetzt wurde.
Inhaltsverzeichnis
-
- EINLEITUNG
- GESCHICHTE DER BÜNDNISVERträge im MitTELALTER
- KAISER OTTO IV. IM AUGUST 1212
- Italienzug, Exkommunikation und Kaiserwahl Friedrichs II.
- Reaktion Ottos IV.
- MARKGRAF ALBRECHT VON BRANDENBURG
- Zur Person Albrechts
- Die Mark Brandenburg und die Nachbarschaftskonflikte
- Das Verhältnis der Markgrafen zur Herrschaft im Reich
-
- DIE URKUNDE
- FORM UND INHALT
- Ottos Versprechen
- Albrechts Gegenleistung und die Sanctio
- Grund für die Ausstellung der Urkunde
- Datum, Ort und Zeugen
- ZUSAMMENFASSENDER KOMMENTAR
-
- HISTORISCHE WEITERVERFOLGUNG
- DIE ENTSCHEIDUNG IM THRONKAMPF
- KÄMPFE IM NORDEN
- EPILOG
- QUELLEN
- ANHANG: KARTE DER MARK BRANDENBURG 1320
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Analyse des Bündnisvertrages zwischen Kaiser Otto IV. und Markgraf Albrecht von Brandenburg aus dem Jahr 1212. Der Fokus liegt auf der Einordnung des Vertrages in den historischen Kontext, der Untersuchung der Hintergründe seiner Entstehung, der Interpretation der Urkundeninhalte sowie der Analyse der Auswirkungen des Vertrags auf die politische Landschaft des Heiligen Römischen Reiches.
- Die historische Entwicklung und Bedeutung von Bündnisverträgen im Mittelalter
- Die politische Situation im Heiligen Römischen Reich im Jahr 1212, insbesondere die Auseinandersetzung zwischen Otto IV. und Friedrich II. um die Kaiserkrone
- Die Person und die Rolle von Markgraf Albrecht von Brandenburg in diesem Kontext
- Die Analyse des Bündnisvertrages in seiner Form und seinen Inhalten
- Die Folgen und Auswirkungen des Vertrags auf die politische Landschaft des Reiches.
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel stellt das Thema der Arbeit vor und bietet eine Einleitung in die Geschichte der Bündnisverträge im Mittelalter. Es beleuchtet die Entwicklung von Bündnissen und ihre Bedeutung in der mittelalterlichen Politik.
- Das zweite Kapitel widmet sich der politischen Situation im Jahr 1212, insbesondere der Position von Kaiser Otto IV. und den Herausforderungen, denen er gegenüberstand. Es analysiert die Ursachen für seine Bedrängnis und die Folgen seiner Politik in Italien.
- Das dritte Kapitel beschreibt den Hintergrund und die Person des Markgrafen Albrecht von Brandenburg, der im Mittelpunkt des Bündnisvertrages steht. Es beleuchtet die Rolle der Mark Brandenburg im Heiligen Römischen Reich und die Konflikte, die Albrecht in seiner Position bewältigen musste.
- Im vierten Kapitel wird der Bündnisvertrag selbst untersucht. Die Urkunde wird in ihrer Form und ihren Inhalten analysiert, um die Motivationen und Absichten der Vertragsparteien zu verstehen.
- Das fünfte Kapitel beleuchtet die historischen Folgen des Bündnisvertrages. Es zeigt auf, wie der Vertrag in der Folgezeit umgesetzt wurde und welche Auswirkungen er auf die weitere politische Entwicklung des Heiligen Römischen Reiches hatte.
Schlüsselwörter
Bündnisvertrag, Kaiser Otto IV., Markgraf Albrecht von Brandenburg, 1212, Heiliges Römisches Reich, Thronstreit, Italienpolitik, Reichsfürsten, Urkundenanalyse, historische Folgen.
- Quote paper
- Christa Gries (Author), 2017, Der Bündnisvertrag Ottos IV. mit Markgraf Albrecht von Brandenburg (1212), ed. MGH Const. II, Nr. 41, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384445