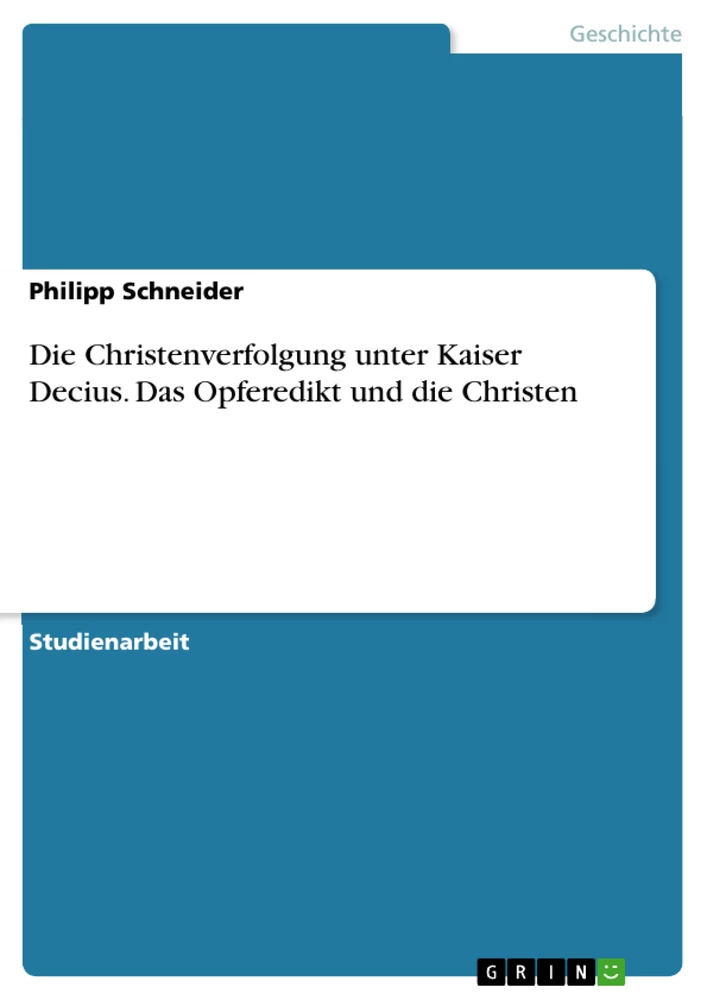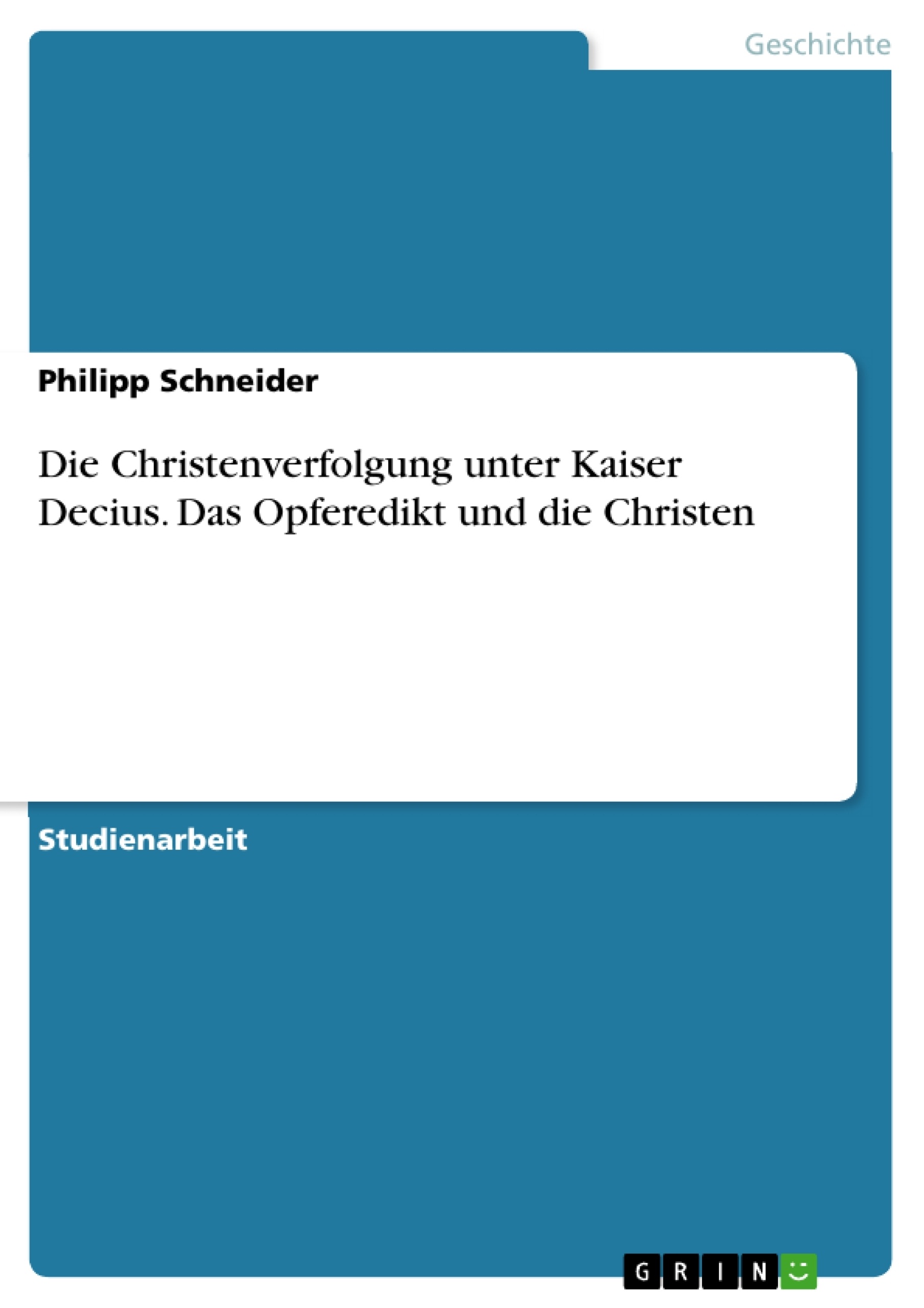Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Christenverfolgung unter Kaiser Decius, nach der Durchführung seines Opferedikts. Viel ist uns über den römischen Kaiser Decius nicht bekannt. Ein Ereignis seiner kaum zweijährigen Herrschaftszeit (249 – 251) ist jedoch quellenmäßig ausgesprochen gut dokumentiert. Die Rede ist von der sogenannten Decischen Christenverfolgung. Diese wird im Allgemeinen als Wendepunkt in der Geschichte der Christenverfolgung bezeichnet, denn sie gilt als die erste zentral organisierte und reichsweite Verfolgung von Christen im Römischen Reich und als Vorbild der folgenden Verfolgungen bis zum 313 erlassenen Toleranzedikt von Mailand.
Problematisch an den bisherigen Rekonstruktionen der Verfolgung von Christen in den Jahren 249 bis 250 ist, dass sie de facto allein auf der Basis der christlichen Quellen geschah. Die Arbeit von R. Selinger hat jedoch gezeigt, eine Rekonstruktion der Ereignisse der Decischen Verfolgung ist auch ohne die Hinzuziehung der christlichen Zeugnisse, allein auf der Grundlage der wenigen „heidnischen“ Quellen, möglich. Da dabei zum Teil erhebliche Abweichungen von der christlichen Sicht festgestellt werden konnten, ist es notwendig geworden, die von den christlichen Autoren als Christenverfolgung interpretierten Ereignisse unter Bezugnahme auf die Ergebnisse Selingers und einer kritischen Betrachtung der christlichen Quellen sowie der traditionellen Forschungsmeinung daraufhin zu überprüfen, ob es sich denn wirklich um eine Christenverfolgung handelte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Thematik
- Quellenlage
- Materialgrundlage
- Laufbahn, Herrschaft und Christenverfolgung des Decius
- Der Charakter der Verfolgung
- Zu den Gründen der Decischen Verfolgung
- Die christlichen Quellen
- Die Religiosität des Decius als Erklärungsansatz
- Der religiöse Konservatismus des Decius
- Ursache der Verfolgung?
- Der Stellenwert der Religionspolitik
- Eine Christenverfolgung?
- Das Opferedikt – Ein Verfolgungsedikt?
- Inhalt, Reichweite und Anlass
- Opferkommission und Opferlibelli
- Das Verhalten der Behörden
- Instrument einer Christenverfolgung?
- Die Christen und das Opferedikt
- Christentum contra Kaiserkult
- Opferverweigerung als crimen laesae maiestatis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sogenannte decische Christenverfolgung (249-251 n. Chr.) unter kritischer Berücksichtigung christlicher und nicht-christlicher Quellen. Ziel ist es, die gängige Interpretation der Ereignisse als systematische Christenverfolgung zu überprüfen und zu hinterfragen, ob diese Bezeichnung den historischen Gegebenheiten gerecht wird. Die Arbeit analysiert die Motive des Kaisers Decius und bewertet das Opferedikt als zentrales Element dieser Ereignisse.
- Analyse der Quellenlage: kritische Auseinandersetzung mit christlichen und nicht-christlichen Quellen zur decischen Verfolgung.
- Motive des Kaisers Decius: Untersuchung der möglichen Gründe für die Maßnahmen Decius'.
- Bewertung des Opferdekretes: Analyse des Dekretes und dessen Rolle in den Ereignissen.
- Definition von „Christenverfolgung“: Entwicklung eines präzisen Begriffs von Christenverfolgung anhand der Quellen und Forschungsergebnisse.
- Vergleichende Analyse: Gegenüberstellung christlicher und nicht-christlicher Perspektiven auf die Ereignisse.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Forschungsfrage: Handelt es sich bei den Ereignissen unter Kaiser Decius tatsächlich um eine systematische Christenverfolgung? Sie erläutert die problematische Quellenlage, die primär auf christlichen Quellen beruhte, und den Ansatz der Arbeit, der sich auf die Ergebnisse von R. Selinger stützt und eine kritische Analyse sowohl christlicher als auch nicht-christlicher Quellen vorsieht. Es wird ein methodischer Ansatz vorgestellt, der die Definition einer „Christenverfolgung“ und die Untersuchung von Decius' Motiven umfasst, um schließlich die eingangs formulierte Forschungsfrage zu beantworten.
Laufbahn, Herrschaft und Christenverfolgung des Decius: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über das Leben und die Herrschaft des Kaisers Decius, seiner Herkunft aus der illyrischen Aristokratie und seines Aufstiegs innerhalb der römischen Verwaltung. Es werden die spärlichen Quellen zu seinem Leben und seiner Herrschaft beschrieben, im Kontrast zu der reichhaltigen, aber teilweise parteiischen, Überlieferung der christlichen Quellen zur Christenverfolgung. Der Fokus liegt auf der Einordnung der Verfolgung in den Kontext seiner Regierungszeit und der verfügbaren Informationen zu seinen Handlungen.
Der Charakter der Verfolgung: Dieses Kapitel würde eine eingehende Analyse des Charakters der Verfolgung unter Decius bieten. Es würde die verschiedenen Formen der Unterdrückung, die Intensität der Maßnahmen und ihre Reichweite im römischen Reich untersuchen. Dabei werden die verfügbaren Informationen aus christlichen und nicht-christlichen Quellen sorgfältig gewichtet und verglichen, um ein möglichst umfassendes und objektives Bild der Ereignisse zu zeichnen.
Zu den Gründen der Decischen Verfolgung: Dieses Kapitel untersucht die möglichen Gründe für die Maßnahmen, die unter Decius gegen die Christen ergriffen wurden. Es analysiert sowohl die christlichen Quellen, die die Verfolgung oft als Folge religiöser Intoleranz darstellen, als auch die Möglichkeiten, die Religiosität des Decius selbst als Motiv zu betrachten, inklusive seines konservativen religiösen Ansatzes. Die Religionspolitik des Decius wird in ihrer Bedeutung und ihrem Stellenwert eingeordnet.
Eine Christenverfolgung?: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es analysiert das Opferedikt, sein Ziel, seine Reichweite und seine Umsetzung. Es untersucht das Verhalten der Behörden und die Reaktionen der Christen, einschließlich der Frage der Opferverweigerung als crimen laesae maiestatis. Hier erfolgt die endgültige Auseinandersetzung mit der Frage, ob die Ereignisse unter Decius als systematische Christenverfolgung zu klassifizieren sind, basierend auf den vorherigen Kapiteln und unter Einbezug der Ergebnisse von Selinger und anderer Forscher.
Schlüsselwörter
Decius, Christenverfolgung, Opferedikt, Kaiserkult, Religionspolitik, Römisches Reich, Quellenkritik, Selinger, christliche Quellen, heidnische Quellen, crimen laesae maiestatis.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Decischen Christenverfolgung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die sogenannte decische Christenverfolgung (249-251 n. Chr.) unter kritischer Berücksichtigung christlicher und nicht-christlicher Quellen. Das Hauptziel ist die Überprüfung der gängigen Interpretation der Ereignisse als systematische Christenverfolgung und die Frage, ob diese Bezeichnung den historischen Gegebenheiten gerecht wird. Die Arbeit analysiert die Motive des Kaisers Decius und bewertet das Opferedikt als zentrales Element dieser Ereignisse.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Analyse der Quellenlage (kritische Auseinandersetzung mit christlichen und nicht-christlichen Quellen); Motive des Kaisers Decius; Bewertung des Opferdekretes; Definition von „Christenverfolgung“; und eine vergleichende Analyse christlicher und nicht-christlicher Perspektiven.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung (Thematik, Quellenlage, Forschungsfrage); Laufbahn, Herrschaft und Christenverfolgung des Decius; Der Charakter der Verfolgung; Zu den Gründen der Decischen Verfolgung (christliche Quellen, Religiosität des Decius, Religionspolitik); Eine Christenverfolgung? (Opferedikt, Verhalten der Behörden, Reaktionen der Christen); und Fazit.
Was ist die Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Handelt es sich bei den Ereignissen unter Kaiser Decius tatsächlich um eine systematische Christenverfolgung?
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine kritische Analyse sowohl christlicher als auch nicht-christlicher Quellen. Die problematische Quellenlage, die primär auf christlichen Quellen beruht, wird explizit thematisiert.
Welche Rolle spielt das Opferedikt?
Das Opferedikt wird als zentrales Element der Ereignisse analysiert. Die Arbeit untersucht dessen Inhalt, Reichweite, Umsetzung, und die Reaktionen der Behörden und Christen darauf.
Wie wird die „Christenverfolgung“ definiert?
Die Arbeit entwickelt einen präzisen Begriff von „Christenverfolgung“ anhand der Quellen und Forschungsergebnisse, um die Ereignisse unter Decius entsprechend einzuordnen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit der Arbeit beantwortet die eingangs formulierte Forschungsfrage, basierend auf den Ergebnissen der vorherigen Kapitel und unter Einbezug der Ergebnisse von Selinger und anderer Forscher. Es wird bewertet, ob die Ereignisse unter Decius als systematische Christenverfolgung klassifiziert werden können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Decius, Christenverfolgung, Opferedikt, Kaiserkult, Religionspolitik, Römisches Reich, Quellenkritik, Selinger, christliche Quellen, heidnische Quellen, crimen laesae maiestatis.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen methodischen Ansatz, der die Definition einer „Christenverfolgung“ und die Untersuchung von Decius’ Motiven umfasst, um die Forschungsfrage zu beantworten. Die Ergebnisse von R. Selinger werden dabei als Grundlage herangezogen.
- Citar trabajo
- Philipp Schneider (Autor), 2003, Die Christenverfolgung unter Kaiser Decius. Das Opferedikt und die Christen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/384459