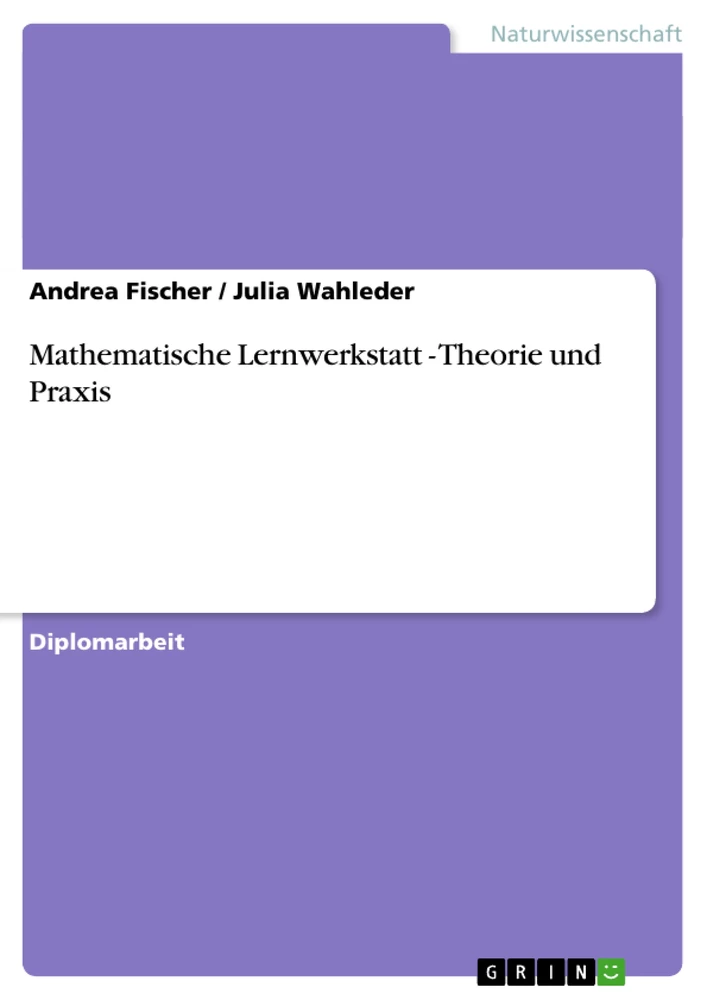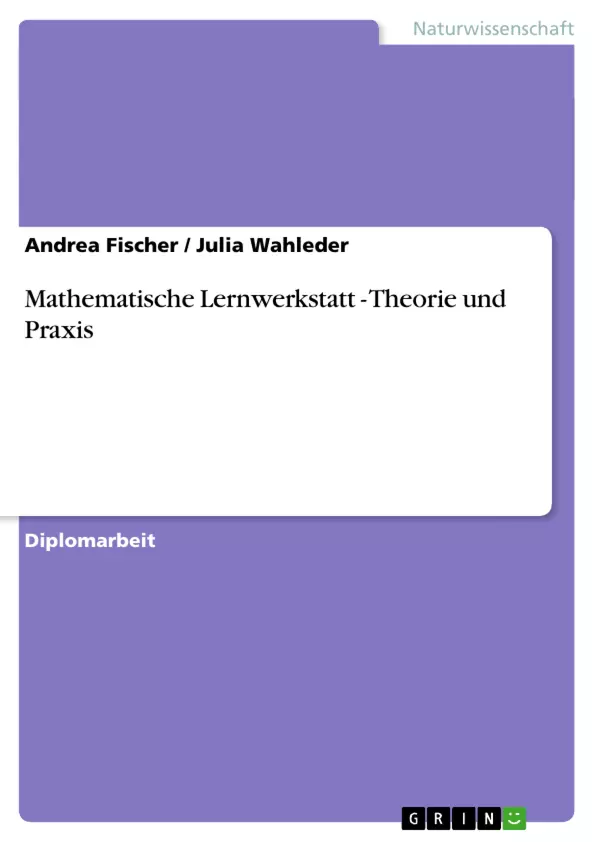[...] Das Ziel unserer Arbeit soll sein, Einblicke sowohl zur Theorie, als auch zur Praxis beim Aufbau einer Lernwerkstatt zu gewähren. Dabei soll auch auf Schwierigkeiten bei der Durchführung eingegangen werden. Ein weiteres Ziel ist natürlich die Unterstützung der VS Roding beim Aufbau der Lernwerkstatt, sowohl in der theoretischen Konzeption, die Grundlage Förderungen darstellt, als auch in der praktischen Umsetzung, beim Basteln der Materialkästen. Nun zum Aufbau der Arbeit: Zunächst gehen wir auf die Schulentwicklung von 1850 bis heute im Zusammenhang mit Lernwerkstätten ein. Die Stationen dabei sind der traditionelle Schulunterricht, die Reformpädagogik, mit Konzeptionen von Maria Montessori, Célestin Freinet und Peter Petersen. Danach folgt die Zeit des Nationalsozialismus, der wissenschaftsorientierte Unterricht nach dem Sputnik Schock und der gegenwärtige Unterricht. Für die Entwicklung der Lernwerkstätten wird vor allem die Zeit der Reformpädagogik ausschlaggebend sein. Im Anschluss daran werden wir uns den ersten beiden bekannten Lernwerkstätten Deutschlands widmen, zum einen der Lernwerkstatt an der TU Berlin, zum anderen der Grundschulwerkstatt an der Ghk Kassel. Diese werden zunächst in ihrer Entwicklung und dann in ihrer Ausstattung beschrieben. Im dritten Punkt folgen die theoretischen Grundlagen. Zunächst werden wir dabei auf Gründe und Ziele für die innovative Idee „Lernwerkstatt“ eingehen. Erst im Anschluss daran werden wir einige Definitionsansätze zum Begriff „Lernwerkstatt“ besprechen. Üblicherweise findet man die Definitionen bereits am Anfang einer Arbeit, aus unseren Überlegungen heraus ist es jedoch sinnvoll die Definitionen erst nach den Entwicklungen zu behandeln, denn der Weg der Lernwerkstätten vollzog sich in der gleichen Weise. Erst nach dem Bestehen einiger Lernwerkstätten wurde versucht, diese zu definieren. Bei den Definitionen erfolgt zunächst eine Angabe von Begriffsalternativen und Bedeutungen der Alternativen, dann folgen Definitionsversuche von Müller- Naendrup, Ernst und Hagstedt, anschließend erweiterte Definitionsversuche von Reichen und Bauer. Die Definitionen unterscheiden sich insofern, dass der Begriff Lernwerkstatt sowohl zum einen für die Erwachsenenbildung in Anspruch genommen wird, zum anderen als Begriff für eine Einrichtung für Schüler gedacht ist. Deshalb sollen im Folgenden auch die verschiedenen Träger von Lernwerkstätten vorgestellt werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Gründe für die Themenwahl; Ziele und Aufbau der Arbeit
- 2. Lernwerkstätten - Entwicklung
- 2.1 Entwicklung von 1850 bis heute
- 2.1.1 Traditioneller Schulunterricht
- 2.1.2 Reformpädagogik
- 2.1.2.1 Maria Montessori
- 2.1.2.2 Célestin Freinet
- 2.1.2.3 Peter Petersen
- 2.1.3 Zeit des Nationalsozialismus
- 2.1.4 Wissenschaftsorientierter Unterricht
- 2.1.5 Gegenwärtiger Unterricht
- 2.2 Die ersten beiden bekannten Lernwerkstätten Deutschlands
- 2.2.1 Die Lernwerkstatt an der TU Berlin
- 2.2.2 Die Grundschulwerkstatt an der Ghk Kassel
- 2.1 Entwicklung von 1850 bis heute
- 3. Lernwerkstätten - theoretische Grundlagen
- 3.1 Innovative Idee „Lernwerkstatt“
- 3.1.1 Gründe für eine Lernwerkstatt
- 3.1.1.1 Gründe für eine Mathematik - Lernwerkstatt
- 3.1.2 Ziele einer Lernwerkstatt
- 3.1.2.1 Ziele einer Mathematik - Lernwerkstatt
- 3.1.1 Gründe für eine Lernwerkstatt
- 3.2 Definitionsansätze
- 3.2.1 Der Begriff „Lernwerkstatt“ – Alternativen und Bedeutungen
- 3.2.2 Definitionsversuche
- 3.2.3 Erweiterte Definitionsversuche
- 3.3 Träger
- 3.3.1 Lernwerkstätten an Schulen
- 3.3.2 Lernwerkstätten an Hochschulen
- 3.4 Didaktische Prinzipien
- 3.4.1 Offener Unterricht
- 3.4.1.1 Strukturprinzipien offenen Unterrichts
- 3.4.1.2 Definition
- 3.4.1.3 Ziele des offenen Unterrichts
- 3.4.1.4 Gegenüberstellung: offener / geschlossener Unterricht
- 3.4.2 Entdeckendes Lernen
- 3.4.2.1 Definitionen
- 3.4.2.2 Voraussetzungen und Bedingungen für entdeckendes Lernen
- 3.4.2.3 Grenzen entdeckenden Lernens
- 3.4.3 Handlungsorientierter Unterricht
- 3.4.3.1 Definition
- 3.4.3.2 Merkmale und Ziele des handlungsorientierten Unterrichts
- 3.4.3.3 Voraussetzungen für handlungsorientierten Unterricht
- 3.4.1 Offener Unterricht
- 3.5 Organisation des Unterrichts in einer Lernwerkstatt
- 3.5.1 Die Lehrerrolle
- 3.5.2 Gestaltung der Lernwerkstatt
- 3.5.2.1 Materialgestaltung allgemein
- 3.5.2.2 Material in der Mathematikwerkstatt
- 3.1 Innovative Idee „Lernwerkstatt“
- 4. Lernwerkstätten - praktische Durchführung
- 4.1 Zwei Beispiele bestehender Lernwerkstätten
- 4.1.1 Napoleonsteinschule Regensburg
- 4.1.2 Mathematik-Lernwerkstatt an der VS Teisnach
- 4.2 Vorstellung der Lernmittel - CD
- 4.2.1 Allgemeines
- 4.2.2 Geometrie
- 4.2.3 Sachmathematik
- 4.2.4 Strategie
- 4.2.5 Zahlen und Rechnen
- 4.2.6 Grundlegende Hinweise
- 4.3 Beschreibung der hergestellten Lernkästen mit Informationen von Prof. Reitberger
- 4.3.1 Geometrie
- 4.3.1.1 Linien Nr. 1
- 4.3.1.2 Körper Nr. 2
- 4.3.1.3 Körper Nr. 21
- 4.3.1.4 Flächen Nr. 1
- 4.3.2 Sachmathematik
- 4.3.2.1 Sachmathematik Nr. 31
- 4.3.2.2 Sachmathematik Nr. 35
- 4.3.3 Strategie
- 4.3.3.1 Strategie Nr. 21
- 4.3.3.2 Strategie Nr. 41
- 4.3.1 Geometrie
- 4.1 Zwei Beispiele bestehender Lernwerkstätten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept der „Mathematischen Lernwerkstatt“ in Theorie und Praxis. Ziel ist es, die Entwicklung, die theoretischen Grundlagen und die praktische Umsetzung von Lernwerkstätten im Mathematikunterricht zu beleuchten. Dabei werden insbesondere die didaktischen Prinzipien, die Gestaltung von Materialien und die Rolle des Lehrers in diesem Kontext untersucht.
- Entwicklung der Lernwerkstatt von der traditionellen Schule zur heutigen Zeit
- Theoretische Grundlagen der Lernwerkstatt: Definitionen, Didaktische Prinzipien, Organisation des Unterrichts
- Praktische Umsetzung von Lernwerkstätten im Mathematikunterricht
- Gestaltung von Materialien und Lernmitteln für die Mathematikwerkstatt
- Rolle des Lehrers in der Lernwerkstatt
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in das Thema „Mathematische Lernwerkstatt“ ein. Es werden die Gründe für die Themenwahl, die Ziele der Arbeit sowie deren Aufbau erläutert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Entwicklung von Lernwerkstätten vom traditionellen Schulunterricht bis zum heutigen Stand. Es werden verschiedene Reformpädagogische Strömungen sowie die Bedeutung der Lernwerkstatt in der Zeit des Nationalsozialismus und im wissenschaftsorientierten Unterricht betrachtet.
Das dritte Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen von Lernwerkstätten. Hier werden verschiedene Definitionsansätze beleuchtet und didaktische Prinzipien wie offener Unterricht, entdeckendes Lernen und handlungsorientierter Unterricht diskutiert.
Das vierte Kapitel fokussiert auf die praktische Durchführung von Lernwerkstätten. Es werden zwei Beispiele bestehender Lernwerkstätten vorgestellt sowie die Gestaltung von Lernmitteln und deren Einsatz im Unterricht erörtert.
Schlüsselwörter
Mathematische Lernwerkstatt, Reformpädagogik, Didaktische Prinzipien, Offener Unterricht, Entdeckendes Lernen, Handlungsorientierter Unterricht, Materialgestaltung, Lehrerrolle, Praxisbeispiel, Mathematikdidaktik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Lernwerkstatt im schulischen Kontext?
Eine Lernwerkstatt ist ein Ort des entdeckenden und handlungsorientierten Lernens, an dem Schüler mit speziellen Materialien selbstständig Aufgaben bearbeiten können.
Welche reformpädagogischen Einflüsse prägen Lernwerkstätten?
Wichtige Grundlagen stammen von Maria Montessori (Materialarbeit), Célestin Freinet (Druckerwerkstatt) und Peter Petersen (Jenaplan).
Warum ist eine Lernwerkstatt speziell für Mathematik sinnvoll?
Sie ermöglicht es, abstrakte mathematische Konzepte durch haptische Materialien (z.B. Körper, Flächen, Zahlenkästen) begreifbar zu machen und individuelles Lerntempo zu fördern.
Welche Rolle hat die Lehrkraft in einer Lernwerkstatt?
Der Lehrer fungiert weniger als Wissensvermittler, sondern eher als Lernbegleiter, Berater und Organisator der Lernumgebung.
Was bedeutet „Offener Unterricht“ in diesem Zusammenhang?
Offener Unterricht bedeutet, dass die Schüler Wahlmöglichkeiten bei Inhalten, Zeit, Raum und Sozialform haben, was durch die Struktur der Lernwerkstatt unterstützt wird.
- Citation du texte
- Andrea Fischer (Auteur), Julia Wahleder (Auteur), 2003, Mathematische Lernwerkstatt - Theorie und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38472