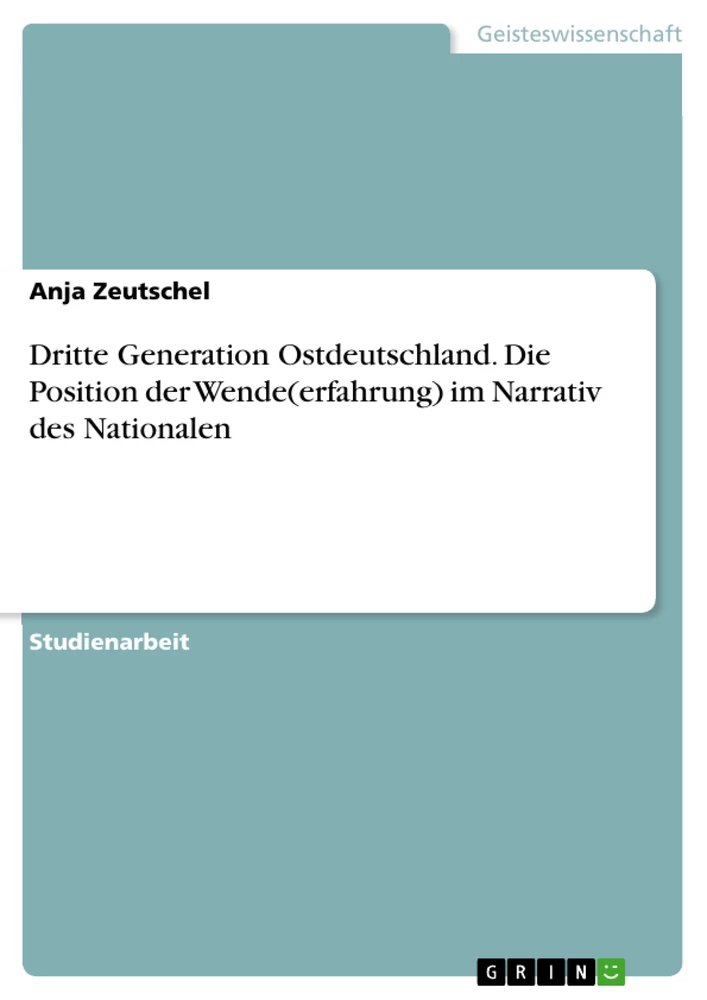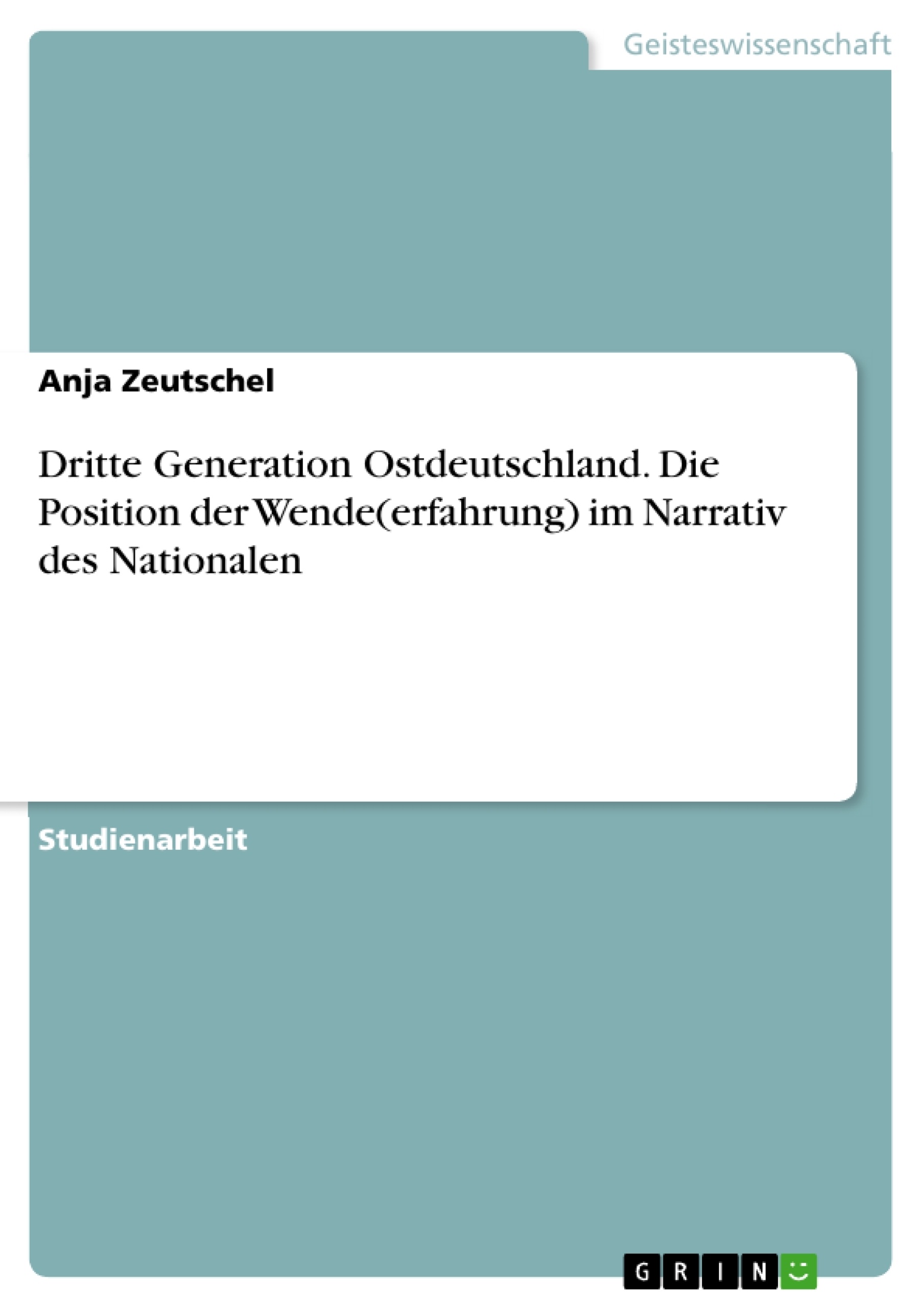Die Hausarbeit beschäftigt sich damit, wie die Dritte Generation Ostdeutschland sich am Diskurs um das Nationale in Deutschland beteiligt, welche Narrative sie möglicherweise verwendet und welches Verständnis sie vom Nationalen hat. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bedeutung der DDR-Geschichte und der Wende bzw. Wendeerfahrung im Narrativ des Nationalen. Als Grundlage der Analyse dient dabei Irene Götz' "Deutsche Identitäten", welches ausführlich besprochen wird. Es werden kulturwissenschaftliche Begrifflichkeiten der Identität und des Nationalen definiert sowie die Subjektivität und Konstruiertheit nationaler Identifikation erläutert. Die Hausarbeit stellt zudem Aspekte des Narrativs des Nationalen in Deutschland heraus und beschreibt Prozesse der De-, Re- und Transnationalisierung nach 1990.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsperspektive & Begrifflichkeiten
- Das Nationale Narrativ & die Wende
- Das Narrativ des Nationalen in Deutschland
- Prozesse der De-, Trans- und Re-Nationalisierung nach 1990
- Die Position der Wende(erfahrung) im Narrativ des Nationalen
- Das Nationale & die Wende bei der Dritten Generation Ost
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Bedeutung des Nationalen im Kontext der Dritten Generation Ostdeutschland. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle der Wendeerfahrung im Narrativ des Nationalen. Die Arbeit analysiert, wie die Dritte Generation Ostdeutschland am Diskurs um das Nationale in Deutschland teilnimmt, welche Narrative sie verwendet und welches Verständnis sie vom Nationalen hat.
- Die Rolle der Wendeerfahrung im Narrativ des Nationalen
- Die Konstruktion von nationaler Identität in Ostdeutschland nach der Wende
- Die Bedeutung der DDR-Geschichte für das nationale Selbstverständnis der Dritten Generation Ost
- Narrative der Dritten Generation Ostdeutschland im Kontext des deutschen Nationalismus
- Die Auseinandersetzung mit dem „negativen“ Erbe des Nationalismus in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Forschungsgegenstand und die Forschungsfrage vor. Sie beleuchtet den Kontext der Dritten Generation Ostdeutschland und deren besondere Lebenserfahrungen. Kapitel 2 definiert die wichtigsten Begriffe und Konzepte, die in der Arbeit verwendet werden, wie zum Beispiel „Generation“, „Identität“, „Nation“ und „Nationalismus“. Kapitel 3 analysiert das Nationale Narrativ in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die Rolle des Holocausts und des Zweiten Weltkriegs sowie die deutsch-deutsche Vereinigung. Es beleuchtet die Prozesse der De-, Trans- und Re-Nationalisierung nach 1990 und untersucht, wie die Wendeerfahrung in das nationale Narrativ eingebunden ist.
Schlüsselwörter
Dritte Generation Ostdeutschland, Wendeerfahrung, Nationales Narrativ, Identität, Nation, Nationalismus, DDR-Geschichte, De-Nationalisierung, Trans-Nationalisierung, Re-Nationalisierung, Holocaust, Zweiter Weltkrieg, deutsch-deutsche Vereinigung.
Häufig gestellte Fragen
Wer gehört zur "Dritten Generation Ostdeutschland"?
Damit sind Menschen gemeint, die in der DDR geboren wurden, aber ihre prägende Kindheit oder Jugend während der Wendezeit und im vereinigten Deutschland erlebt haben.
Welche Rolle spielt die Wendeerfahrung für diese Generation?
Die Wendeerfahrung ist ein zentraler Bestandteil ihres Identitätsnarrativs und beeinflusst ihr Verständnis von Nation, Heimat und gesellschaftlichem Umbruch.
Was versteht man unter De-, Trans- und Re-Nationalisierung nach 1990?
Diese Begriffe beschreiben die Prozesse der Auflösung alter nationaler Strukturen (De-), die grenzüberschreitende Vernetzung (Trans-) und die Rückbesinnung auf nationale Werte (Re-) im Kontext der deutschen Einheit.
Wie geht diese Generation mit der DDR-Geschichte um?
Die Arbeit analysiert, wie die DDR-Geschichte als Teil des nationalen Selbstverständnisses integriert oder kritisch reflektiert wird, um eine eigene Identität abseits von Klischees zu finden.
Welche wissenschaftliche Grundlage nutzt die Arbeit?
Die Analyse stützt sich maßgeblich auf Irene Götz' Werk "Deutsche Identitäten", um kulturwissenschaftliche Begrifflichkeiten von Identität und Nationalität zu definieren.
Wie wird das "negative Erbe" des Nationalismus thematisiert?
Die Arbeit untersucht die Auseinandersetzung mit dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg als notwendigen Teil des deutschen nationalen Narrativs, an dem sich auch die Dritte Generation Ost beteiligt.
- Citar trabajo
- Anja Zeutschel (Autor), 2016, Dritte Generation Ostdeutschland. Die Position der Wende(erfahrung) im Narrativ des Nationalen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385008