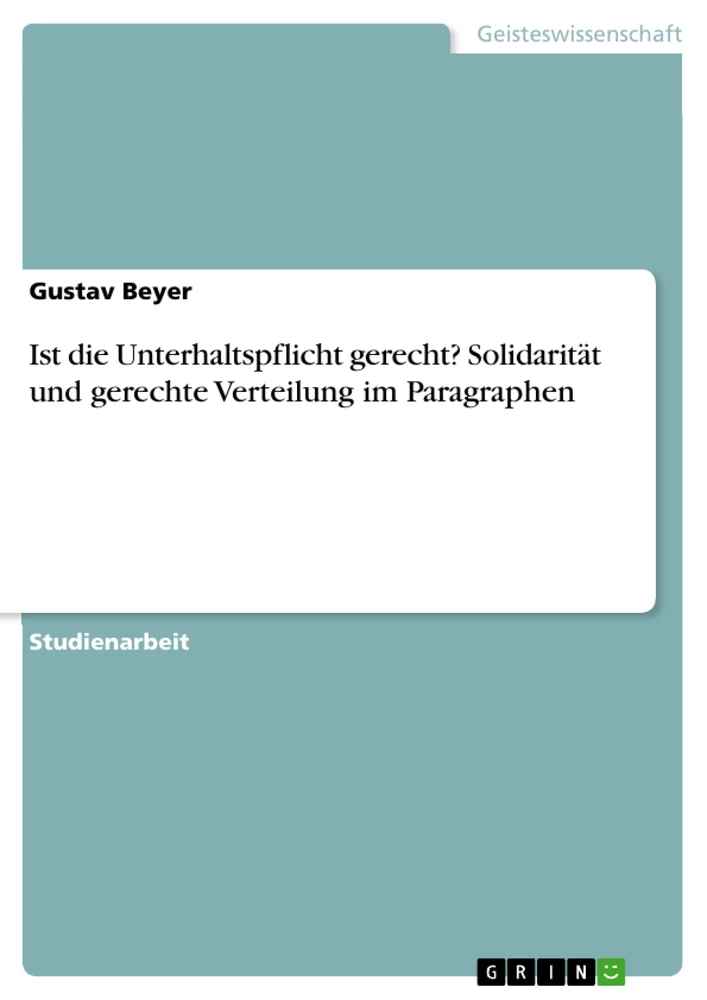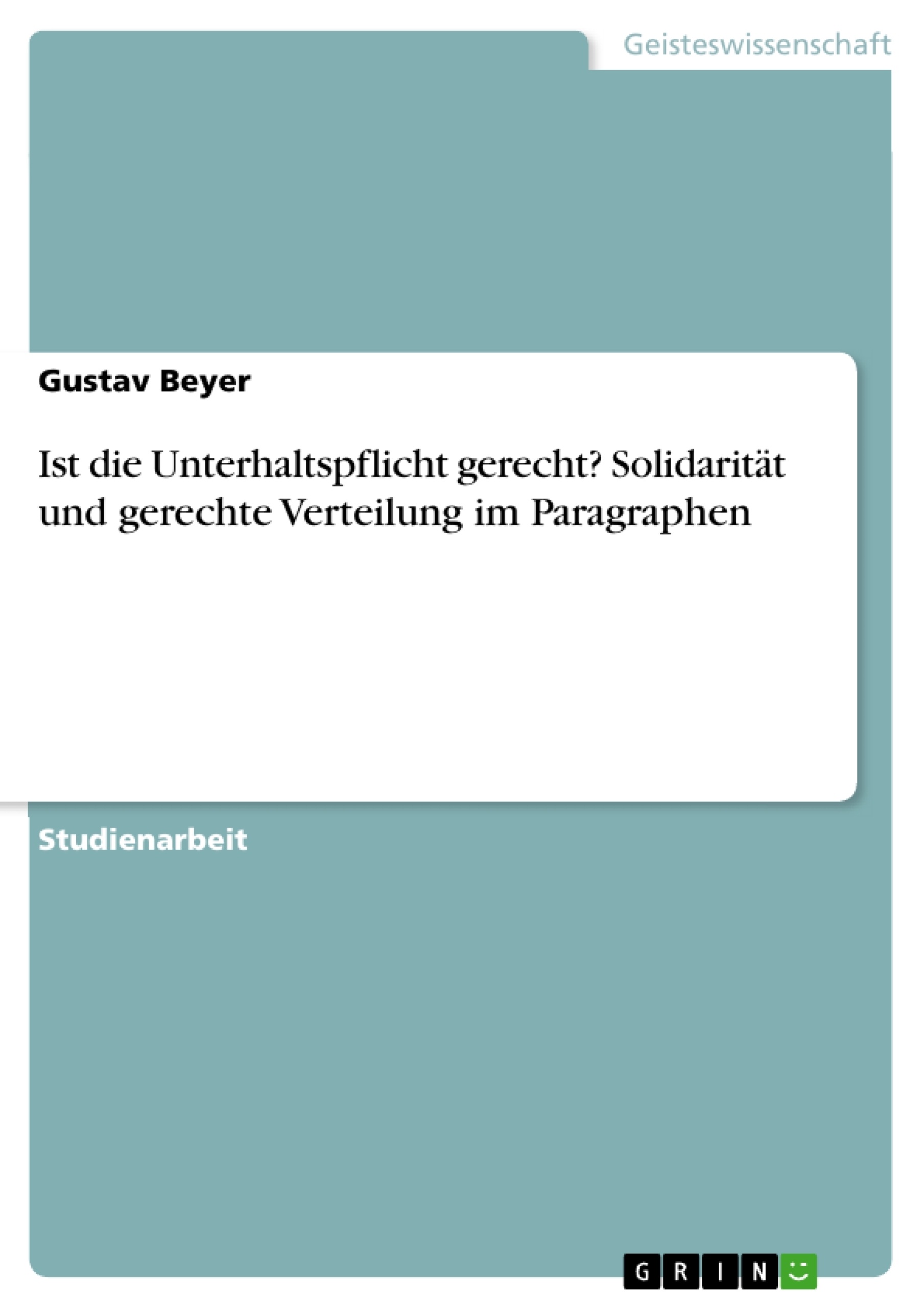Nach Paragraph 1601 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind Verwandte in gerader Linie (im Regelfall also Eltern und ihre Kinder) wechselseitig dazu verpflichtet, sich in den entsprechenden Abschnitten ihres Lebens Unterhalt zu sichern. Variierende Lebensumstände führen dazu, dass in den seltensten Fällen ein 1:1-Ausgleich von Leistungen stattfindet, sondern sich der Leistungsanspruch in Abhängigkeit des Bedarfs in ein ungleiches Verhältnis ändern kann. Ist das gerecht? Die Möglichkeit, die Regelung ungerecht zu finden, besteht jedenfalls.
Diese Hausarbeit soll jetzt aus philosophischer Sicht untersuchen, ob das Gesetz tatsächlich gerecht ist – und ob sich darin sogar ein Solidaritätsverhältnis zwischen Eltern und Kindern im Sinne gegenseitigen Einstehens füreinander finden lässt. Dabei soll definiert werden, welche Pflichten die Parteien haben und wie Aufgaben und Leistungen gleichmäßig verteilt werden können.
Damit dies planvoll geschehen kann, sollen zunächst Probleme und relevante Eigenheiten des Paragraphen benannt werden. Es soll in dieser Hausarbeit nicht besprochen werden, welche Leistung in welchem Einzelfall als gesundheitlich, finanziell, juristisch oder gefühlsmäßig angemessen bewertet werden kann, sondern auf welcher Basis Leistungen überhaupt geleistet werden sollen.
Eltern „haften“ für ihre Kinder und Kinder für ihre Eltern. Ist das gerecht oder gar ein Exempel für ein solidarisches Verhältnis?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Unterhaltspflicht im BGB
- 2. Gerechtigkeit und Solidarität
- 2.1 Verteilung von Gütern
- 2.3 Normen der Gerechtigkeit, der Hilfeleistung und der Solidarität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob die Unterhaltspflicht nach § 1601 BGB gerecht ist und ob darin ein Solidaritätsverhältnis zwischen Eltern und Kindern im Sinne gegenseitigen Einstehens füreinander erkennbar ist. Die Arbeit untersucht die Pflichten der jeweiligen Parteien und die gerechte Verteilung von Aufgaben und Leistungen. Dabei wird der Fokus auf die theoretische Grundlage der Unterhaltspflicht gelegt, ohne die konkrete Bewertung individueller Leistungsansprüche.
- Die rechtliche Grundlage der Unterhaltspflicht im BGB
- Die philosophischen Grundlagen der Gerechtigkeit und Solidarität
- Die Bedeutung der wechselseitigen Abhängigkeit zwischen Eltern und Kindern
- Die gerechte Verteilung von Aufgaben und Leistungen im Rahmen der Unterhaltspflicht
- Die Frage, ob die Unterhaltspflicht ein solidarisches Verhältnis zwischen Eltern und Kindern darstellt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Unterhaltspflicht nach § 1601 BGB vor und formuliert die Fragestellung der Hausarbeit. Kapitel 1 beleuchtet die rechtliche Grundlage der Unterhaltspflicht im BGB und erläutert die wechselseitigen Pflichten von Eltern und Kindern. Kapitel 2 widmet sich der philosophischen Diskussion um Gerechtigkeit und Solidarität, insbesondere im Kontext der Verteilung von Gütern und Normen der Hilfeleistung. Die Zusammenfassung des letzten Kapitels wird aufgrund des Spoilerschutzes nicht dargestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Hausarbeit sind Unterhaltspflicht, § 1601 BGB, Gerechtigkeit, Solidarität, Eltern-Kind-Beziehung, wechselseitige Abhängigkeit, Aufgabenverteilung, Leistungsansprüche. Die Arbeit betrachtet die Unterhaltspflicht aus rechtlicher und philosophischer Perspektive und beleuchtet insbesondere die Frage, ob diese Regelung mit dem Prinzip der Gerechtigkeit vereinbar ist und ein solidarisches Verhältnis zwischen Eltern und Kindern fördern kann.
- Citar trabajo
- Gustav Beyer (Autor), 2016, Ist die Unterhaltspflicht gerecht? Solidarität und gerechte Verteilung im Paragraphen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385096