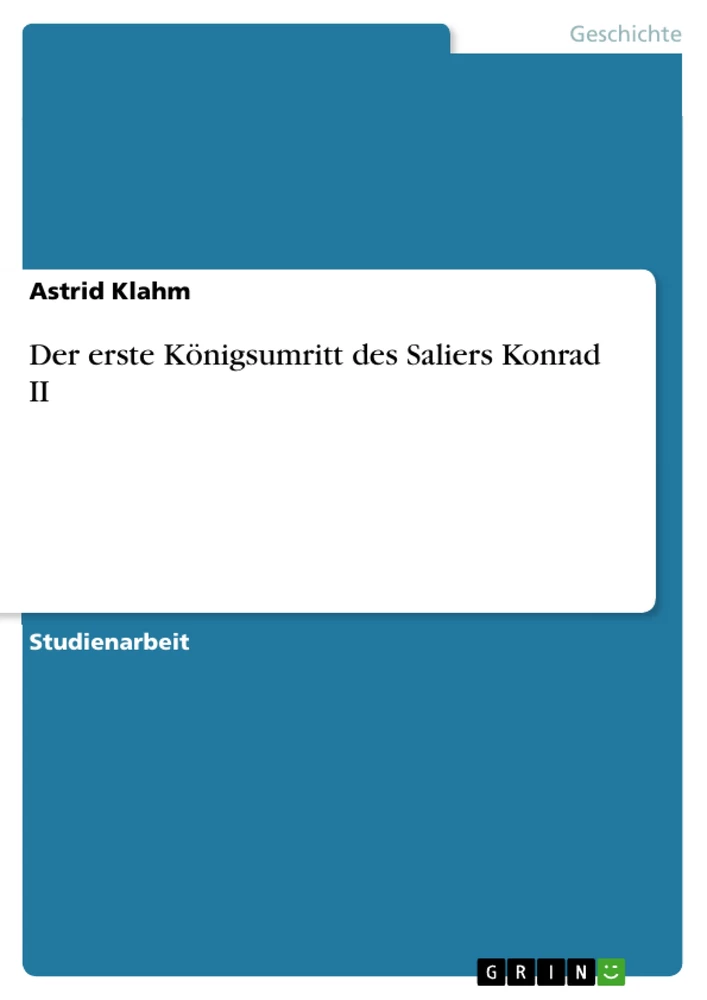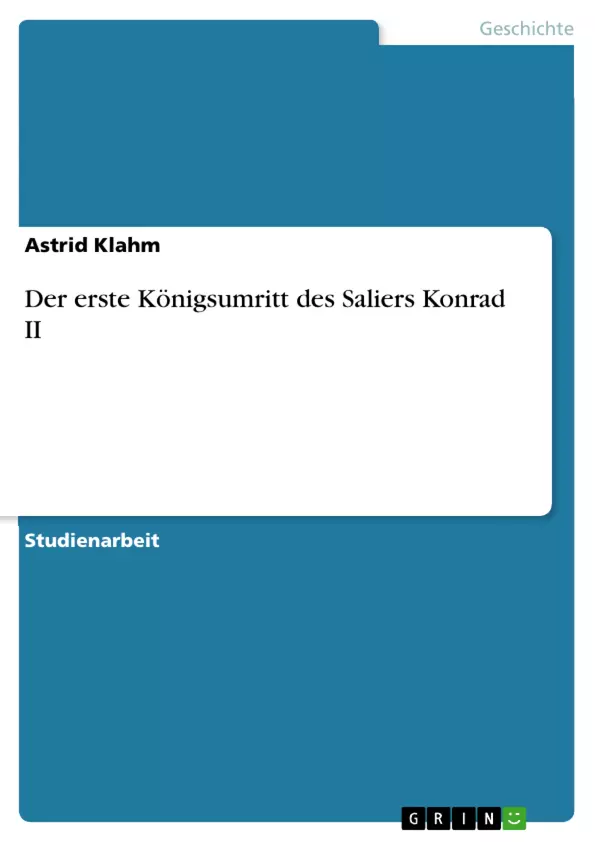In dieser Arbeit soll die Frage behandelt werden, welchen Aufgaben und Problemen sich Konrad II. während seines ersten Königsumritts stellen musste und wie er diese zu lösen versuchte. Welche Wegstationen suchte der neue König auf, um seine Herrschaft zu festigen?
Das „Reisekönigtum“ hatte keinen Verwaltungsapparat und verfügte nur über wenige Verwaltungsinstitutionen auf die sich der König stützen konnte. Die Herrschaft beruhte in erster Linie auf der persönlichen Bindung zwischen dem König und seinem Lehnsmann. Der König zog von Pfalz zu Pfalz, hielt Hoftage ab und traf politische Entscheidungen. Die Wahl des Weges war dem König frei gestellt. Er musste aber neben den geographischen und versorgungstechnischen Voraussetzungen auch die politische Notwendigkeit an einem Ort präsent sein zu müssen, bei der Wahl des Weges und des Zieles berücksichtigen.
Der Königsumritt wies zu Beginn des 11. Jahrhundert noch keine durchgehende Tradition auf. Konrad II. griff mit seinem Umritt auf eine Handlung des verstorbenen Kaiser Heinrich II. zurück, der einen ersten Königsumritt nach seiner Krönung 1002 unternommen hatte. Heinrich wie Konrad setzten mit dem Umritt wiederum eine Tradition der Herrschaftsübernahme und -antrittes fort, die vor allem die merowingischen Könige im 6. Jahrhundert genutzt hatten, um ihre jeweilige Königsherrschaft zu gewinnen, zu sichern, anzutreten oder in zeremonieller Weise ihren Untertanen zu präsentieren. Der Ausgangspunkt des Umritts bei Heinrich II. und Konrad II. war, dass beide durch die Wahl als König eingesetzt wurden und nicht durch Erbrecht oder Designation an die Macht kamen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ziele des Königsumritts
- Die Quellen
- Die Gesta Chuonradi II. imperatoris von Wipo
- Die ausgestellten Urkunden während des Königsumritts
- Konrad der Ältere, Konrad der Jüngere und die Wahl zu Kamba
- Von Mainz nach Köln
- Die Krönung von Konrad und Gisela
- Die Schenkung an den Dom zu Speyer
- Von Köln nach Aachen
- Von Aachen in das sächsische Gebiet
- Von Sachsen nach Ostfranken und Bayern
- In Konstanz
- Die ersten politischen Schritte nach Italien
- Die Gesandtschaft aus Pavia und die Idee des transpersonalen Regnum
- Burgund und Basel
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den ersten Königsumritt Konrads II. im Zeitraum von September 1024 bis Juni 1025. Sie befasst sich mit den Zielen und Aufgaben, die Konrad während dieser Reise zu lösen hatte, sowie mit den politischen und rechtlichen Herausforderungen, denen er sich stellen musste. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Königsumritts für die Festigung der königlichen Autorität und die Durchsetzung von Konrads Herrschaftsanspruch.
- Die politische Bedeutung des Königsumritts im 11. Jahrhundert
- Die Rolle der Gesta Chuonradi II. imperatoris von Wipo als Quelle zur Rekonstruktion des Umritts
- Die Herausforderungen, die Konrad II. während seines Umritts bewältigen musste, wie z.B. die Opposition der Lothringer und die Gewinnung der Huldigung der Sachsen
- Die Rolle der Königsurkunden als ergänzende Quelle zum Umritt
- Die Bedeutung der politischen und rechtlichen Aspekte des Königsumritts für die Durchsetzung von Konrads Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des Königsumritts von Konrad II. dar und erläutert die politische Situation im Reich nach dem Tod Kaiser Heinrichs II. Sie führt in die Forschungsfrage ein, welche Aufgaben und Probleme Konrad während seiner ersten Reise als König lösen musste. Die Einleitung stellt auch die Quellenlage dar und beschreibt die Bedeutung der Gesta Chuonradi II. imperatoris von Wipo und der Königsurkunden für die Rekonstruktion des Umritts.
Das Kapitel „Die Ziele des Königsumritts“ analysiert die Motivationen und Ziele, die Konrad mit seinem Umritt verfolgte. Es beleuchtet die Bedeutung der persönlichen Bindung zwischen König und Lehnsmann, die Notwendigkeit, die Huldigung aller Fürsten zu gewinnen, und die Bedeutung der Hoftage für die Durchsetzung der königlichen Autorität. Das Kapitel beschreibt auch die Herausforderungen, die Konrad bewältigen musste, wie z.B. die Opposition der Lothringer und die Gewinnung der Huldigung der Sachsen.
Das Kapitel „Die Quellen“ geht auf die wichtigsten Quellen zur Rekonstruktion des Königsumritts ein, nämlich die Gesta Chuonradi II. imperatoris von Wipo und die Königsurkunden. Es analysiert die Stärken und Schwächen beider Quellen und diskutiert die Intentionen des Autors Wipo. Das Kapitel erläutert auch die Bedeutung der Königsurkunden als Ergänzung zu Wipos Erzählung.
Die folgenden Kapitel beschreiben die einzelnen Stationen des Königsumritts, beginnend mit der Wahl Konrads zu Kamba und der Krönung in Mainz. Jedes Kapitel analysiert die politischen Ereignisse und Entscheidungen, die Konrad an den jeweiligen Orten traf, sowie die Bedeutung dieser Entscheidungen für seine Herrschaft.
Schlüsselwörter
Königsumritt, Konrad II., Gesta Chuonradi II. imperatoris, Wipo, Königsurkunden, Huldigung, Herrschaftsanspruch, Lothringer, Sachsen, Hoftag, Politik, Recht, Mittelalter, Geschichte, Quellenkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Zweck des Königsumritts von Konrad II.?
Der Königsumritt diente der Festigung der Herrschaft. Da es keinen festen Verwaltungsapparat gab, musste der König persönlich präsent sein, um die Huldigung der Fürsten entgegenzunehmen und Lehnsbindungen zu bestätigen.
Welche Route nahm Konrad II. bei seinem ersten Umritt (1024-1025)?
Die Reise begann nach der Wahl in Kamba und der Krönung in Mainz. Stationen waren unter anderem Köln, Aachen, das sächsische Gebiet, Ostfranken, Bayern, Konstanz und schließlich Basel.
Was ist die wichtigste Quelle für diesen Königsumritt?
Die zentrale literarische Quelle ist die "Gesta Chuonradi II. imperatoris" von Wipo. Ergänzend dienen die während der Reise ausgestellten Königsurkunden zur Rekonstruktion der Reiseroute und politischen Entscheidungen.
Warum gab es Widerstand bei den Lothringern?
Die lothringischen Großen standen Konrad II. zunächst skeptisch gegenüber, da er nicht durch Erbrecht, sondern durch Wahl an die Macht kam. Konrad musste durch Verhandlungen und Präsenz ihre Anerkennung gewinnen.
Welche Bedeutung hatte die Station Aachen für Konrad II.?
Aachen war als Krönungsort Karls des Großen von hoher symbolischer Bedeutung. Durch den Besuch knüpfte Konrad an die karolingische Tradition an und legitimierte seinen Herrschaftsanspruch als rechtmäßiger Nachfolger.
Was versteht man unter dem "Reisekönigtum"?
Es beschreibt eine Regierungsform im Mittelalter, bei der der Herrscher keine feste Residenz hatte, sondern ständig von Pfalz zu Pfalz zog, um vor Ort Hoftage abzuhalten und Recht zu sprechen.
- Quote paper
- Magister Artium Astrid Klahm (Author), 2007, Der erste Königsumritt des Saliers Konrad II, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385474