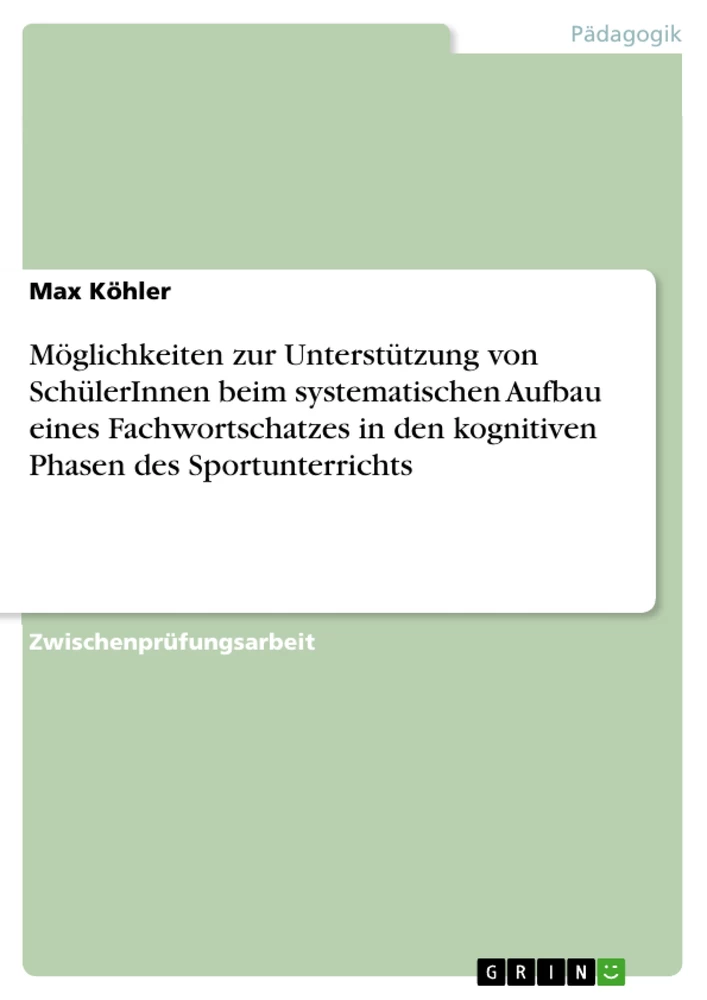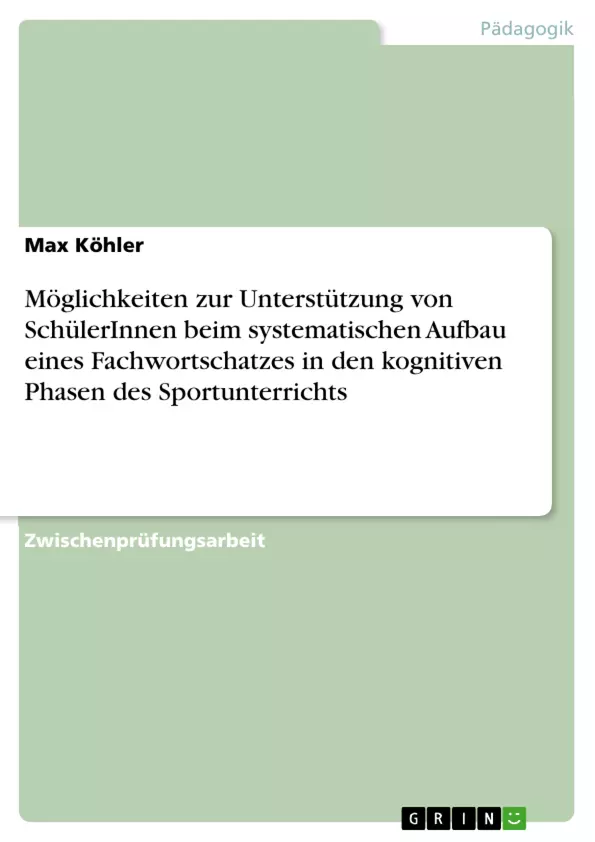Betrachtet man den angedachten Beitrag des Faches Sport zur Bildung und Erziehung in der Grundschule im Berliner Rahmenlehrplan, so lässt sich zweifelsohne feststellen, dass Ziele bezüglich des Erwerbs von sprachlichen Kompetenzen, wenn überhaupt, nur peripher angesprochen und verfolgt werden. Beschränkt wird sich hierbei lediglich auf bekannt vage Äußerungen wie "Sachkompetenz entwickeln die Schülerinnen und Schüler, indem sie grundlegende Bewegungsformen benennen" oder "Bewegungsbeschreibungen umsetzen".
Zum Erreichen dieser Standards ist die Verwendung von Fachsprache obligatorisch. Inwiefern und unter welchen Voraussetzungen dies gelingen kann, ist Thema dieser Arbeit. Detaillierter ausgeführt, geht es um Möglichkeiten zur Unterstützung von SuS beim systematischen Aufbau eines Fachwortschatzes in den kognitiven Phasen des Sportunterrichtes. Ein handlungsleitendes Interesse lässt sich durch den geringen Umfang an bisher publizierten, praktisch umsetzbaren Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf Sprachförderung im Sportunterricht und die Tatsache, dass ich als Lehrkraft mittelfristig weiterführend in diesem Unterrichtsfach tätig sein werde, ableiten.
Zunächst wird auf die Dokumentation und Reflexion der Unterrichtserfahrungen eingegangen. Anschließend werden daraus folgende Merkmale und Chancen der Sprachförderung des Sporttreibens und Bewegens im Allgemeinen und dem Sportunterricht im Speziellen in Verbindung zum Sprachenlernen thematisiert. Weiterführend kommt es zu den damit verbundenen Risiken. Abschließend wird im Fazit zusätzlich zu der empirischen Basis erneut eine persönliche Meinung punktuell Raum finden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Lerngruppenanalyse
- 2.1 Allgemeine Lerngruppenanalyse
- 2.2 Institutionelle Voraussetzungen
- 3. Untersuchungspraxis im Schulbetrieb
- 4. Evaluation
- 5. Fazit
- 6. Literaturverzeichnis
- 7. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Sprachförderung im Sportunterricht und beleuchtet Möglichkeiten, die Schüler*innen beim systematischen Aufbau eines Fachwortschatzes in den kognitiven Phasen des Sportunterrichts zu unterstützen. Die Analyse basiert auf persönlichen Unterrichtserfahrungen und untersucht die Bedeutung von Fachsprache im Sportunterricht, insbesondere in Hinblick auf den Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1-10.
- Die Bedeutung von Fachsprache im Sportunterricht im Kontext des neuen Rahmenlehrplans
- Die Analyse von Möglichkeiten zur Förderung des Fachwortschatzes in den kognitiven Phasen des Sportunterrichts
- Die Dokumentation und Reflexion der persönlichen Unterrichtserfahrungen im Hinblick auf Sprachförderung
- Die Bedeutung des Lehrers als Sprachvorbild und die Rolle von Visualisierung und Feedback im Spracherwerb
- Die Analyse von Herausforderungen und Chancen der Sprachförderung im Sportunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der geringen Berücksichtigung von sprachlichen Kompetenzen im Sportunterricht im Kontext der Rahmenlehrpläne dar und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 beschreibt die Lerngruppenanalyse, die sich auf zwei Gruppen von Schülern fokussiert: eine achte Klasse (LSEK1) und einen Q2-Kurs der Oberstufe (LSEK2). Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Gruppen werden in Bezug auf ihre sprachlichen Fähigkeiten und ihre Motivation im Sportunterricht beleuchtet.
Kapitel 3 befasst sich mit der Untersuchungspraxis im Schulbetrieb. Der Autor beschreibt seinen Ansatz zur Sprachförderung im Sportunterricht, indem er auf die Wichtigkeit von Fachsprache, Visualisierung und Feedback eingeht. Die verwendeten Methoden und Prinzipien werden detailliert erläutert, sowie die Bedeutung von Lehrerhandeln als Sprachvorbild hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Sprachförderung, Fachwortschatz, Sportunterricht, Rahmenlehrplan, Unterrichtserfahrungen, Visualisierung, Feedback, Sprachvorbild, kognitive Phasen, Schüleraktivität, Motivation, Komposita, Imperative, Lerngruppenanalyse, institutionelle Voraussetzungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Sprachförderung im Sportunterricht wichtig?
Sport bietet durch kognitive Phasen die Chance, Fachwortschatz systematisch aufzubauen, was laut Rahmenlehrplan für die Sachkompetenz der Schüler unerlässlich ist.
Welche Rolle spielt die Visualisierung beim Spracherwerb im Sport?
Visualisierungen helfen Schülern, Bewegungsbeschreibungen und Fachbegriffe besser zu verstehen und diese direkt mit praktischen Übungen zu verknüpfen.
Wie kann die Lehrkraft als Sprachvorbild fungieren?
Durch die konsequente Verwendung präziser Fachsprache, Imperative und klarer Rückmeldungen unterstützt der Lehrer die Schüler beim Erlernen korrekter Bezeichnungen.
Was sind die „kognitiven Phasen“ im Sportunterricht?
Das sind Unterrichtsabschnitte, in denen Bewegungsabläufe reflektiert, besprochen oder theoretisch erklärt werden, anstatt nur körperlich aktiv zu sein.
Welche sprachlichen Herausforderungen gibt es im Fach Sport?
Besonders Komposita (zusammengesetzte Wörter) und die Umsetzung komplexer Bewegungsanleitungen stellen Schüler oft vor sprachliche Hürden.
- Quote paper
- Max Köhler (Author), 2017, Möglichkeiten zur Unterstützung von SchülerInnen beim systematischen Aufbau eines Fachwortschatzes in den kognitiven Phasen des Sportunterrichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385546