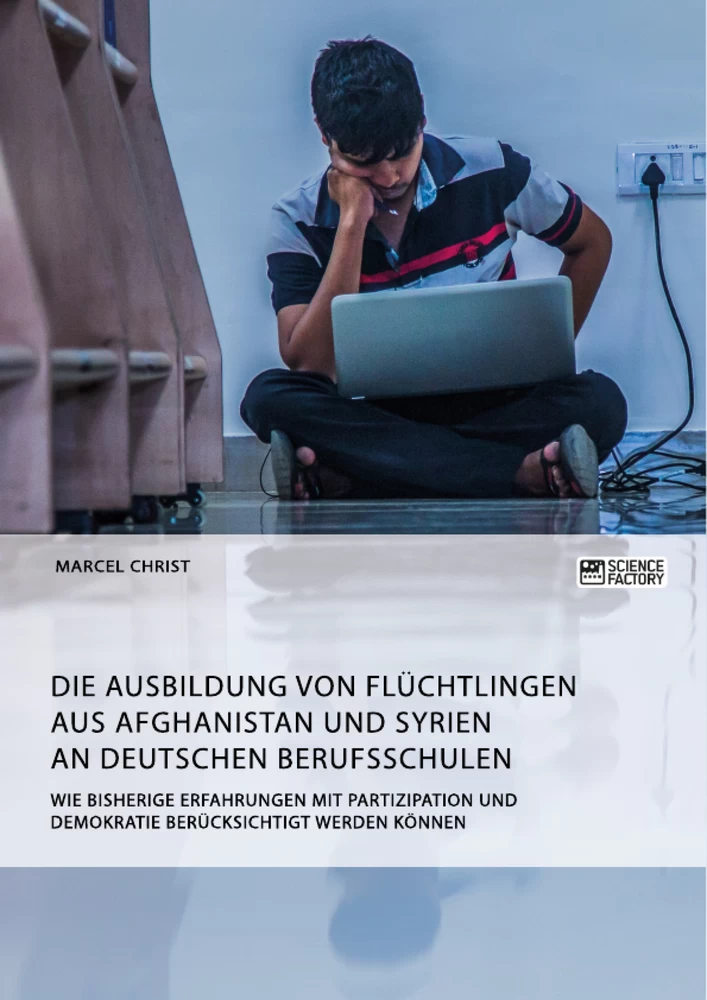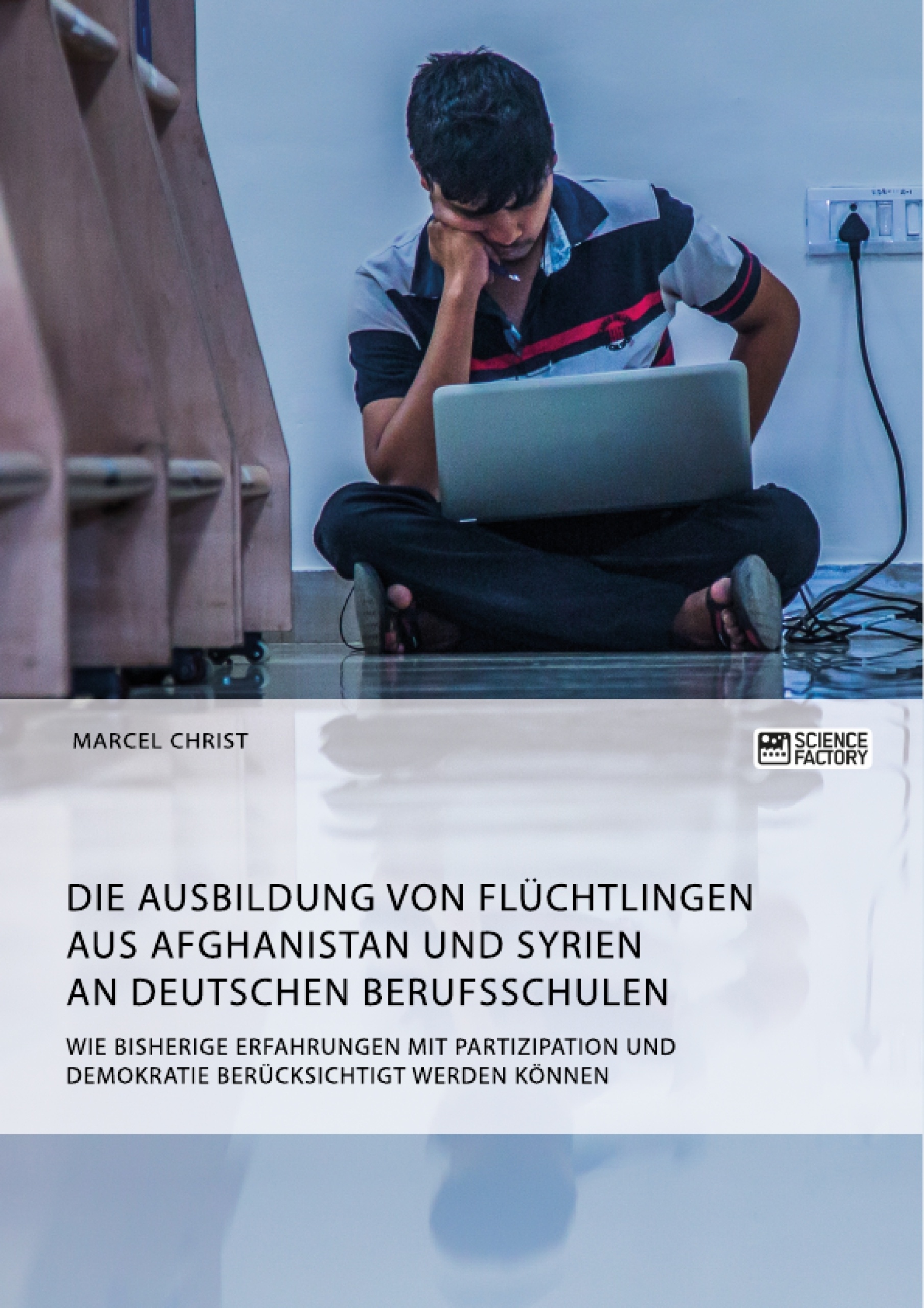Zwischen 2014 und 2015 wuchs die Anzahl der Asylanträge in der Europäischen Union um 110%. Mit diesem Zuwachs ist auch die Anzahl junger Menschen gestiegen, die sich ohne ihre Eltern oder einen gesetzlichen Vormund auf die Flucht begeben haben oder während der Flucht von diesen getrennt wurden. Da bei einem Großteil dieser jungen Menschen von einem mittel- oder langfristigen Aufenthalt in Deutschland auszugehen ist, stehen vor allem Berufsschulen aktuell vor großen Herausforderungen.
Erfahrene Lehrkräfte geben im Bereich der Flüchtlingsbeschulung häufig an, mit migrationsspezifischen Problemen konfrontiert zu sein, die vor allem aus kulturellen Unterschieden entspringen. Tatsächlich spielen die bisherigen Erfahrungen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in Bezug auf Demokratie und Partizipation in ihren Heimatländern eine Schlüsselrolle im Integrationsprozess.
Marcel Christ gibt in dieser Publikation einen detaillierten Einblick in die partizipationsrelevanten Rahmenbedingungen in Afghanistan und Syrien auf politischer, schulischer, beruflicher und gesellschaftlicher Ebene. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen als Hilfestellung dienen, um das partizipationsspezifische Verhalten von Asylsuchenden im Rahmen des Schulalltags in Deutschland besser einschätzen, vorhersagen und nachvollziehen zu können.
Aus dem Inhalt:
- Partizipation;
- Demokratie;
- Asylsuchende;
- Berufsschule;
- Afghanistan;
- Syrien
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis.
- Abbildungsverzeichnis.
- 1 Problemstellung
- 2 Partizipation
- 2.1 Der Begriff Partizipation
- 2.2 Formen, Modi und Bereiche von Partizipation
- 2.3 Voraussetzungen für Partizipation
- 2.4 Partizipation von Jugendlichen
- 2.5 Partizipationserfahrungen und Demokratieverständnis
- 3 Rahmenbedingungen politischer, schulischer, beruflicher und sozialer Partizipation in Afghanistan und Syrien
- 3.1 Afghanistan
- 3.2 Syrien
- 3.3 Zusammenfassung
- 4 Thesen zu integrationsrelevanten Auffassungen unbegleiteter, minderjähriger, berufsschulpflichtiger Flüchtlinge und Asylsuchender aus Afghanistan und Syrien
- 4.1 Afghanistan
- 4.2 Syrien
- 5 Fazit, zentrale Ergebnisse und Limitationen
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Ausbildung von Flüchtlingen aus Afghanistan und Syrien an deutschen Berufsschulen und untersucht, wie bisherige Erfahrungen mit Partizipation und Demokratie in den Ausbildungsprozess integriert werden können.
- Der Begriff Partizipation und seine Relevanz für die Integration von Flüchtlingen
- Formen, Modi und Bereiche von Partizipation im Bildungsbereich
- Voraussetzungen für Partizipation von Jugendlichen, insbesondere im Kontext von Flucht und Migration
- Partizipationserfahrungen und Demokratieverständnis von Jugendlichen aus Afghanistan und Syrien
- Rahmenbedingungen politischer, schulischer, beruflicher und sozialer Partizipation in Afghanistan und Syrien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung ein und beleuchtet die Herausforderungen, die mit der Integration von Flüchtlingen aus Afghanistan und Syrien in das deutsche Bildungssystem verbunden sind. Das zweite Kapitel widmet sich dem Konzept der Partizipation, definiert den Begriff und untersucht verschiedene Formen, Modi und Bereiche von Partizipation. Des Weiteren werden die Voraussetzungen für Partizipation und deren Bedeutung für die Entwicklung von Jugendlichen, insbesondere im Kontext von Flucht und Migration, betrachtet. Kapitel drei analysiert die Rahmenbedingungen politischer, schulischer, beruflicher und sozialer Partizipation in Afghanistan und Syrien, indem es die jeweilige politische und gesellschaftliche Situation in beiden Ländern beleuchtet. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit Thesen zu integrationsrelevanten Auffassungen unbegleiteter, minderjähriger, berufsschulpflichtiger Flüchtlinge und Asylsuchender aus Afghanistan und Syrien. Es analysiert die Perspektiven und Erfahrungen dieser Jugendlichen und deren Erwartungen an das deutsche Bildungssystem.
Schlüsselwörter
Partizipation, Demokratieverständnis, Integration, Ausbildung, Berufsschule, Flüchtlinge, Afghanistan, Syrien, Bildungssystem, Interkulturelle Kompetenz, Interkulturelle Bildung, Flucht und Migration, Jugend, Sozialisation, Interkulturelle Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Herausforderungen haben Berufsschulen bei der Flüchtlingsbeschulung?
Lehrkräfte stehen vor migrationsspezifischen Problemen, die oft aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Erfahrungen mit Demokratie resultieren.
Wie wird Partizipation in diesem Kontext definiert?
Partizipation umfasst die politische, schulische, berufliche und soziale Teilhabe der Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben in Deutschland.
Welche Rolle spielen die Heimatländer Afghanistan und Syrien?
Die Arbeit analysiert die dortigen Rahmenbedingungen, um das Verhalten und die Erwartungen der Asylsuchenden im deutschen Schulalltag besser zu verstehen.
Was sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge?
Es handelt sich um junge Menschen, die ohne Eltern oder gesetzlichen Vormund nach Europa geflohen sind und oft langfristig in Deutschland bleiben.
Wie kann interkulturelle Kompetenz bei der Integration helfen?
Durch das Verständnis für die bisherigen Erfahrungen der Flüchtlinge können Lehrkräfte das Verhalten der Schüler besser einschätzen und Integrationsprozesse fördern.
- Arbeit zitieren
- Marcel Christ (Autor:in), 2017, Die Ausbildung von Flüchtlingen aus Afghanistan und Syrien an deutschen Berufsschulen. Wie bisherige Erfahrungen mit Partizipation und Demokratie berücksichtigt werden können, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385643