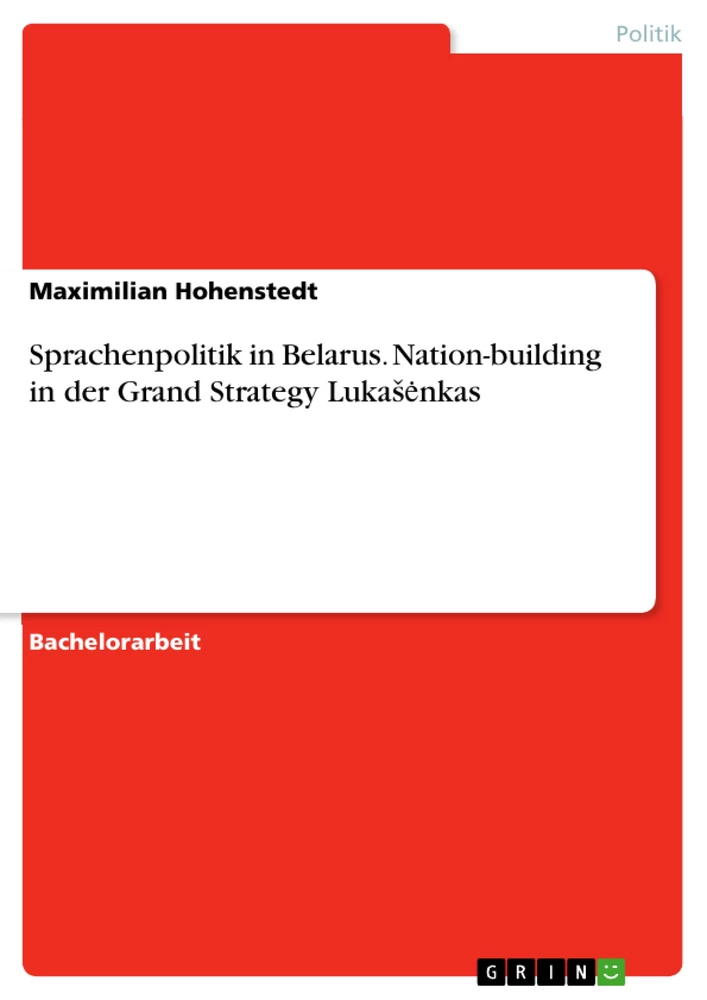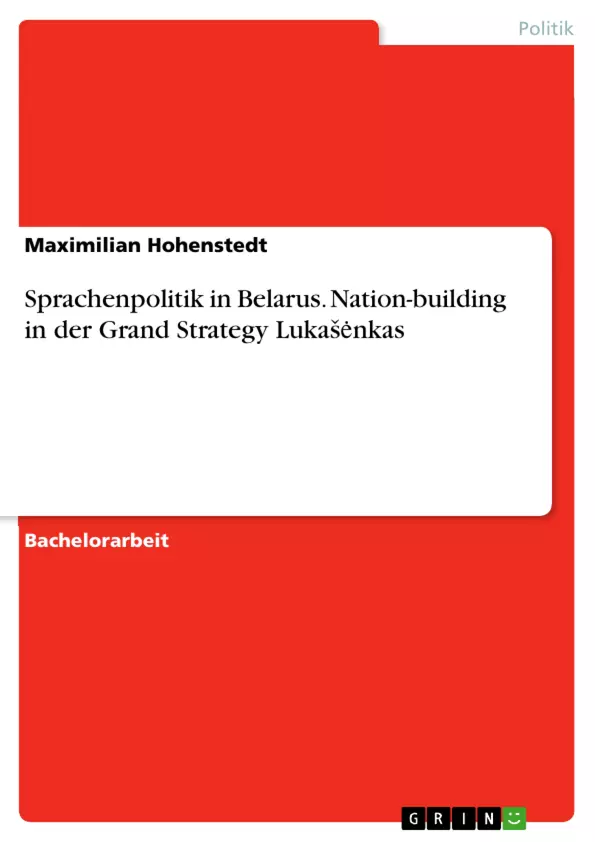In dieser Bachelorarbeit soll untersucht werden, wie sich die Sprachenpolitik in Belarus seit 1995 unter Präsident Aljaksandr Lukašėnka geändert hat und was die Ursachen für diese Veränderungen sind.
Ziel wird es sein, anhand der vorliegenden Daten zur Entwicklung und Perzeption der Sprachgewohnheiten in Belarus darzulegen, inwieweit die Sprachenpolitik bestimmend ist für Aufstieg und Machterhalt Lukašėnkas und inwiefern er die Symbolkraft dieser Thematik für sich zu nutzen verstand und nutzen musste.
Wie aus der Arbeit hervorgehen wird, ist die Frage der Sprache sowohl im Spannungsfeld zu Russland als auch in Belarus selbst stets eine politische Frage und für jeden politischen Akteur von Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyseraster: nation-building & Sprachenpolitik:
- Nation, Nationalismus, nation-building - ein theoretischer Überblick:
- Hybride Identitäten: civic nationalism vs. ethnic nationalism
- Egalitarian nationalism
- Sprachenpolitik als Werkzeug des nation-building
- Konzeptspezifikation:
- Nation, Nationalismus, nation-building - ein theoretischer Überblick:
- Drei Fälle Belarus
- Sprachenpolitik und nationale Identität Belarus' bis 1994:
- Partisanenkrieg, Tschernobyl, Kuropaty und die belarusische Identität.
- Neue Sprachenpolitik und nation-building
- Lukašėnkas Sprachenpolitik und die Identität Belarus' ab 1994:
- Sprachenpolitik als Symbolpolitik
- Die Sprachkarte der Opposition: Sprache des Untergrunds?
- Lukašėnkas Staatsideologie: Nationalidentität ohne Nation?
- Sprachenpolitik nach der Wahl 2010: Kurswechsel oder Anpassung?
- Lukašėnkas Sprachtaktik im Rahmen der grand strategy
- Postsowjetischer Schwanengesang: Sprache als Faustpfand?
- Sprachenpolitik und nationale Identität Belarus' bis 1994:
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Arbeit untersucht die Veränderungen in der Sprachenpolitik in Belarus seit 1995 unter Präsident Aljaksandr Lukašėnka und analysiert die Ursachen dieser Veränderungen. Das besondere Interesse gilt dem Wandel der Sprachenpolitik in einem stabilen autokratischen System, das ohne ethnokulturelle Legitimationsbasis hohe Zustimmungsraten generiert und gleichzeitig die eigene Unabhängigkeit bewahrt.
- Die Rolle der Sprachenpolitik im nation-building in Belarus
- Der Einfluss von Lukašėnkas grand strategy auf die Sprachenpolitik
- Die Nutzung der Sprachenpolitik als Mittel der Machtsicherung
- Die Verbindung zwischen Sprachenpolitik und nationaler Identität
- Der Vergleich der Sprachenpolitik in Belarus mit anderen postsowjetischen Staaten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und stellt die zentralen Forschungsfragen vor. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen für die Analyse der Sprachenpolitik gelegt, indem die Konzepte Nation, Nationalismus und nation-building sowie wichtige Ansätze der Nationalismusforschung vorgestellt werden. Die verschiedenen Phasen der Sprachenpolitik in Belarus werden im dritten Kapitel anhand von historischen und politischen Ereignissen untersucht. Dabei werden sowohl die Regierungspolitik als auch die Sprachpraktiken der Opposition beleuchtet.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Themen nation-building, Sprachenpolitik, Belarus, Aljaksandr Lukašėnka, nationalistische Ideologie, egalitarian nationalism, postsowjetische Staaten, russische Sprache, belarusische Sprache, Identität, Symbolpolitik, grand strategy, Machterhalt, Herrschaftssicherung.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Sprachenpolitik unter Lukašėnka verändert?
Seit 1995 wurde die russische Sprache massiv gefördert und der belarusischen Sprache gleichgestellt, was de facto zu einer Dominanz des Russischen führte.
Welche Rolle spielt die Sprache beim 'Nation-building' in Belarus?
Sprache wird als politisches Instrument genutzt, um eine nationale Identität zu schaffen, die eng mit Russland verbunden bleibt, anstatt eine rein ethnisch-belarusische Identität zu fördern.
Warum nutzt Lukašėnka die Sprachkarte als Symbolpolitik?
Um seine Macht zu sichern, nutzt er die russische Sprache als Zeichen für Stabilität und enge Bindung an Moskau, während die belarusische Sprache oft mit der Opposition assoziiert wird.
Was versteht man unter 'civic nationalism' im belarusischen Kontext?
Es beschreibt eine Staatsidentität, die auf staatlichen Strukturen und Ideologien basiert, statt auf einer gemeinsamen ethnischen oder sprachlichen Herkunft.
Hat sich der Kurs nach der Wahl 2010 geändert?
Es gab taktische Anpassungen, bei denen die belarusische Sprache zeitweise wieder stärker als Symbol der Unabhängigkeit gegenüber Russland instrumentalisiert wurde.
- Arbeit zitieren
- Maximilian Hohenstedt (Autor:in), 2016, Sprachenpolitik in Belarus. Nation-building in der Grand Strategy Lukašėnkas, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385714