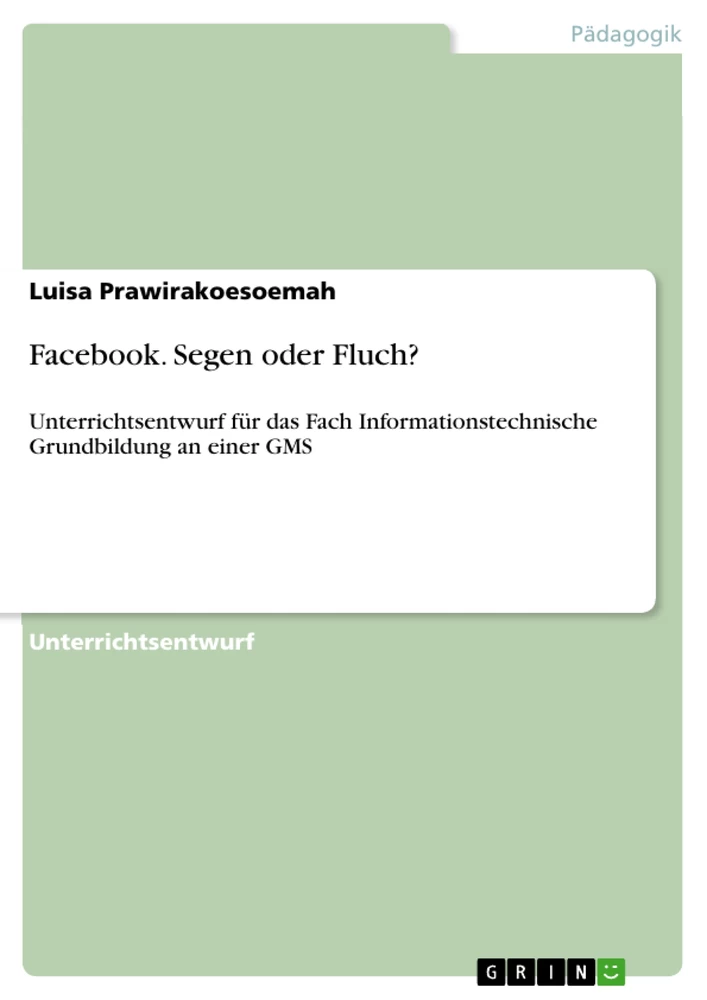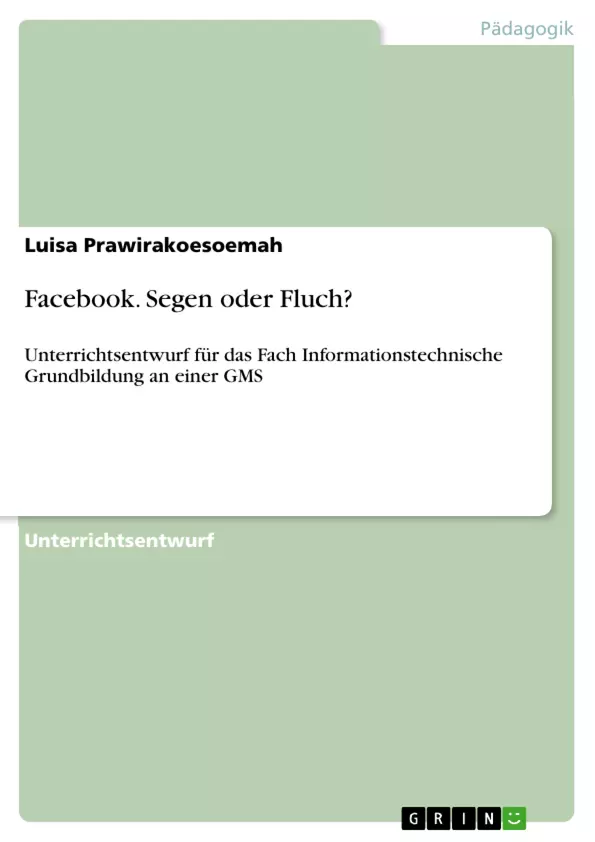Die Schülerinnen und Schüler sollen durch ein WebQuest, welches diverse Fragen zur Nutzung des sozialen Netzwerks Facebook beinhaltet, das Recherchieren im Internet üben und sich im Zuge dessen kritisch mit der Thematik Facebook auseinander setzen.
Für diese Unterrichtsstunde ist die Anbahnung der Medienkompetenz von zentraler Bedeutung, beinhaltet sie doch das Recherchieren von adäquaten Informationen mithilfe des Internets sowie das kritische Auseinandersetzen mit der Thematik Facebook. Durch die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und privaten Veränderungen gehören heute sowohl Strategien zur sinnvollen Auswahl von Information wie auch die Urteilsfähigkeit über Information und deren Mittler zur Allgemeinbildung eines jeden Einzelnen.
Im Bereich "Arbeiten und Lernen mit informationstechnischen Werkzeugen" spielt die Kompetenz "Informationen aus unterschiedlichen Quellen beschaffen , mit sinnvollen Suchstrategien und Hilfsmitteln recherchieren sowie die Brauchbarkeit der Ergebnisse beurteilen" eine zentrale Rolle. In Zusammenhang zur Thematik der sozialen Netzwerke sollen die Schüler im Bereich "Zusammenarbeiten und Kommunizieren" mögliche Gefahren durch die ungeschützte Preisgabe persönlicher Daten sowie durch den Austausch von Dateien erkennen und Maßnahmen zum Schutz ergreifen. Ihre gesammelten Informationen sollen in einfachen, in größeren Text- und Präsentations-Dokumenten dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Welche Bedingungen nehmen Einfluss auf die Lernsituation?
- 1.1 Institutionelle Bedingungen
- 2. Analyse der Sache und des Inhalts
- 2.1 Das soziale Netzwerk Facebook
- 3. Leitende fachdidaktische Aspekte
- 3.1 Bezug zum Bildungsplan
- 3.2 Begründung des Einsatzes der angewandten Verfahren im Unterricht
- 3.3 Einbettung der Unterrichtsstunde in die Unterrichtseinheit
- 4. Kompetenzen und Lernziele
- 5. Gestaltung der Lehr- / Lernprozesse
- 5.1 Einstieg
- 5.2 Arbeitsphase
- 5.3 Ergebnissicherung / Abschluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschreibt einen Unterrichtsentwurf für das Fach Informationstechnische Grundbildung zum Thema Facebook. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler durch ein WebQuest zum kritischen Umgang mit sozialen Netzwerken zu befähigen und ihre Recherchekompetenzen im Internet zu fördern. Der Entwurf beinhaltet eine fächerübergreifende Zusammenarbeit mit dem Fach Deutsch.
- Kritische Auseinandersetzung mit Facebook als soziales Netzwerk
- Förderung der Recherchekompetenzen im Internet
- Entwicklung von Medienkompetenz
- Fächerübergreifende Zusammenarbeit (Deutsch und ITG)
- Analyse der institutionellen Bedingungen des Unterrichts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Welche Bedingungen nehmen Einfluss auf die Lernsituation?: Dieses Kapitel analysiert die institutionellen Bedingungen der Lernsituation an der XY-Schule, einer Gemeinschaftsschule mit verschiedenen Jahrgangsstufen und einem differenzierten Lernansatz (Basis-, Aufbau- und Expertenstandard). Es beschreibt die Schülerstruktur, die Ausstattung des Computerraumes und das pädagogische Konzept der Schule, welches Selbstständigkeit und individuelle Förderung betont. Der Fokus liegt auf den Besonderheiten der Gemeinschaftsschule und wie diese die Gestaltung des IT-Unterrichts beeinflussen. Das Fehlen eines reinen ITG-Unterrichts und der Einsatz von "qualifiziertem Computerunterricht" als begleitendes Fach wird ebenfalls thematisiert.
2. Analyse der Sache und des Inhalts: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Facebook als soziales Netzwerk. Es beleuchtet die Geschichte, die Nutzerzahlen und das grundlegende Konzept von Facebook, einschließlich der Möglichkeiten der Profilgestaltung, der Interaktion mit anderen Nutzern und der Privatsphäre-Einstellungen. Darüber hinaus wird kritisch auf die Datenschutzproblematik und den Suchtfaktor eingegangen, wobei die kontroversen Aspekte der Datenweitergabe und des öffentlichen Images von Facebook hervorgehoben werden. Der Abschnitt zitiert Mark Zuckerberg um den ursprünglichen Zweck von Facebook zu verdeutlichen und diesen mit der aktuellen Situation zu kontrastieren.
3. Leitende fachdidaktische Aspekte: Dieses Kapitel befasst sich mit den fachdidaktischen Aspekten des Unterrichtsentwurfs. Es beschreibt den Bezug zum Bildungsplan und die Begründung für den Einsatz des WebQuests als Unterrichtsmethode. Die Einbettung der Stunde in die Gesamt-Unterrichtseinheit wird erläutert, um den Kontext und den didaktischen Ansatz zu verdeutlichen. Hier wird der immense Beitrag der Informationstechnischen Grundbildung zur Förderung von Medienkompetenz hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Facebook, Soziale Netzwerke, Medienkompetenz, Informationstechnische Grundbildung, WebQuest, Recherchekompetenz, Datenschutz, Gemeinschaftsschule, Differenzierung, kritischer Umgang mit Medien.
Unterrichtsentwurf Facebook: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieses Unterrichtsentwurfs?
Der Unterrichtsentwurf beschreibt eine Unterrichtsstunde im Fach Informationstechnische Grundbildung (ITG) zum Thema Facebook. Der Fokus liegt auf dem kritischen Umgang mit sozialen Netzwerken und der Förderung der Recherchekompetenzen der Schüler.
Welche Ziele werden mit dem Unterricht verfolgt?
Der Unterricht soll Schülerinnen und Schüler zu einem kritischen Umgang mit Facebook befähigen. Zusätzlich sollen die Recherchekompetenzen im Internet und die Medienkompetenz der Schüler verbessert werden. Es ist eine fächerübergreifende Zusammenarbeit mit dem Fach Deutsch geplant.
Welche Methoden werden im Unterricht eingesetzt?
Als zentrale Methode wird ein WebQuest eingesetzt. Dies ermöglicht den Schülern selbstständiges und forschendes Lernen zum Thema Facebook.
Welche Aspekte der Lernsituation werden analysiert?
Der Entwurf analysiert die institutionellen Bedingungen der Lernsituation an einer Gemeinschaftsschule, einschließlich der Schülerstruktur, der Ausstattung des Computerraums und des pädagogischen Konzepts der Schule. Besondere Berücksichtigung findet die spezifische Situation des ITG-Unterrichts an dieser Schule.
Wie wird Facebook im Unterricht behandelt?
Der Unterricht beleuchtet Facebook als soziales Netzwerk, seine Geschichte, Nutzerzahlen und sein grundlegendes Konzept. Ein Schwerpunkt liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit der Datenschutzproblematik, dem Suchtfaktor und den kontroversen Aspekten der Datenweitergabe und des öffentlichen Images.
Welche fachdidaktischen Aspekte werden berücksichtigt?
Der Entwurf beschreibt den Bezug zum Bildungsplan, die Begründung für den Einsatz des WebQuests und die Einbettung der Stunde in die Gesamt-Unterrichtseinheit. Der immense Beitrag der ITG zur Förderung von Medienkompetenz wird hervorgehoben.
Welche Kompetenzen sollen die Schüler am Ende der Stunde erworben haben?
Die Schüler sollen einen kritischen Umgang mit sozialen Netzwerken wie Facebook entwickelt haben, ihre Recherchekompetenzen im Internet verbessert haben und ihre Medienkompetenz erweitert haben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Unterrichtsentwurfs?
Schlüsselwörter sind: Facebook, Soziale Netzwerke, Medienkompetenz, Informationstechnische Grundbildung, WebQuest, Recherchekompetenz, Datenschutz, Gemeinschaftsschule, Differenzierung, kritischer Umgang mit Medien.
Wie ist der Unterrichtsentwurf strukturiert?
Der Entwurf enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste mit Schlüsselwörtern.
Für welche Schulform ist der Unterrichtsentwurf konzipiert?
Der Unterrichtsentwurf ist für eine Gemeinschaftsschule konzipiert, die einen differenzierten Lernansatz (Basis-, Aufbau- und Expertenstandard) verfolgt.
- Quote paper
- Luisa Prawirakoesoemah (Author), 2015, Facebook. Segen oder Fluch?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/385936