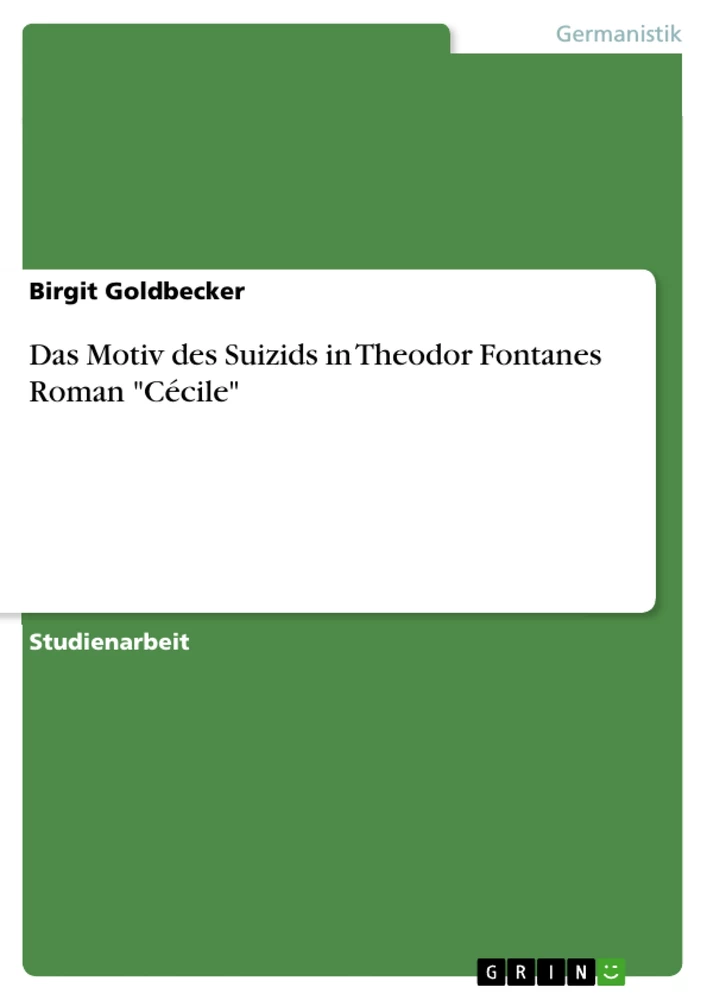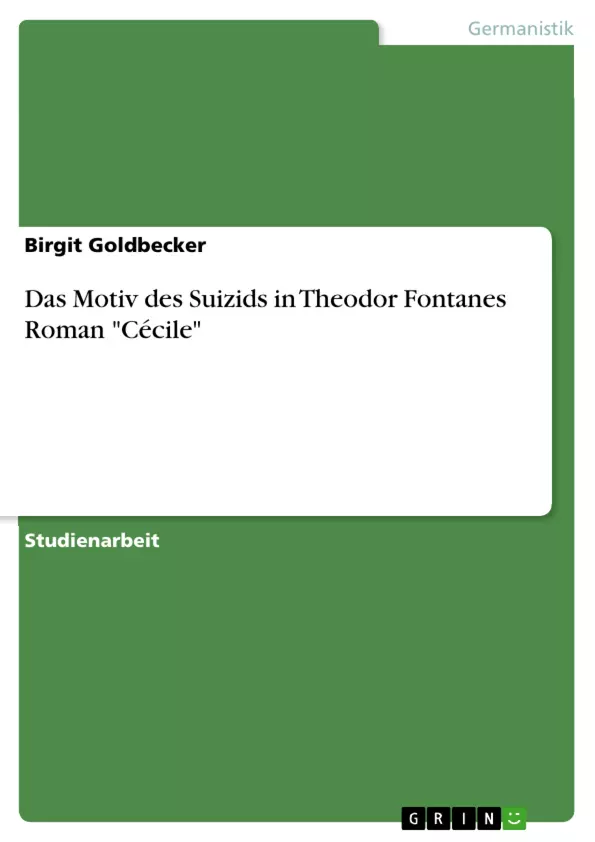Im 19. Jahrhundert versuchten die zivilen Behörden die Tatsache zu verbergen, dass es eine deutliche Erhöhung der Suizidrate gab. Während im 18. Jahrhundert die physischen und natürlichen Erklärungen für einen Suizid, die der übernatürlichen verdrängt hatten, wurden sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder zugunsten von unmoralischen Erklärungen beiseitegeschoben. Theodor Fontane schrieb seinen Roman Cécile demnach in einer Zeit, in der der Suizid als widernatürliches Ereignis angesehen wurde. Als eine Art Wahnsinn betrachtet, wurde es dem Delirium oder der Geisteskrankheit zugeschrieben, dessen Tat in geistiger Umnachtung begangen wird. So äußerte sich auch die Kirche gegen den Suizid und forderte eine Wiedereinführung der Gesetze gegen ihn. Folglich verwehrte der Klerus Suizidtoten die Bestattung auf dem Friedhof, da ihr selbstverantworteter Tod als Zurückweisung der Oberherrschaft Gottes gedeutet wurde. Ähnlich standen die weltlichen Moralisten der Selbsttötung gegenüber. Er wurde als Laster der alten Gesellschaftsordnung angesehen, der es ermöglichte den Pflichten in der Gesellschaft zu entgehen.
Als Frevel gegen Gott, moralische Zerrüttung eines Geistes, der die bestehenden Werte mißachtet, Schwachsinn, mit der libertären Anarchie und dem Materialismus oder mit maßloser Frömmelei verbundene Geißel, jedenfalls als eine Krankheit des Geistes, des Bewußtseins und der Gesellschaft wird Selbstmord zusammen mit den andern großen gesellschaftlichen Verboten verdrängt.
Hinsichtlich dieser Ansichten des 19. Jahrhunderts ist es interessant zu untersuchen, in wieweit Fontane in seinem Werk Cécile das Motiv des Suizids eingesetzt hat. Wird die Verantwortung für die Selbsttötung im Roman im Einzelnen Individuum gesucht oder als Antwort auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und Konventionen? Wird das Motiv des Suizids daher aus psychologischer oder gesellschaftskritischer Sicht aufgegriffen? Inwieweit spielt es eine Rolle, dass eine Frau die Figur des Suizidenten einnimmt? Um diese Fragen zu beantworten, führt eine Erläuterung des Suizid-Begriffs in die Thematik ein und es wird das Motiv des Suizids in der Literatur der Jahrhundertwende dargelegt. Eine kurze formale Analyse gibt einen Einblick in den Roman Cécile, woraufhin die Motivanalyse folgt. Im Schluss werden die Ergebnisse zusammengefasst und gedeutet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Suizid - Eine Begriffserklärung
- Das Motiv des Suizids in der Literatur der Jahrhundertwende
- Cécile
- Formale Analyse
- Das Motiv des Suizids
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit dem Motiv des Suizids im Roman Cécile von Theodor Fontane. Ziel ist es, das Motiv des Suizids im Kontext der gesellschaftlichen und moralischen Ansichten des 19. Jahrhunderts zu analysieren und seine Bedeutung im Werk zu beleuchten.
- Die gesellschaftliche Wahrnehmung des Suizids im 19. Jahrhundert
- Die Darstellung des Suizids in der Literatur der Jahrhundertwende
- Das Motiv des Suizids in Cécile
- Die Rolle der Frau als Suizidentin in der literarischen Darstellung
- Die Verbindung zwischen Suizid und gesellschaftlichen Verhältnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen historischen Kontext und stellt die Fragestellungen der Arbeit vor. Kapitel 2 widmet sich der Definition des Suizid-Begriffs und beleuchtet verschiedene Facetten des suizidalen Verhaltens. Kapitel 3 betrachtet das Motiv des Suizids in der Literatur der Jahrhundertwende. In Kapitel 4 wird der Roman Cécile formal analysiert und das Motiv des Suizids im Werk beleuchtet.
Schlüsselwörter
Suizid, Selbstmord, Theodor Fontane, Cécile, Jahrhundertwende, gesellschaftliche Verhältnisse, literarische Darstellung, Frau als Suizidentin, Moral, gesellschaftliche Konventionen, Émile Durkheim, Soziale Theorie.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde Suizid im 19. Jahrhundert gesellschaftlich wahrgenommen?
Suizid wurde oft als "Wahnsinn", moralisches Laster oder Frevel gegen Gott angesehen. Die Kirche verweigerte Suizidtoten häufig die Bestattung auf Friedhöfen.
Welche Rolle spielt das Motiv des Suizids in Fontanes Roman "Cécile"?
Fontane nutzt das Motiv, um den Konflikt zwischen individuellem Schicksal und den starren gesellschaftlichen Konventionen der damaligen Zeit darzustellen.
Wird der Suizid im Roman psychologisch oder gesellschaftskritisch gedeutet?
Die Arbeit untersucht beide Aspekte: ob die Tat eine Antwort auf psychische Zerrüttung ist oder eine unvermeidliche Reaktion auf gesellschaftliche Zwänge.
Welche Bedeutung hat es, dass eine Frau die Suizidentin ist?
Die Arbeit analysiert die spezifische Rolle der Frau in der Literatur der Jahrhundertwende und wie ihre soziale Unfreiheit zum Suizidmotiv beiträgt.
Welche soziologischen Theorien werden in der Analyse herangezogen?
Es wird unter anderem auf die soziale Theorie von Émile Durkheim Bezug genommen, um den Suizid im Kontext gesellschaftlicher Verhältnisse zu verstehen.
- Arbeit zitieren
- Birgit Goldbecker (Autor:in), 2010, Das Motiv des Suizids in Theodor Fontanes Roman "Cécile", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386031