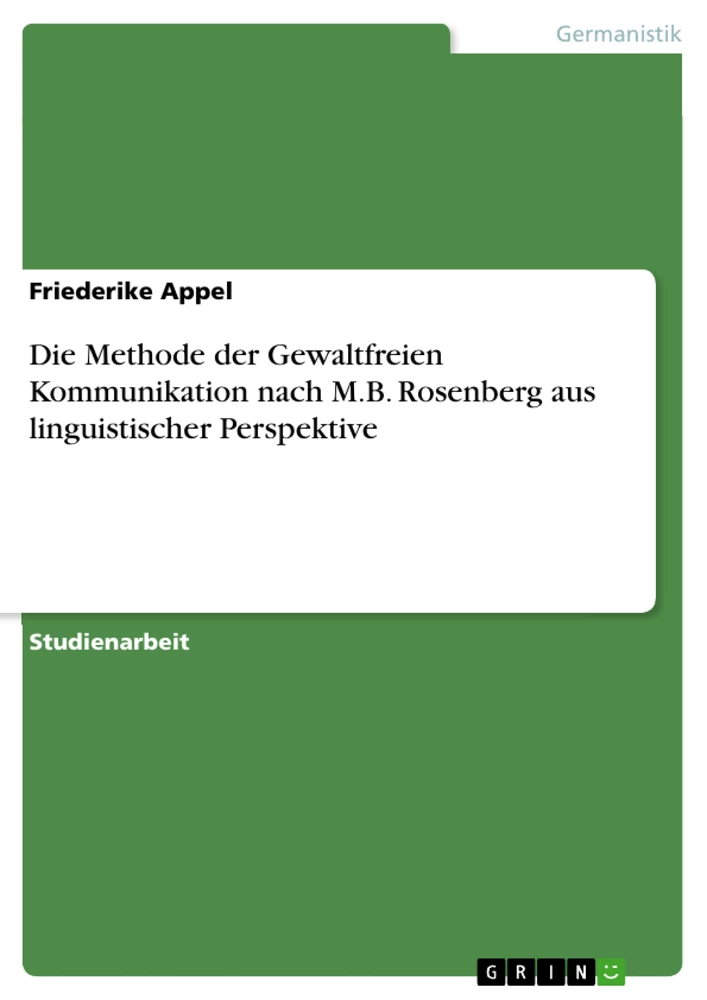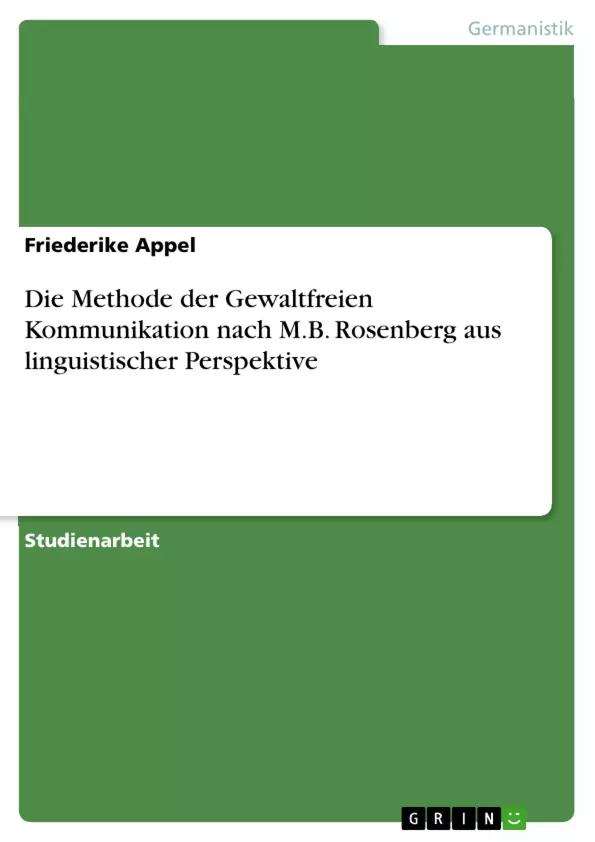In dieser Arbeit wird versucht, die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg mit linguistischen Methoden zu beschreiben und herauszufinden, ob sich ein heilsamer Umgang mit Sprache linguistisch fassen lässt.
Die GFK ist an sich keine rein linguistische Methode, obwohl sie auf den ersten Blick wie eine Strategie des pragmatischen Sprachhandelns wirken kann. In ihr mischen sich vielmehr linguistische, politische, sozialpädagogische, psychologische und therapeutische Elemente.
Gleichwohl liegt das zentrale Augenmerk auf dem Sprachgebrauch in unserem Kulturkreis. Rosenberg sieht die Kommunikation mit sich selbst und mit anderen als Schlüssel zu einem friedlichen Miteinander. Rosenberg analysiert, was an unserer Art zu sprechen gewalttätig ist, um dann zu einer Kommunikation zu finden, die gewaltlos ist und den Frieden zwischen Menschen fördert. Denn Rosenberg glaubt, dass alle Menschen im Grunde daran interessiert sind, das Leben zu bereichern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wie kann Sprache heilsam wirken?
- 3. Gewaltfreie Kommunikation nach den vier Schritten
- 3.1. Vier Ebenen der Kommunikation
- 3.2. Erster Schritt: Die Beobachtung
- 3.3. Zweiter Schritt: Gefühle ausdrücken
- 3.4. Dritter Schritt: Bedürfnisse äußern
- 3.5. Vierter Schritt: Bitten
- 3.6. Nonverbale Aspekte der Kommunikation
- 3.7. Einordnen in soziale Kontexte
- 4. Sprache und Weltanschauung
- 4.1. Bedürfnissprache
- 4.2. Statische, wertende Sprache
- 4.3. Ideologische Sprache
- 4.4. Prozessorientierte, lebendige Sprache
- 5. Präsenz im Sinne Martin Bubers
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg aus linguistischer Perspektive. Ziel ist es, die heilsame Wirkung von Sprache im Rahmen der GFK zu beschreiben und linguistisch zu analysieren. Die Arbeit betrachtet dabei nicht nur die pragmatische, sondern auch lexikalische und expressive Dimension von Sprache.
- Heilsame und gewaltsame Sprache
- Die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation
- Linguistische Analyse der GFK
- Der Einfluss von Sprache auf Weltanschauung
- Sprachgebrauch und soziale Kontexte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg ein und beschreibt deren Anwendung in verschiedenen Kontexten. Sie betont den interdisziplinären Charakter der GFK und kündigt die linguistische Analyse der Methode an, mit dem Ziel, die heilsame Wirkung von Sprache zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Sprache als Schlüssel für friedliches Miteinander, wie von Rosenberg postuliert.
2. Wie kann Sprache heilsam wirken?: Dieses Kapitel untersucht den Gegensatz zu gewaltsamer Sprache und beleuchtet die Möglichkeiten einer heilsamen Sprache. Es wird argumentiert, dass heilsame Sprache Individuen in die Gemeinschaft integriert und Anerkennung vermittelt. Der Text betont den dialogischen Charakter heilsamer Prozesse, wie sie in therapeutischen Gesprächen, Gebeten oder Mantras vorkommen. Im Gegensatz dazu wird die gewaltsame Sprache als exkludeirend dargestellt, die durch Benennung und Stigmatisierung soziale Ausgrenzung bewirkt. Das Kapitel stellt die zentrale Frage nach der Möglichkeit linguistischer Beschreibung heilsamer sprachlicher Prozesse.
Schlüsselwörter
Gewaltfreie Kommunikation (GFK), Marshall B. Rosenberg, heilsame Sprache, linguistische Analyse, Pragmatik, Lexik, Sprachgebrauch, soziale Kontexte, Dialog, Kommunikation, Weltanschauung, Frieden.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: "Linguistische Analyse der Gewaltfreien Kommunikation"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg aus linguistischer Perspektive. Der Fokus liegt auf der Beschreibung und linguistischen Analyse der heilsamen Wirkung von Sprache im Rahmen der GFK. Dabei werden die pragmatische, lexikalische und expressive Dimension von Sprache betrachtet.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: heilsame und gewaltsame Sprache, die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation, eine linguistische Analyse der GFK, den Einfluss von Sprache auf die Weltanschauung, und den Sprachgebrauch in sozialen Kontexten. Zusätzlich wird die Präsenz im Sinne Martin Bubers thematisiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Wie kann Sprache heilsam wirken?, Gewaltfreie Kommunikation nach den vier Schritten (inkl. Unterkapitel zu den einzelnen Schritten und nonverbalen Aspekten), Sprache und Weltanschauung (inkl. Unterkapitel zu Bedürfnissprache, statischer/wertender Sprache, ideologischer Sprache und prozessorientierter Sprache), Präsenz im Sinne Martin Bubers und Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die heilsame Wirkung von Sprache im Kontext der GFK zu beschreiben und linguistisch zu analysieren. Es soll untersucht werden, wie Sprache zum friedlichen Miteinander beitragen kann, wie von Rosenberg postuliert.
Wie wird die heilsame Wirkung von Sprache beschrieben?
Die Arbeit beschreibt heilsame Sprache als integrativ und anerkennend, im Gegensatz zu gewaltsamer Sprache, die als exkludeirend und stigmatisierend dargestellt wird. Heilsame Prozesse werden im Kontext von therapeutischen Gesprächen, Gebeten oder Mantras beleuchtet.
Welche linguistischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die pragmatische, lexikalische und expressive Dimension von Sprache im Rahmen der GFK. Es wird eine linguistische Analyse der vier Schritte der GFK vorgenommen und der Einfluss der Sprache auf die Weltanschauung untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gewaltfreie Kommunikation (GFK), Marshall B. Rosenberg, heilsame Sprache, linguistische Analyse, Pragmatik, Lexik, Sprachgebrauch, soziale Kontexte, Dialog, Kommunikation, Weltanschauung, Frieden.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, sowie eine Liste der Schlüsselwörter.
- Quote paper
- Friederike Appel (Author), 2015, Die Methode der Gewaltfreien Kommunikation nach M.B. Rosenberg aus linguistischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386104