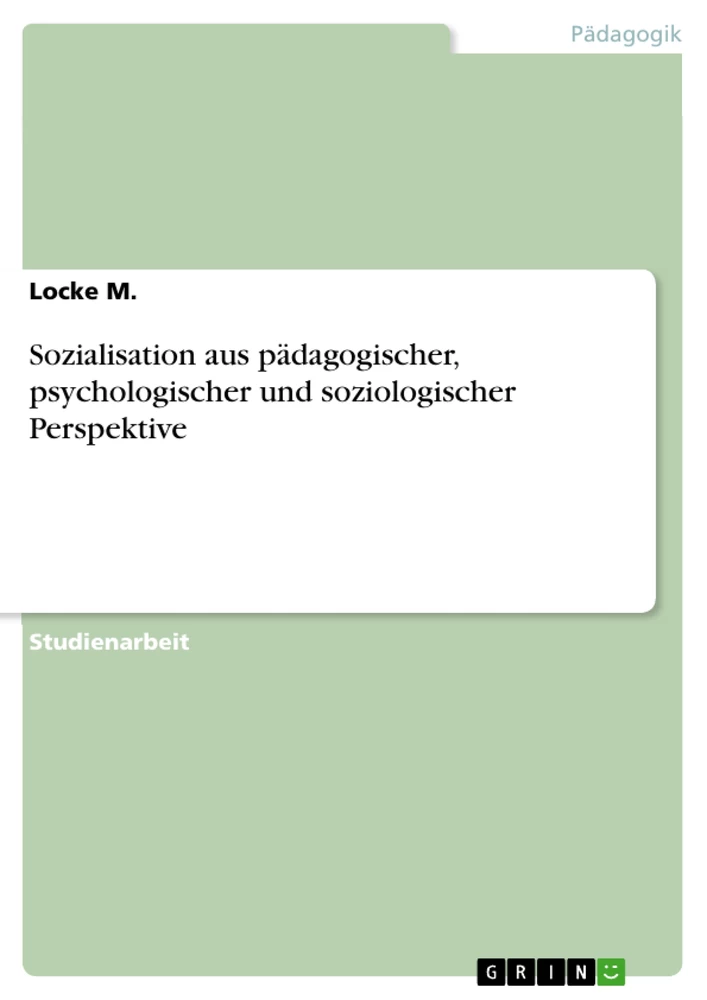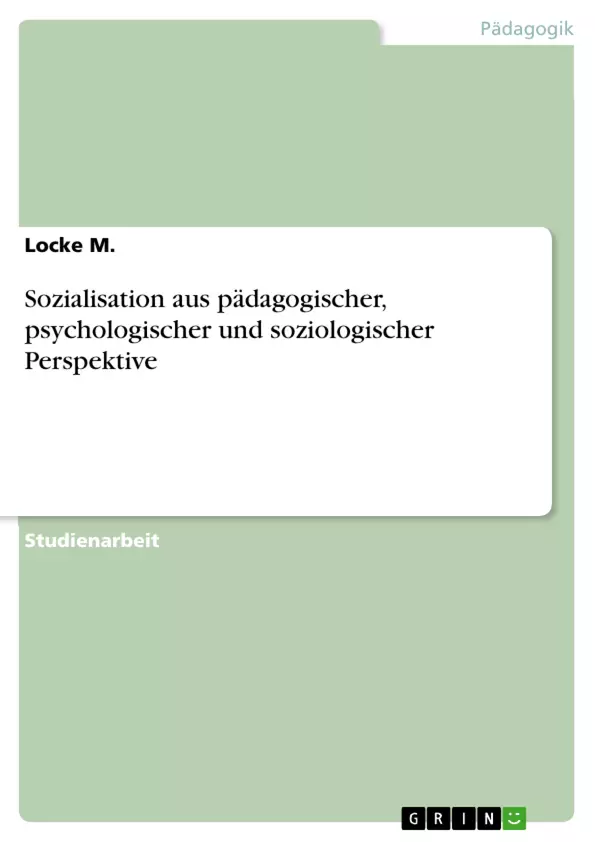In dieser Hausarbeit wird der Begriff der Sozialisation vorgestellt. Es soll aber nur einen kleinen Einblick in das große Feld der Sozialisation geben. Die Sozialisation wird je nach Wissenschaft mehr oder weniger anders umfasst. Die Sozialisation und die Bildung sind zwei grundlegende Konzepte der Erziehungswissenschaft. Sozialisation ist ein lebenslanger Lernprozess eines Menschen, deren Entwicklung durch seine Umgebung, also Freunde, Bekannte, Kultur und Gesellschaft beeinflusst wird. Da es viele Sozialisationstheorien gibt, wird es auf drei Perspektive eingegrenzt.
In dieser Hausarbeit wird der Begriff Sozialisation aus drei verschiedenen Perspektiven betrachtet, nämlich die pädagogische-, die psychologische- und die soziologische Perspektive und die Perspektiven gegenübergestellt. Wichtige Werkzeuge dieser Hausarbeit stellen die Lexika der Pädagogik, Psychologie und der Soziologie dar. Binnen dieser Hausarbeit werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser verschiedenen Perspektiven beschrieben und dargestellt. Das Ziel dabei ist, am Ende eine individuelle Definition des Begriffes der Sozialisation zu formulieren. Diese Hausarbeit soll nur einen Einblick auf die Sozialisation geben, da alle Theorien vorzustellen zu viel für diese Hausarbeit wären, daher kann diese Hausarbeit auch nur einen Teilgebiet des Begriffes Sozialisation umfassen. Infolgedessen kann die individuelle Definition keine allumfassende Definition des Begriffes sein. Bis heute gibt es keine allgemeine Theorie der Sozialisation, obwohl es auch Versuche gibt, umfangreiche Modelle zu erstellen, beispielsweise das Modell der „produktiven Realitätsverarbeitung“ nach Klaus Hurrelmann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Definitionen von Sozialisation
- Pädagogische Perspektive des Sozialisationsbegriffes
- Psychologische Perspektive des Sozialisationsbegriffes
- Soziologische Perspektive des Sozialisationsbegriffes
- Vergleichende Analyse der drei vorgestellten Perspektiven
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- Gewichtung
- Diskussion und eigene Definition
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Begriff der Sozialisation und bietet einen Einblick in die verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven auf dieses Thema. Die Arbeit konzentriert sich auf die pädagogische, psychologische und soziologische Sichtweise auf Sozialisation und vergleicht diese Perspektiven miteinander.
- Definition des Begriffs "Sozialisation" aus unterschiedlichen Perspektiven
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Perspektiven auf Sozialisation
- Die Rolle von Lebensaufgaben und Umwelteinflüssen in der Sozialisation
- Identitätsbildung und die Entwicklung der Persönlichkeit
- Wichtige Sozialisationstheorien und ihre Relevanz für die Erziehungswissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung erläutert die Zielsetzung der Hausarbeit und stellt den Begriff der Sozialisation als ein lebenslanges Lernkonzept vor, welches durch die Umwelt des Einzelnen geprägt wird.
- Die Definitionen von Sozialisation: Dieses Kapitel untersucht den Sozialisationsbegriff aus drei Perspektiven: pädagogisch, psychologisch und soziologisch. Es beleuchtet die Definitionen von Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Émile Durkheim, sowie die Theorien von Krappmann und Erik H. Erikson.
- Vergleichende Analyse der drei vorgestellten Perspektiven: Dieses Kapitel vergleicht die verschiedenen Perspektiven auf Sozialisation und hebt Gemeinsamkeiten und Unterschiede hervor. Es analysiert die Gewichtung verschiedener Aspekte in den verschiedenen Perspektiven.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Sozialisation, Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Persönlichkeitsentwicklung, Identitätsbildung, Lebensaufgaben, Umwelteinflüsse, Theorien der Sozialisation, produktive Realitätsverarbeitung, Rollenkonzept, Interaktionismus, psychoanalytische Theorie, Entwicklungsphasen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man allgemein unter Sozialisation?
Sozialisation ist ein lebenslanger Lernprozess, bei dem sich ein Mensch in Auseinandersetzung mit seiner Umwelt (Kultur, Gesellschaft, Freunde) entwickelt.
Wie unterscheidet sich die pädagogische von der soziologischen Perspektive?
Die Pädagogik fokussiert auf Bildung und Erziehung, während die Soziologie die Eingliederung des Individuums in gesellschaftliche Strukturen und Rollen betont.
Was ist der Kern der psychologischen Sicht auf Sozialisation?
Die Psychologie betrachtet vor allem die innerpsychischen Prozesse, die Identitätsbildung und die Entwicklung der Persönlichkeit durch Interaktion.
Wer ist Klaus Hurrelmann und was ist sein Modell?
Hurrelmann ist ein bekannter Sozialisationsforscher; sein Modell der „produktiven Realitätsverarbeitung“ beschreibt den Menschen als aktiven Gestalter seiner Entwicklung.
Welche Rolle spielt die Identitätsbildung in diesem Prozess?
Identitätsbildung ist das Resultat der Sozialisation, bei der das Individuum lernt, persönliche Bedürfnisse mit gesellschaftlichen Erwartungen in Einklang zu bringen.
Gibt es eine allumfassende Definition von Sozialisation?
Nein, da jede Wissenschaft eigene Schwerpunkte setzt, gibt es keine allgemeingültige Theorie, sondern verschiedene Erklärungsmodelle.
- Arbeit zitieren
- Locke M. (Autor:in), 2014, Sozialisation aus pädagogischer, psychologischer und soziologischer Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386108