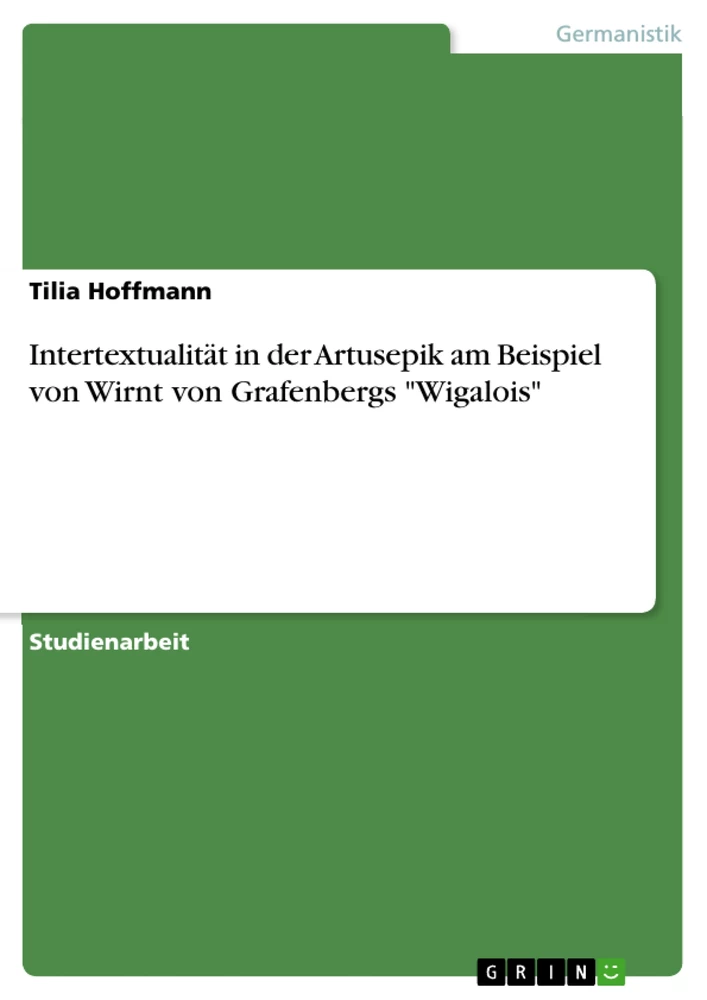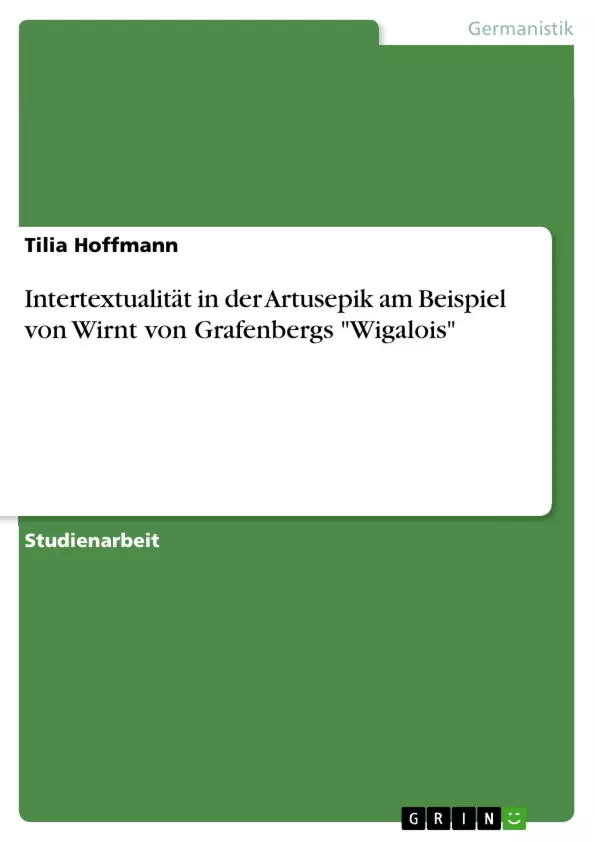Zwar gab es in der Zeit der mittelhochdeutschen Literatur keine klaren Gattungsunterscheidungen, jedoch war durchaus schon ein gewisses 'Gattungsbewusstsein' der Menschen vorhanden, durch welches die spezifischen Merkmale der einzelnen Formen von Literatur wahrgenommen und unterschieden wurden. Heute ist die Aufteilung in drei Hauptgattungen grundlegend, zu denen die Heldendichtung, der Minnesang und der höfische Roman zählen.
Der höfische Roman findet seinen Ursprung in Frankreich im zwölften Jahrhundert. Da es sich dabei um eine Gattung fiktionalen Erzählens handelt, definiert er sich im Gegensatz zur Heldenepik nicht über seinen historischen Wahrheitsanspruch, sondern über die Art und Weise, wie er das Erzählte aufbaut und welche Konstellationen er dabei hervorbringt. Dargestellt wird ein Ritter, der sich auf seinem Weg verschiedenen Herausforderungen stellt, diese bewältigt und somit als "ideal" gilt. Als eine spezielle Form des höfischen Romans gilt die Artusepik bzw. der Artusroman. Es handelt sich hierbei um eine erzählende Gattung des 12. bis 15. Jahrhunderts, die den sagenumwobenen britischen König Artus und seine Tafelrunde thematisiert und somit zumindest zum Teil historischen Anspruch besitzt.
Im Mittelpunkt der Erzählung steht nicht der ideale, vorbildhafte Herrscher selbst – Artus fungiert eher als eine passive Figur im Hintergrund – sondern ein einzelner Unbekannter, der eine zweifache Aventiuren- Reihe zu durchlaufen und bestehen hat, um schließlich selbst in die höfische Gesellschaft integriert und als vorbildhafter Ritter anerkannt zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die Artusepik als Gattung mittelhochdeutscher Literatur
- 1.1. Zum Begriff der, Intertextualität und seiner Funktion im Artusroman
- 1.1.1. Forschungsgrundlage
- 1.1.2. Begründung der Vorgehensweise
- 1.1. Zum Begriff der, Intertextualität und seiner Funktion im Artusroman
- 2. Hauptteil: Intertextuelle Verfahren im, Wigalois'
- 2.1. Die Erzählerkommentare
- 2.2. Die Wiederverwendung von Figuren
- 2.2.1. Bekannte Frauengestalten
- 2.2.2. Keie
- 2.2.3. Gawein
- 3. Schluss: Das Verhältnis des,Wigalois' zu den klassischen Artusromanen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Bedeutung von Intertextualität in der mittelhochdeutschen Artusepik, am Beispiel von Wirnt von Grafenbergs Wigalois. Das Ziel ist es, die Funktion intertextueller Verfahren im Roman aufzuzeigen und zu untersuchen, wie sie zur Gestaltung der Erzählung und zur Vermittlung von Sinn beitragen.
- Gattungsmerkmale der Artusepik
- Der Begriff der Intertextualität und seine Rolle im Artusroman
- Intertextuelle Verfahren im Wigalois, insbesondere die Erzählerkommentare und die Wiederverwendung bekannter Figuren
- Das Verhältnis des Wigalois zu den klassischen Artusromanen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Artusepik als Gattung mittelhochdeutscher Literatur
Dieses Kapitel stellt die Artusepik als Gattung der mittelhochdeutschen Literatur vor und erläutert ihre Entstehung und Entwicklung. Es werden die charakteristischen Merkmale des höfischen Romans und der Artusepik hervorgehoben, sowie die typischen Elemente des Artusromans, wie z.B. die Rolle von Artus, die zweifache Aventiuren-Reihe des Helden und die Bedeutung des Artushofs.
2. Hauptteil: Intertextuelle Verfahren im, Wigalois'
Dieses Kapitel untersucht die intertextuellen Verfahren, die Wirnt von Grafenberg in seinem Wigalois verwendet. Die Analyse konzentriert sich auf die Erzählerkommentare, die eine wichtige Rolle bei der Vermittlung der Didaxe spielen, und die Wiederverwendung von Figuren aus anderen Artusromanen. Dabei werden verschiedene Beispiele für die Einbindung von Figuren wie Keie und Gawein in den narrativen Kontext des Wigalois betrachtet.
Schlüsselwörter
Artusepik, Intertextualität, Artusroman, Wirnt von Grafenberg, Wigalois, Erzählerkommentare, Figuren, Keie, Gawein, Gattungstradition, Didaxe
Häufig gestellte Fragen
Was wird am Beispiel von Wirnt von Grafenbergs „Wigalois“ untersucht?
Die Arbeit untersucht die Funktion intertextueller Verfahren und wie diese zur Gestaltung der Erzählung und Sinnvermittlung in der Artusepik beitragen.
Wie unterscheidet sich der höfische Roman von der Heldenepik?
Er definiert sich als fiktionales Erzählen ohne historischen Wahrheitsanspruch und konzentriert sich auf den Weg eines idealen Ritters durch verschiedene Herausforderungen.
Welche Rolle spielt König Artus in diesen Romanen?
Artus fungiert meist als passive Figur im Hintergrund; im Mittelpunkt steht ein unbekannter Held, der sich durch Aventiuren in die Tafelrunde integrieren muss.
Welche intertextuellen Verfahren werden im Text analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf Erzählerkommentare und die Wiederverwendung bekannter Figuren wie Keie und Gawein aus anderen Artusromanen.
Was ist die Funktion der Erzählerkommentare?
Sie dienen im „Wigalois“ vor allem der Vermittlung der Didaxe (Lehre) und steuern die Wahrnehmung des Lesers.
- Quote paper
- Tilia Hoffmann (Author), 2008, Intertextualität in der Artusepik am Beispiel von Wirnt von Grafenbergs "Wigalois", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386199