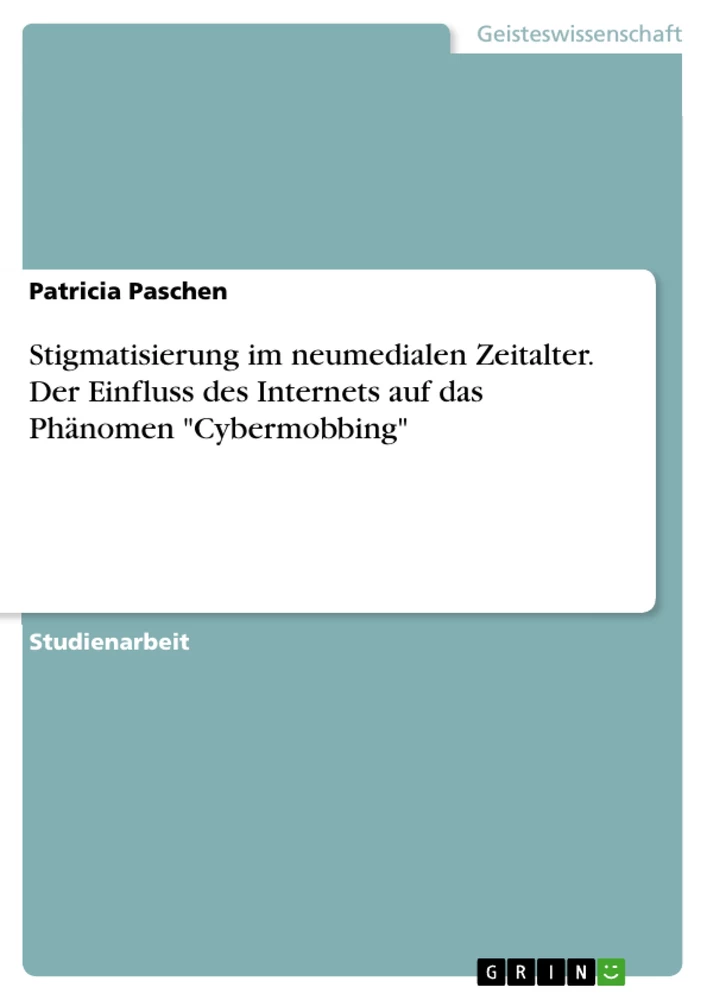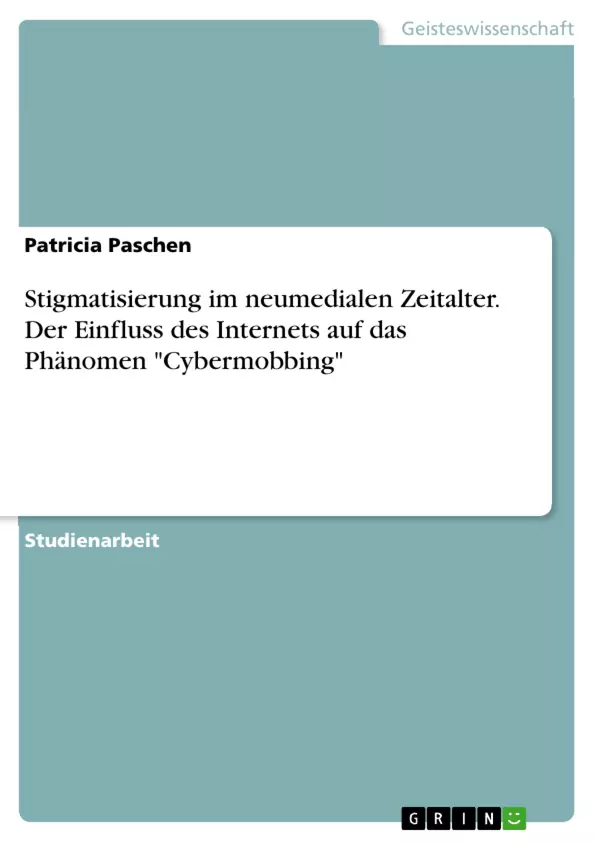Der Forschungsstand bezüglich der Thematik des Cybermobbings ist in den letzten Jahren nahezu exponentiell angestiegen. In der wissenschaftlichen Literatur wird überwiegend die Ansicht vertreten, dass das Phänomen "Cybermobbing" eine Unterart oder Variante des traditionellen, beispielsweise in der Schule stattfindenden, Mobbings darstellt, da die beiden Phänomene nicht unwesentlich übereinstimmende Eigenschaften aufweisen; die Unterschiede der beiden Phänomene sind jedoch nicht zu vernachlässigen. Langzeitstudien zu der Thematik stehen noch aus; was jedoch in bisherigen Studien herausgefunden wurde, ist, dass Cybermobbing verhältnismäßig seltener als traditionelles Mobbing vorkommt, sich die beiden Phänomene in ihrem Ausmaß häufig überschneiden und dass der Ursprung für Cybermobbing auch oft in der Schule zu finden ist.
In dieser Arbeit wird untersucht, inwiefern das Internet Stigmatisierungsprozesse besonders im Hinblick auf das Phänomen "Cybermobbing" in sozialen Netzwerken beeinflusst. Es wird anhand mehrerer anschaulicher Fallbeispiele herausgearbeitet, wie sich Stigmatisierungsprozesse nach Goffman im neumedialen Zeitalter vollziehen und welche Auswirkungen mit ebendiesen für die betroffenen Individuen einhergehen.
Zu Anfang werden einige Begrifflichkeiten geklärt, um deren Einordnung klar darzulegen. Daraufhin folgt eine Ausführung der Grundthesen der Stigmatheorie Erving Goffmans, welche die theoretische Grundlage dieser Arbeit darstellt. Im Anschluss werden die Fallbeispiele präsentiert, auf die anschließend Goffmans Theorie angewandt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitionen
- 2.1 „Cybermobbing“
- 2.2 „Soziales Netzwerk“
- 2.3 „Computervermittelte Kommunikation“
- 3. Goffmans Stigmatheorie
- 4. Fallbeispiele
- 5. Cybermobbing in der Stigmatheorie
- 6. Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Internets auf Stigmatisierungsprozesse, insbesondere im Kontext von Cybermobbing. Dabei wird Goffmans Stigmatheorie als theoretischer Rahmen genutzt, um die Auswirkungen von Cybermobbing auf Individuen im neumedialen Zeitalter zu analysieren.
- Definition und Abgrenzung von Cybermobbing im Vergleich zu traditionellem Mobbing
- Die Rolle des Internets und sozialer Netzwerke in der Verbreitung und Verstärkung von Stigmatisierungsprozessen
- Anwendung der Stigmatheorie von Erving Goffman auf Fallbeispiele von Cybermobbing
- Die Auswirkungen von Cybermobbing auf die Identität und Selbstdarstellung von Betroffenen
- Schlussfolgerungen und Implikationen für den Umgang mit Cybermobbing
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Cybermobbing im Kontext der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft heraus und skizziert den Forschungsstand. Kapitel 2 definiert die zentralen Begriffe wie „Cybermobbing“, „soziales Netzwerk“ und „computervermittelte Kommunikation“. Kapitel 3 führt in die Stigmatheorie von Erving Goffman ein, die als Grundlage für die Analyse der Auswirkungen von Cybermobbing dient. In Kapitel 4 werden verschiedene Fallbeispiele von Cybermobbing präsentiert, anhand derer die Stigmatisierungsprozesse im Internet verdeutlicht werden. Kapitel 5 wendet die Stigmatheorie auf die Fallbeispiele an und analysiert die Auswirkungen von Cybermobbing auf die Identität und Selbstdarstellung der Betroffenen.
Schlüsselwörter
Cybermobbing, Stigmatisierung, Goffman, Internet, Soziale Netzwerke, Computervermittelte Kommunikation, Identität, Selbstdarstellung, Fallbeispiele
- Citation du texte
- Patricia Paschen (Auteur), 2016, Stigmatisierung im neumedialen Zeitalter. Der Einfluss des Internets auf das Phänomen "Cybermobbing", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386632