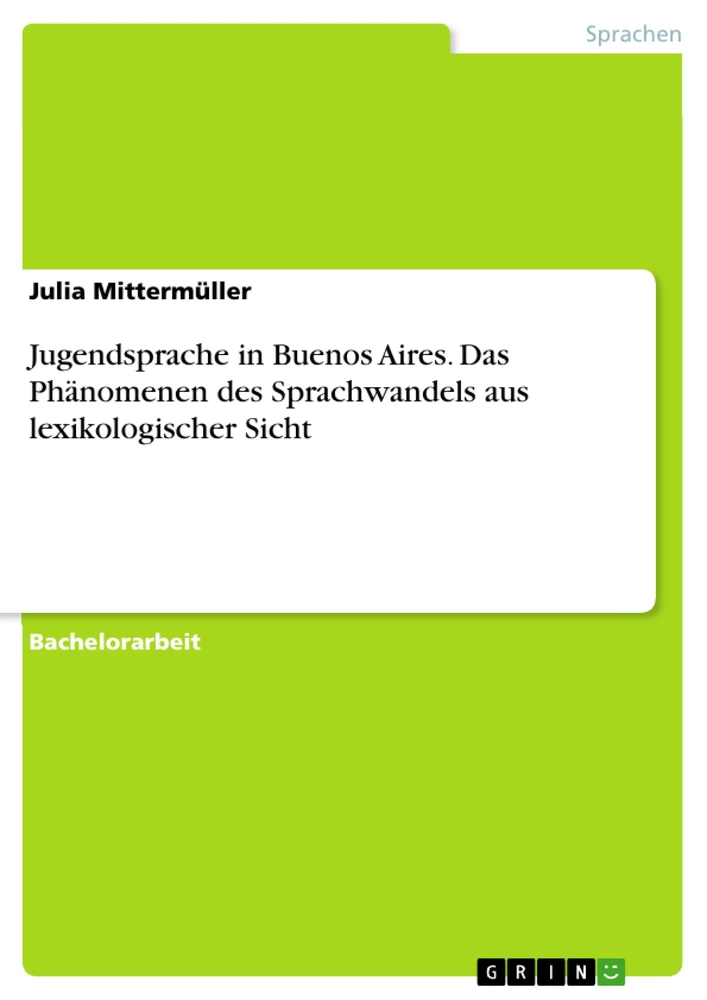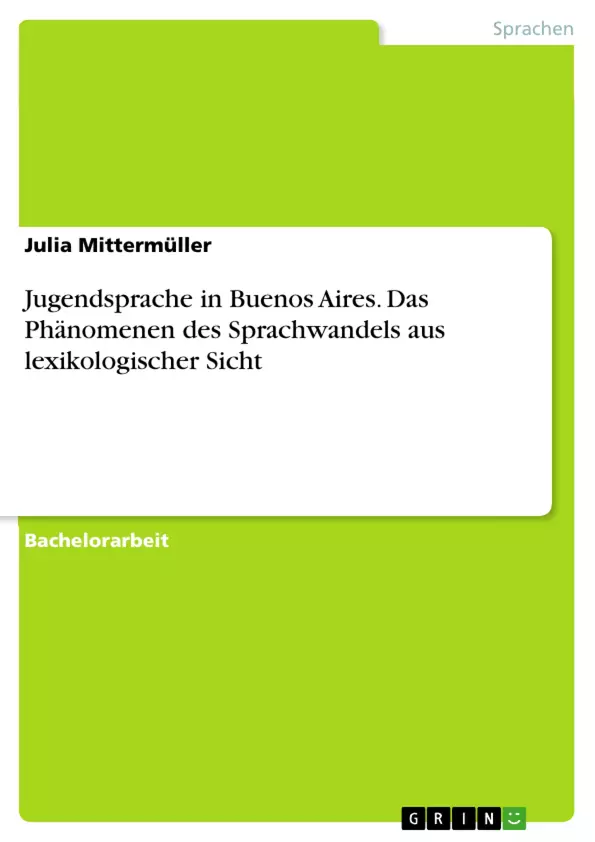Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Sprechweise Jugendlicher in Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens, auf der Grundlage einer soziolinguistischen Studie, die in den Monaten Mai bis Juli 2015 an mehreren Schulen von Buenos Aires durchgeführt wurde. Ein Großteil der mittels Fragebogen erhobenen Daten wurde bereits in einer vorangegangenen Arbeit ausgewertet. Im Mittelpunkt der Untersuchung standen dort der Zusammenhang von Jugendsprache mit der Sondersprache Lunfardo, sowie der Einfluss extralinguistischer Faktoren auf die Sprache Jugendlicher.
Diese Arbeit widmet sich nun der Untersuchung von Phänomenen des Sprachwandels – ein wichtiger und interessanter Aspekt der Jugendsprachforschung, da Jugendlichen als "grandes renovadores del lenguaje" bei der Evolution von Sprache eine Protagonistenrolle zukommt. Hierfür werden quantitative Daten, ähnlich wie in der ersten Arbeit jedoch unter einem anderen Gesichtspunkt ausgewertet und außerdem qualitatives Datenmaterial hinzugezogen. Es gibt dabei drei Foki: Sprachwandel durch Standardisierung, age-grading Muster und Wortbildung sowie die Rolle der Medien im Sprachwandelprozess.
Da Jugendsprache zu den Substandardsprachen zählt, wird in Teil I dieser Arbeit einführend auf deren Charakteristika und sozialsymbolische Funktionen eingegangen, bevor im weiteren Verlauf der Arbeit unterschiedliche Aspekte von Sprachwandel und Jugendsprache jeweils theoretisch erläutert, empirisch überprüft und abschließend interpretiert werden. Teil II widmet sich dabei dem Sprachwandel durch Standardisierung, welcher anhand quantitativer Daten im Wortschatz Jugendlicher von Buenos Aires festgemacht wird.
In Teil III werden typische Merkmale von Jugendsprache, sogenannte age-grading Muster im Lexikon der Jugendlichen untersucht. Der Fokus liegt dabei auf der Innovation der Sprecher, weshalb insbesondere Mechanismen der Neologismenbildung genauer betrachtet werden. Teil IV beschäftigt sich mit möglichen (auch globalen) Einflüssen der Mediennutzung auf den Sprachgebrauch Jugendlicher und geht insbesondere auf die Rolle der Neuen Medien bei der Verbreitung sprachlicher Innovationen ein. Abschließend sollen in Teil V herausgearbeitete Zusammenhänge zwischen Medienrealität, Jugendsprache und Sprachwandel zusammengefasst und ein Ausblick für die weitere Forschung gegeben werden. Detaillierte Datenanalysen, das Erhebungsinstrument sowie dazugehörige Erläuterungen sind im Anhang einzusehen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung
- 1. Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- 2. Substandardsprachen: Abgrenzung und Funktionen
- II. Standardisierung
- 1. Theoretischer Hintergrund
- 2. Präsentation der Studie
- 2.1 Methodik
- 2.2 Ergebnisse
- 3. Zusammenfassung und Interpretation
- III. Age-grading
- 1. Theoretischer Hintergrund
- 2. Präsentation der Studie
- 2.1 Methodik
- 2.2 Ergebnisse
- 3. Zusammenfassung und Interpretation
- IV. Rolle der Medien
- 1. Theoretischer Hintergrund
- 2. Präsentation der Studie
- 2.1 Methodik
- 2.2 Ergebnisse
- 3. Zusammenfassung und Interpretation
- V. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Jugendsprache in Buenos Aires, Argentinien, mit dem Fokus auf Phänomene des Sprachwandels. Die Studie analysiert quantitative Daten, ergänzt durch qualitative Daten, um drei zentrale Aspekte zu beleuchten: Sprachwandel durch Standardisierung, age-grading Muster und Neologismenbildung, sowie den Einfluss der Medien auf sprachliche Innovationen. Die Arbeit stützt sich auf eine vorherige Studie der Autorin (Mittermüller 2015) und erweitert diese um die Perspektive des Sprachwandels.
- Sprachwandel durch Standardisierung in der Jugendsprache von Buenos Aires
- Age-grading Muster und Neologismenbildung in der Jugendsprache
- Einfluss der Medien auf den Sprachwandelprozess in der Jugendsprache
- Soziolinguistische Funktionen von Jugendsprache als Substandardsprache
- Verbindung von Jugendsprache mit dem Lunfardo
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung: Dieses einführende Kapitel legt den Fokus der Arbeit dar: die Untersuchung der Jugendsprache in Buenos Aires unter soziolinguistischem Aspekt. Es werden die vorherige Arbeit der Autorin (Mittermüller 2015) und deren Bezug zur vorliegenden Arbeit erläutert. Das Kapitel führt in die Thematik des Sprachwandels ein, insbesondere die Rolle von Jugendlichen als Sprachinnovatoren. Es werden die drei zentralen Untersuchungsbereiche – Standardisierung, age-grading und Medieneinfluss – vorgestellt und die Einordnung der Jugendsprache als Substandardsprache erläutert. Die Bedeutung soziolinguistischer Perspektiven auf Sprache wird hervorgehoben.
II. Standardisierung: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss der Standardisierung auf die Jugendsprache von Buenos Aires. Es beginnt mit einem theoretischen Hintergrund zur Standardisierung und präsentiert dann die Ergebnisse einer empirischen Studie, die die quantitative Analyse des Wortschatzes Jugendlicher beinhaltet. Die Methodik der Studie wird detailliert beschrieben und die Ergebnisse im Hinblick auf den Grad der Standardisierung in der Jugendsprache interpretiert. Die Interpretation verbindet die quantitativen Daten mit theoretischen Überlegungen zur Sprachvariation und Sprachwandel.
III. Age-grading: In diesem Kapitel werden sogenannte age-grading Muster in der Jugendsprache von Buenos Aires untersucht. Der Fokus liegt auf der Innovation der Jugendlichen, insbesondere auf der Neologismenbildung. Es wird ein theoretischer Hintergrund zu age-grading und Sprachwandel präsentiert, gefolgt von der Darstellung der Methodik und der Ergebnisse einer empirischen Studie. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die kreativen Prozesse der Wortbildung interpretiert, wobei auch die Verbindungen zu anderen Sprachvarietäten und dem soziokulturellen Kontext analysiert werden.
IV. Rolle der Medien: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einfluss der Medien auf den Sprachgebrauch Jugendlicher in Buenos Aires. Es wird ein theoretischer Rahmen zum Einfluss der Medien auf den Sprachwandel geschaffen. Anschließend werden die Methodik und die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert, welche die Rolle der neuen Medien bei der Verbreitung von sprachlichen Innovationen analysiert. Die Interpretation der Ergebnisse beleuchtet den Zusammenhang zwischen Mediennutzung und der Dynamik des Sprachwandels in der Jugendsprache.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Buenos Aires, Argentinien, Sprachwandel, Standardisierung, Age-grading, Neologismen, Medien, Soziolinguistik, Substandardsprache, Lunfardo, Quantitative Datenanalyse, Qualitative Datenanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Jugendsprache in Buenos Aires
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Studie untersucht die Jugendsprache in Buenos Aires, Argentinien, und konzentriert sich auf Phänomene des Sprachwandels. Sie analysiert quantitative und qualitative Daten, um drei zentrale Aspekte zu beleuchten: Sprachwandel durch Standardisierung, Age-grading-Muster und Neologismenbildung sowie den Einfluss der Medien auf sprachliche Innovationen. Die Arbeit baut auf einer vorherigen Studie der Autorin auf und erweitert diese um die Perspektive des Sprachwandels.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Studie behandelt folgende Schwerpunkte: Sprachwandel durch Standardisierung in der Jugendsprache von Buenos Aires; Age-grading-Muster und Neologismenbildung; Einfluss der Medien auf den Sprachwandelprozess; soziolinguistische Funktionen von Jugendsprache als Substandardsprache; und die Verbindung von Jugendsprache mit dem Lunfardo.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Studie verwendet eine Kombination aus quantitativer und qualitativer Datenanalyse. Die Methodik wird in den einzelnen Kapiteln detailliert beschrieben, wobei die quantitative Analyse des Wortschatzes Jugendlicher im Kapitel zur Standardisierung im Vordergrund steht. Die qualitative Analyse unterstützt die Interpretation der quantitativen Daten und beleuchtet den soziokulturellen Kontext.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: I. Einführung (Gegenstand, Zielsetzung, Abgrenzung von Substandardsprachen); II. Standardisierung (theoretischer Hintergrund, empirische Studie mit Methodik und Ergebnissen); III. Age-grading (theoretischer Hintergrund, empirische Studie mit Methodik und Ergebnissen); IV. Rolle der Medien (theoretischer Hintergrund, empirische Studie mit Methodik und Ergebnissen); und V. Fazit und Ausblick.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Studie?
Die konkreten Ergebnisse der Studie sind in den Kapiteln II, III und IV detailliert dargestellt. Sie befassen sich mit dem Grad der Standardisierung in der Jugendsprache, den Age-grading-Mustern und der Neologismenbildung sowie dem Einfluss der Medien auf sprachliche Innovationen. Die Interpretation der Ergebnisse verbindet quantitative Daten mit theoretischen Überlegungen zur Sprachvariation und zum Sprachwandel und analysiert die Verbindungen zu anderen Sprachvarietäten und dem soziokulturellen Kontext.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Jugendsprache, Buenos Aires, Argentinien, Sprachwandel, Standardisierung, Age-grading, Neologismen, Medien, Soziolinguistik, Substandardsprache, Lunfardo, Quantitative Datenanalyse, Qualitative Datenanalyse.
Wie wird die Jugendsprache in dieser Studie eingeordnet?
Die Jugendsprache wird als Substandardsprache betrachtet und ihre soziolinguistischen Funktionen werden untersucht. Die Studie analysiert den Einfluss von Standardisierung, Age-grading und Medien auf diese Substandardsprache und deren Entwicklung.
Welche Rolle spielt der Lunfardo in der Studie?
Die Studie untersucht die Verbindung zwischen der Jugendsprache und dem Lunfardo, einer argentinischen Argotsprache, und analysiert den Einfluss dieser Verbindung auf den Sprachwandelprozess.
Auf welcher vorherigen Arbeit basiert diese Studie?
Die Studie baut auf einer vorherigen Arbeit der Autorin (Mittermüller 2015) auf und erweitert diese um die Perspektive des Sprachwandels.
- Quote paper
- Julia Mittermüller (Author), 2016, Jugendsprache in Buenos Aires. Das Phänomenen des Sprachwandels aus lexikologischer Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386636