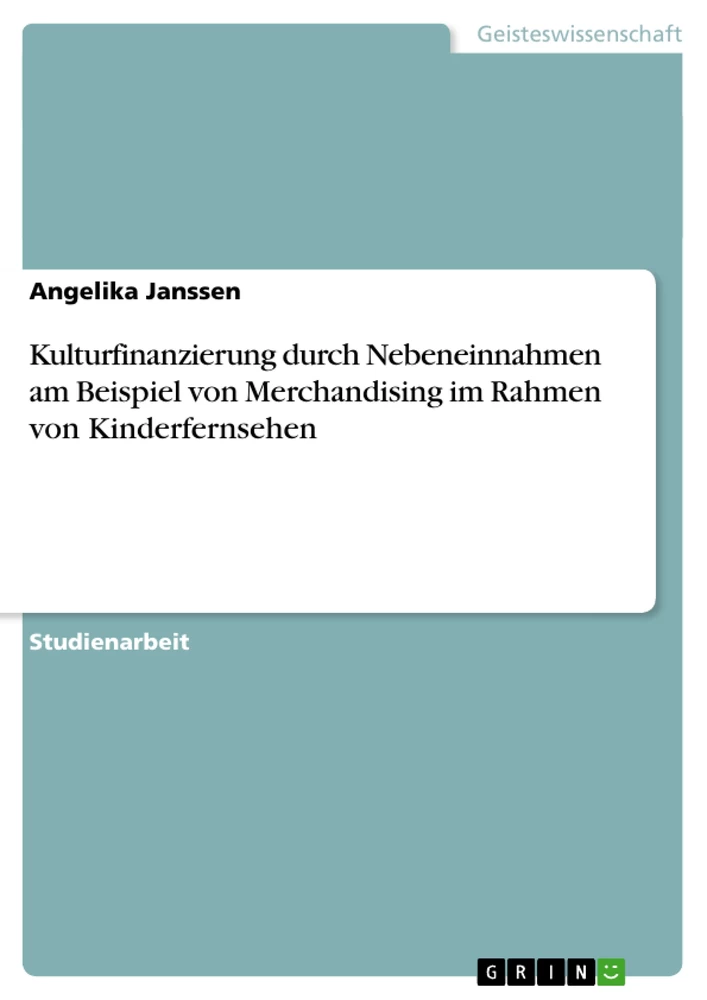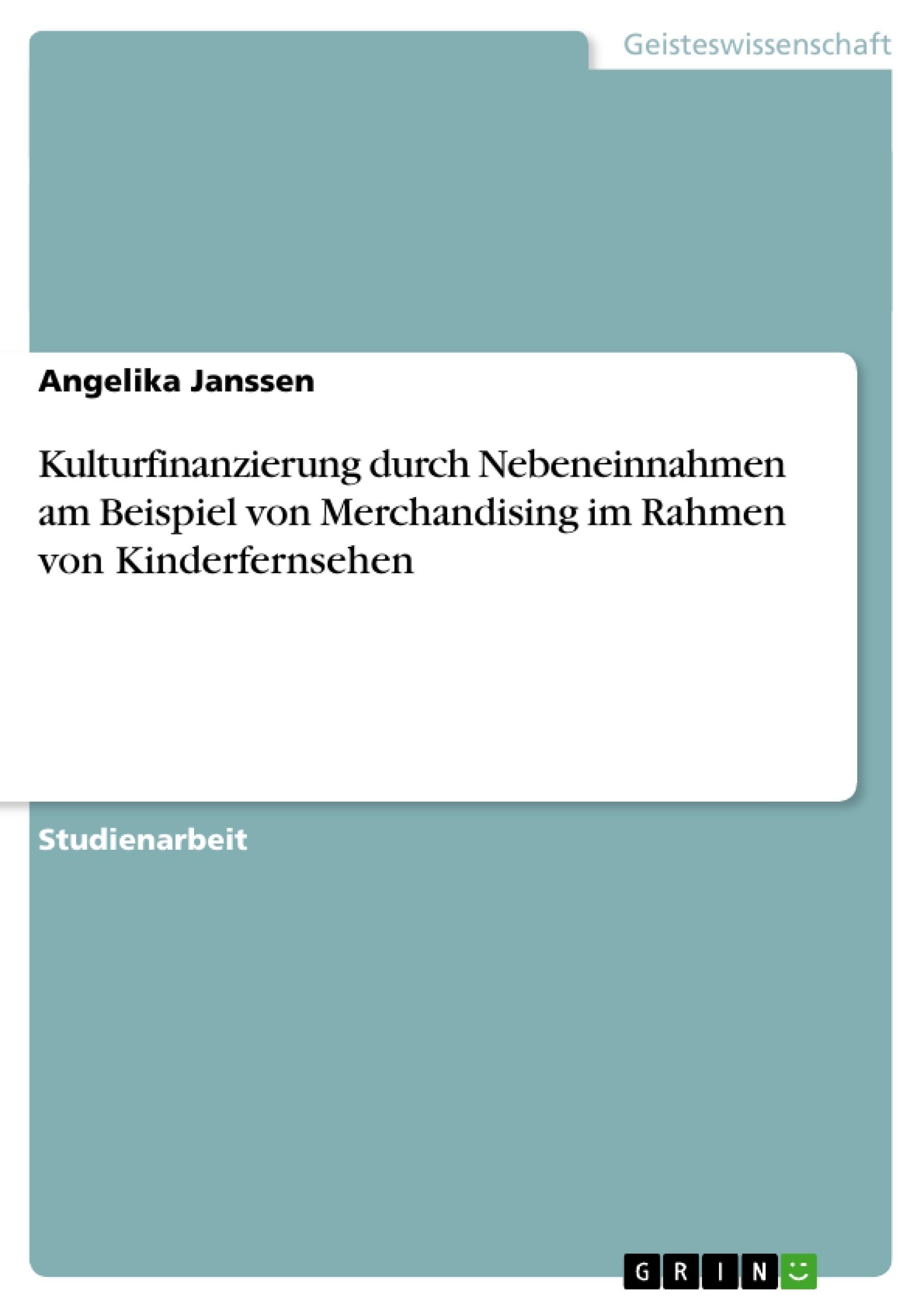Merchandising findet mittlerweile in so vielen kulturellen Bereichen statt, dass man vielfach bereits vom Produktverbund sprechen kann: Fiktive Figuren oder Embleme erscheinen in unterschiedlichen Medien (z.B. Pumuckl: im Fernsehen, im Buch, als Held eines Comic-Hefts, auf der Hörspiel-Cassette, auf Video oder DVD), aber auch auf medienfremden Artikeln wie Tassen, Radiergummies oder Bettwäsche. Private Radiosender machen ein Zusatzgeschäft durch den Verkauf von CDs (mit Musik, aber auch mit beliebten Blödel-Moderatoren), Maskottchen und ähnlichem. Und auch in staatlichen Museen wurden die Zeichen der Zeit erkannt, so dass der interessierte Besucher in den zugehörigen Museumsshops "Kunst-Souvenirs" erwerben kann. Der Ursprung und das Vorbild für die Lizenzgeschäfte aller Sparten (auch die nicht kulturellen, z.B. Fan-Artikel im Sportsektor) liegen in den USA, und zwar im Fernsehgeschäft. Während auch andere kulturelle Sparten interessante Untersuchungsfelder zum Thema Merchandising liefern, widmet sich diese Arbeit aufgrund des gesteckten Rahmens einem Teilbereich der Alltagskultur, hier: des Fernsehens, und aufgrund der Sonderrolle innerhalb des Themenkomplexes "Fernsehen und Merchandising" dem Aspekt "Kinderfernsehen und Merchandising". Der erste bekannte Merchandising-Fall hat sich 1904 in Amerika ereignet, als die Brown Shoe Company das Recht an der Comic-Figur Buster Brown erwarb, um damit für eine internationale Messe für Kinderschuhe zu werben. Der Fall ist in mehrfacher Hinsicht klassisch: 1. Zwischen der Figur selbst und dem Artikel, mit dem sie in Verbindung gebracht wird, besteht kein unmittelbarer Zusammenhang. 2. Die Figur stammt aus einem Comic, es ist eine fiktive Figur mit positiven Eigenschaften.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklung des Merchandising
- Vier Phasen
- Aktueller Trend: Internationalisierung des Marktes
- Ein Beispiel aus dem deutschen Fernsehen: RTL
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Entwicklung und Bedeutung von Merchandising im Kinderfernsehen. Dabei werden die historischen Wurzeln und der aktuelle Trend der Internationalisierung des Merchandising-Marktes beleuchtet. Besonderer Fokus liegt auf der Untersuchung der Rolle des Merchandisings im Kontext der Alltagskultur und im Verhältnis zur Programm-Konzeption.
- Historische Entwicklung des Merchandisings im Kinderfernsehen
- Die Kommerzialisierung des Kinderfernsehens und die Reaktion darauf
- Die Rolle des Merchandisings in der Programm-Konzeption
- Beispiele aus dem deutschen Fernsehen
- Der Einfluss des Merchandisings auf die Alltagskultur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Themas Merchandising und Kinderfernsehen dar und erklärt die Relevanz des Themas. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis zwischen Merchandising und Alltagskultur, insbesondere im Bereich des Kinderfernsehens.
- Historische Entwicklung des Merchandisings: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Merchandisings in vier Phasen, beginnend mit der Frühphase bis zu den 1960er Jahren, gefolgt von der Kommerzialisierung in den 1960er und 1970er Jahren, der Deregulierung in den 1980er Jahren und schließlich den Grenzen des Merchandisings in den 1990er Jahren. Es werden wichtige Meilensteine und Einflussfaktoren der Entwicklung dargestellt.
- Aktueller Trend: Internationalisierung des Marktes: Dieses Kapitel widmet sich der Internationalisierung des Merchandising-Marktes. Es untersucht die globalen Trends und Entwicklungen, die den Erfolg von Merchandising-Artikeln beeinflussen.
- Ein Beispiel aus dem deutschen Fernsehen: RTL: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Merchandisings im deutschen Fernsehen am Beispiel des Senders RTL. Es beleuchtet die Strategien und Praktiken, die RTL im Bereich Merchandising einsetzt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Merchandising, Kinderfernsehen, Kommerzialisierung, Alltagskultur, Programm-Konzeption und Internationalisierung. Sie analysiert die Verbindung zwischen fiktiven Figuren, Medienprodukten und Konsumgütern sowie die Auswirkungen von Merchandising auf die Kultur und das Medienverhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Merchandising im Kontext von Kinderfernsehen?
Merchandising bezeichnet die Vermarktung von fiktiven Figuren oder Emblemen aus TV-Sendungen auf medienfremden Artikeln wie Tassen, Bettwäsche oder Spielzeug.
Wann entstand der erste bekannte Merchandising-Fall?
Der erste Fall ereignete sich 1904 in den USA, als die Brown Shoe Company die Rechte an der Comic-Figur Buster Brown für Schuhwerbung erwarb.
Welche Rolle spielt Merchandising für die Kulturfinanzierung?
Es dient als wichtige Nebeneinnahmequelle, um teure TV-Produktionen zu finanzieren oder Museumsshops und Radiosender wirtschaftlich zu unterstützen.
Wie beeinflusst Merchandising die Programm-Konzeption?
Oft werden Sendungen bereits so konzipiert, dass die Figuren "merchandising-tauglich" sind, was Kritiker als zunehmende Kommerzialisierung des Kinderfernsehens sehen.
Was versteht man unter einem Produktverbund?
Ein Produktverbund liegt vor, wenn eine Figur gleichzeitig in verschiedenen Medien (Buch, TV, DVD) und als physisches Produkt (Maskottchen, Kleidung) präsent ist.
- Arbeit zitieren
- Angelika Janssen (Autor:in), 1998, Kulturfinanzierung durch Nebeneinnahmen am Beispiel von Merchandising im Rahmen von Kinderfernsehen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38683