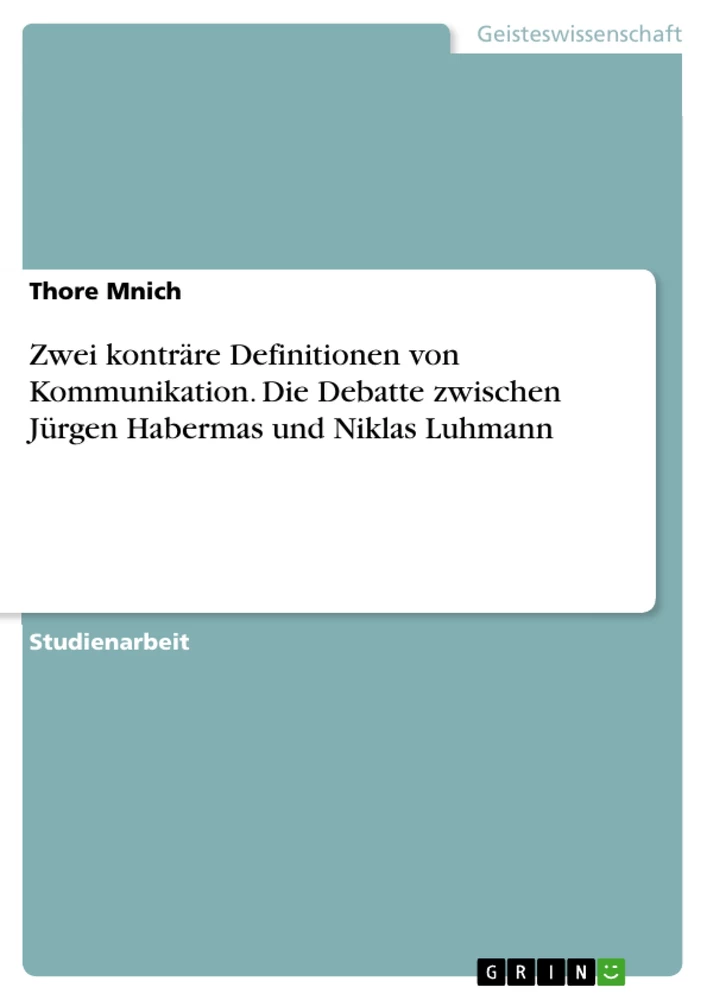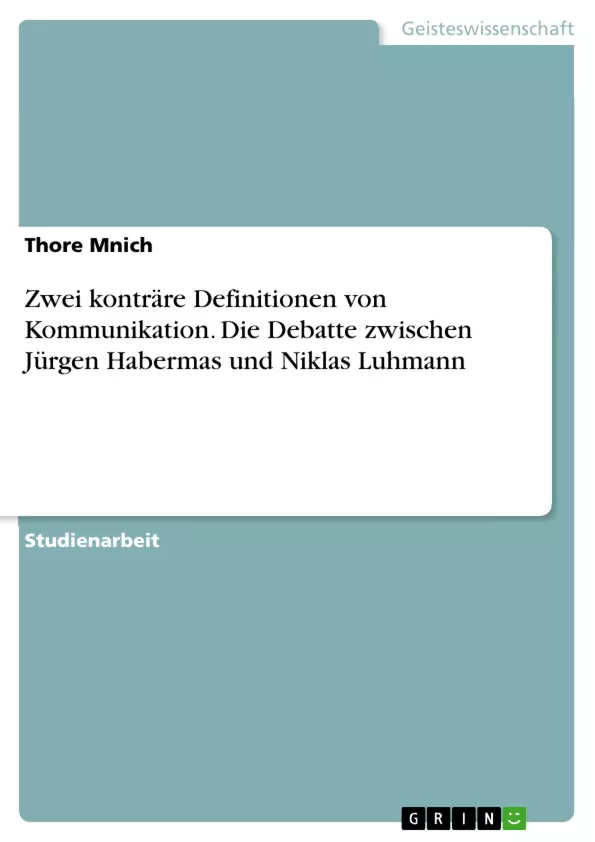Der durch die Arbeiten von Habermas und Luhmann entstandene Paradigmenwechsel in der Soziologie und die Tatsache, dass die Ansätze grundverschiedenen Auffassungen folgen, macht es besonders interessant, das kommunikative Handeln von Habermas mit Luhmanns Systemtheorie zu vergleichen, die Unterschiede aufzuzeigen und Gemeinsamkeiten zu finden. Deshalb soll die Zielsetzung dieser Arbeit das Herausarbeiten der konträren Ansichten sein, um diese zu vergleichen und Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zu beleuchten.
Mit dem klassischen Sender-Nachricht-Kanal-Empfänger Model beginnen Claude Shannon und Warren Weaver in den 40er Jahren die Kommunikation fassbar zu machen, um die Kommunikation im nachrichtentechnischen Sinne zu optimieren. Diese aus praktischen Beweggründen entstandene theoretische Feststellung bildet das klassische Model von Kommunikation.
Aus dem Urvater der Kommunikationsdefinition haben sich verschiedenste Formen, Definitionen und theoretische Auffassungen von Kommunikation entwickelt. Auch die neueren wissenschaftlichen Beiträge die von Rogers, Schulz von Thun und Watzlawick in die Debatte eingebracht wurden sind oft zitierte Definitionen der Kommunikationswissenschaft. Die Soziologie entwickelt sich im Verlauf der Zeit und maßgeblich auch durch die Arbeiten von George Herbert Mead, weg von einer reinen Handlungswissenschaft. Jürgen Habermas und Niklas Luhmann schafften mit ihren Arbeiten in den 70er Jahren den Einzug der Kommunikationsbegriffe in die soziologische Theoriebildung allerdings tragen sie auch zu einer weiteren Pluralisierung der Soziologie und der Krise der westlichen Soziologie bei, die Alvin Gouldner in seinem 1910 erschinenen Werk „The Coming Crisis of Western Sociology“ ankündigt. Habermas und Luhmanns theoretischen Ansätze verfolgen konträre Auffassungen und Positionen und führen die Debatte um die Kommunikationsforschung an. Aus diesem Grund werden beide Ansätze besonders in Deutschland heftig diskutiert. Luhmann und Habermas haben sich deshalb ebenfalls in eine Debatte begeben und in der „Frankfurt-Bielefeld-Kontroverse“ ihre Positionen und Ansätze ins Rennen geführt und gegeneinander gestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jürgen Habermas
- Die vier Phasen des kommunikativen Handelns
- Geltungsansprüche und Weltbezüge in der Sprache
- Der Diskurs
- Niklas Luhmann
- Doppelte Kontingenz
- Kommunikationsbegriff nach Luhmann
- Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien
- Bildung von Systemen durch Kommunikation
- Vergleich beider Theorieansätze
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der soziologischen Kommunikationstheorie und analysiert die konträren Ansätze von Jürgen Habermas und Niklas Luhmann. Ziel ist es, die beiden Theorien im Detail darzustellen und ihre Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.
- Das Konzept des kommunikativen Handelns nach Habermas
- Luhmanns Systemtheorie und ihre Anwendung auf Kommunikation
- Die Rolle der Sprache in beiden Theorien
- Der Einfluss der beiden Ansätze auf die soziologische Theoriebildung
- Die Kontroverse zwischen Habermas und Luhmann
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das klassische Sender-Nachricht-Kanal-Empfänger Modell der Kommunikation vor und erläutert die Entwicklung des soziologischen Kommunikationsbegriffs. Die Arbeit fokussiert auf die konträren Ansätze von Habermas und Luhmann, die die Debatte um die Kommunikationsforschung maßgeblich geprägt haben.
Im zweiten Kapitel wird Habermas' Konzept des kommunikativen Handelns in seinen Grundzügen dargestellt. Dabei werden die vier Phasen des kommunikativen Handelns, die Bedeutung der Sprache und die Geltungsansprüche im Diskurs behandelt.
Kapitel drei beschäftigt sich mit Luhmanns Systemtheorie und ihrer Anwendung auf Kommunikation. Die Themenbereiche umfassen die Doppelte Kontingenz, Luhmanns Kommunikationsbegriff, symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien und die Bildung von Systemen durch Kommunikation.
Das vierte Kapitel widmet sich einem Vergleich der beiden Theorien und zeigt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Habermas' und Luhmanns Ansätzen auf.
Schlüsselwörter
Kommunikation, Soziologie, Theorie, Habermas, Luhmann, Systemtheorie, kommunikatives Handeln, Sprache, Diskurs, Doppelte Kontingenz, Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien, Gesellschaft, Handlung, Struktur, Praxis, Hintergrundwissen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Habermas und Luhmann?
Habermas sieht Kommunikation als Handlung zur Verständigung (normativ), während Luhmann sie als funktionales Element zur Selbsterhaltung sozialer Systeme (autopoietisch) betrachtet.
Was bedeutet "kommunikatives Handeln" bei Habermas?
Es beschreibt eine Interaktion, bei der die Beteiligten ihre Handlungspläne über einen konsensorientierten Austausch von Argumenten koordinieren.
Was versteht Luhmann unter "Doppelter Kontingenz"?
Es beschreibt die Situation, dass Kommunikation nur zustande kommt, wenn beide Partner wissen, dass der jeweils andere auch anders handeln könnte (Unbestimmtheit).
Welche Rolle spielt die Sprache im Diskurs bei Habermas?
Die Sprache enthält Geltungsansprüche (Wahrheit, Richtigkeit, Wahrhaftigkeit), die im herrschaftsfreien Diskurs eingelöst werden müssen.
Was sind "symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien"?
Nach Luhmann sind dies Medien wie Geld, Macht oder Liebe, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Kommunikation trotz Unwahrscheinlichkeit akzeptiert wird.
- Quote paper
- Thore Mnich (Author), 2017, Zwei konträre Definitionen von Kommunikation. Die Debatte zwischen Jürgen Habermas und Niklas Luhmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386920