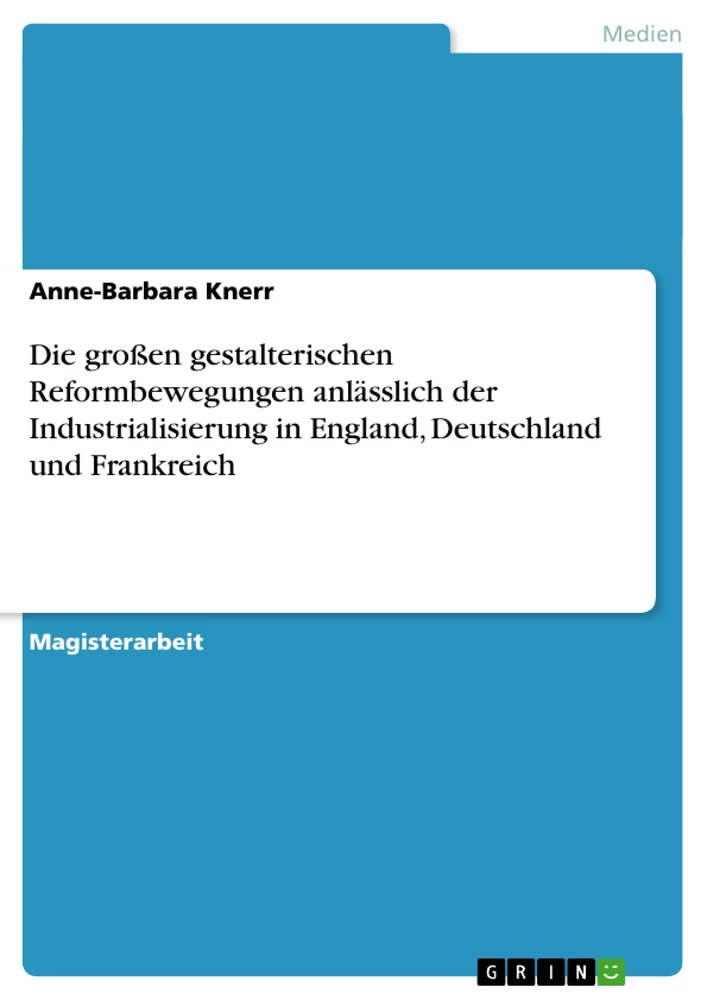[...] Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann hier natürlich nicht erhoben werden. Die Architektur wurde nur insoweitberücksichtigt, wie es unbedingt zum Verständnis der Entwicklung nötig ist. Auch das Theater kommt in dieser Arbeit eigentlich zu kurz, wie z.B. Oskar Schlemmers am Bauhaus entwickeltes Triadisches Ballett, dass 1932 auch in Paris aufgeführt wurde, oder die Aufführungen in Henry van de Veldes Werkbundtheater. Bei der Druckgrafik konnten nur wenige, für das Thema relevante, Beispiele herausgegriffen werden. Viel Wert wurde hingegen auf grundsätzliche Überlegungen der industriellen Gestaltung gelegt, die sich auf den Idar- Obersteiner Modeschmuck übertragen lassen. Diese Prinzipien wurden an zahlreichen Beispielen verdeutlicht. Schmuckbeispiele wurden so weit wie möglich berücksichtigt. Da Schmuck aber bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein konservativ ausgerichtet war, ist er nicht dazu geeignet, die ganze Entwicklung lückenlos zu dokumentieren. Die meisten Beispiele kommen deswegen aus anderen kunsthandwerklichen Bereichen. Aus bei der heute als Industriemuseum existierenden Firma Bengel vorliegenden Kundenbüchern geht hervor, dass der ausgestellte Modeschmuck hauptsächlich nach Frankreich geliefert wurde, an Boutiquen und an die großen Warenhäuser wie Printemps, aber auch an französische Kolonien in Afrika. Frankreich spielt demnach eine wichtige Rolle für die stilistische Einordnung des Bengel-Schmucks, daher die ausführliche Behandlung dieses Landes in dieser Arbeit. Die Industrialisierung hatte nicht nur enorme Auswirkungen auf unsere Arbeitswelt, sondern veränderte auch die uns umgebende Welt der Alltagsdinge. Diese Umwälzung unserer Dingwelt war hart umkämpft. Aufgrund der gestalterischen Auswüchse und Fehlschläge zu Beginn der Industrialisierung glaubten viele Menschen, dass sich mit Maschinen nichts kunsthandwerklich wertvolles herstellen ließe. Andere befürworteten die maschinelle Fertigung und meinten, dass man nur lernen müsse, richtig mit ihr umzugehen. Ein enormes Bevölkerungswachstum verlangte nach Lösungen dieser Fragen, um die so mancher Streit ausgefochten wurde. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es die ersten erfolgreichen Projekte, die bewiesen, dass industriell hergestellte Güter ästhetisch wertvoll sein können und Wege aufzeigten, wie dies zu bewerkstelligen war. Diese für unsere heutige Kultur grundlegende Entwicklung bereitete auch den Boden für den Idar-Obersteiner Modeschmuck im frühen 20. Jahrhundert.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Die "Great Exhibition" 1851 in London
- 1.2 Der Crystal Palace
- 1.3 Die Exponate
- 1.3.1 Einige Beispiele aus dem AJIC
- 2 Gottfried Semper und die „Great Exhibition“
- 2.1 Wissenschaft, Industrie und Kunst
- 2.1.1 Kapitel I-III: Nachwirkungen und Lehren der Ausstellung
- 2.1.2 Kapitel IV-VII: Die Kunsterziehung der Zukunft
- 2.1 Wissenschaft, Industrie und Kunst
- 3 Englische Institutionen des 19. Jahrhunderts zur Förderung von Kunst und Industrie
- 3.1 Die Society of Arts
- 3.2 Die Government Schools of Design
- 3.2.1 Redgraves Lehrplan und die „General Principles of Decorative Art“
- 3.2.2 Christopher Dresser
- 4 Arts and Crafts oder zurück zur Natur
- 4.1 John Ruskin: der Vordenker
- 4.1.1 Das Wesen der Gotik
- 4.2 William Morris: der Macher
- 4.2.1 Morris als Gestalter
- 4.2.2 Morris als Theoretiker
- 4.3 Höhepunkt und Ende der Bewegung
- 4.3.1 Gildengründungen
- 4.3.2 Liberty - das Ende der Utopien
- 4.1 John Ruskin: der Vordenker
- 5 Jugendstil und Industrie in Deutschland
- 5.1 Die Darmstädter Künstlerkolonie
- 5.1.1 Die Anfänge 1899-1903 und das „Dokument Deutscher Kunst“
- 5.1.2 Ausstellungen und Projekte 1904-1914
- 5.1.3 Schmuck auf der Mathildenhöhe
- 5.2 Peter Behrens
- 5.2.1 Behrens' Reform der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule
- 5.2.2 Peter Behrens und die AEG
- 5.3 Henry van de Velde
- 5.3.1 Van de Veldes Rezeption von Ruskin und Morris
- 5.3.2 Van de Veldes Gestaltungsprinzipien an ausgewählten Beispielen
- 5.4 Adolf Loos: Ornament und Verbrechen
- 5.1 Die Darmstädter Künstlerkolonie
- 6 Der Deutsche Werkbund
- 6.1 Organisation, Ziele, historischer Abriss
- 6.2 Die Werkbund-Krise von 1914
- 7 Das Bauhaus
- 7.1 Geschichtlicher Überblick
- 7.2 Schmuck und die Metallwerkstatt am Bauhaus
- 8 Frankreich zwischen den Weltkriegen
- 8.1 Art déco in Frankreich
- 8.2 Le Corbusier: Purismus und Gestaltung
- 8.2.1 Der Pavillon de L'Esprit Nouveau 1925
- 8.2.2 Die Ausrüstung der Wohnmaschine
- 8.3 Werkbund und Bauhaus in Frankreich
- 9 Schlussbemerkung: Der Bengel-Schmuck ...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich der umfassenden wissenschaftlichen Analyse des Idar-Obersteiner Modeschmucks und stellt eine Vorbereitung auf eine detaillierte wissenschaftliche Aufarbeitung dar. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Gestaltungsprinzipien der industriellen Fertigung und deren Einfluss auf die Entwicklung des Modeschmucks im 20. Jahrhundert.
- Die Entwicklung der industriellen Gestaltung von der ersten Weltausstellung in London 1851 bis in die 1930er Jahre in England, Deutschland und Frankreich.
- Die Bedeutung von Kunst und Industrie im 19. und frühen 20. Jahrhundert und die Rolle von Institutionen zur Förderung dieser Bereiche.
- Die Entstehung und Entwicklung verschiedener Reformbewegungen, wie Arts and Crafts, Jugendstil und Bauhaus, und deren Einfluss auf die industrielle Gestaltung.
- Die Rezeption von Theorien und Gestaltungsprinzipien wie Funktionalismus, Purismus und der Suche nach einer neuen Ästhetik für die industrielle Produktion.
- Die Einordnung des Idar-Obersteiner Modeschmucks in den Kontext der industriellen Gestaltung und die Analyse seiner besonderen Merkmale.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der „Great Exhibition“ 1851 in London und analysiert den Einfluss dieser Ausstellung auf die Entwicklung der industriellen Gestaltung. Im zweiten Kapitel wird die Rezeption der „Great Exhibition“ durch Gottfried Semper beleuchtet, der die Bedeutung von Wissenschaft, Industrie und Kunst in ihren Zusammenhängen beleuchtet. Das dritte Kapitel gibt Einblicke in englische Institutionen des 19. Jahrhunderts, die sich der Förderung von Kunst und Industrie widmeten, wie die Society of Arts und die Government Schools of Design. Kapitel vier analysiert die „Arts and Crafts“-Bewegung, die sich gegen die Industrialisierung wandte und eine Rückkehr zu handwerklichen Produktionsmethoden propagierte. Kapitel fünf befasst sich mit dem Jugendstil und der industriellen Gestaltung in Deutschland, beleuchtet die Darmstädter Künstlerkolonie und die Arbeit von Peter Behrens und Henry van de Velde. Kapitel sechs beleuchtet die Gründung und Ziele des Deutschen Werkbunds und dessen Bedeutung für die industrielle Gestaltung in Deutschland. Im siebten Kapitel wird das Bauhaus, eine wichtige Kunstschule des 20. Jahrhunderts, und seine Bedeutung für die Gestaltung von Schmuck und Metallprodukten vorgestellt. Das achte Kapitel befasst sich mit der französischen Kunst und Architektur zwischen den Weltkriegen, beleuchtet den Art déco und die Gestaltungsprinzipien von Le Corbusier. Schließlich wird in einem letzten Kapitel der Bengel-Schmuck aus Idar-Oberstein in den Kontext der industriellen Gestaltung eingeordnet und dessen Besonderheiten hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themenfelder industrielle Gestaltung, Modeschmuck, Kunst und Industrie, Reformbewegungen, Arts and Crafts, Jugendstil, Bauhaus, Art déco, Funktionalismus, Purismus, Idar-Oberstein, Bengel-Schmuck.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Bedeutung der "Great Exhibition" 1851?
Die erste Weltausstellung in London zeigte die Chancen und gestalterischen Probleme der industriellen Fertigung auf und löste weltweit Reformbewegungen aus.
Was forderte die "Arts and Crafts"-Bewegung?
Sie kritisierte die seelenlose Industrieproduktion und forderte eine Rückkehr zur handwerklichen Qualität und Naturverbundenheit (Vordenker: John Ruskin, William Morris).
Welche Rolle spielte der Deutsche Werkbund?
Gegründet 1907, zielte er auf die Veredelung der gewerblichen Arbeit durch das Zusammenwirken von Kunst, Industrie und Handwerk ab.
Was ist das Besondere am Bauhaus im Kontext der Gestaltung?
Das Bauhaus suchte nach einer neuen Ästhetik für die industrielle Massenproduktion und prägte den Funktionalismus ("Form follows function").
Wie ordnet sich der Idar-Obersteiner Modeschmuck hier ein?
Die Arbeit zeigt, wie die Reformbewegungen den Boden für den industriell gefertigten, aber ästhetisch anspruchsvollen Schmuck der Firma Bengel bereiteten.
Was bedeutet "Ornament und Verbrechen" bei Adolf Loos?
Es ist eine radikale Ablehnung von überflüssigem Dekor zugunsten einer sachlichen, rein funktionalen Gestaltung.
- Arbeit zitieren
- Anne-Barbara Knerr (Autor:in), 2004, Die großen gestalterischen Reformbewegungen anlässlich der Industrialisierung in England, Deutschland und Frankreich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38693