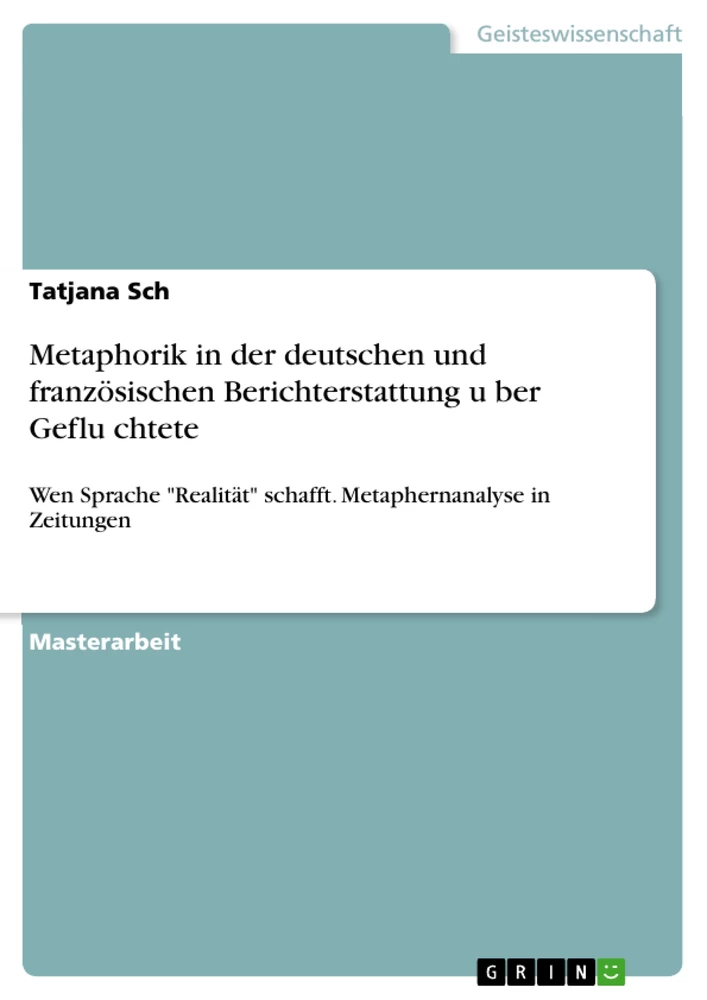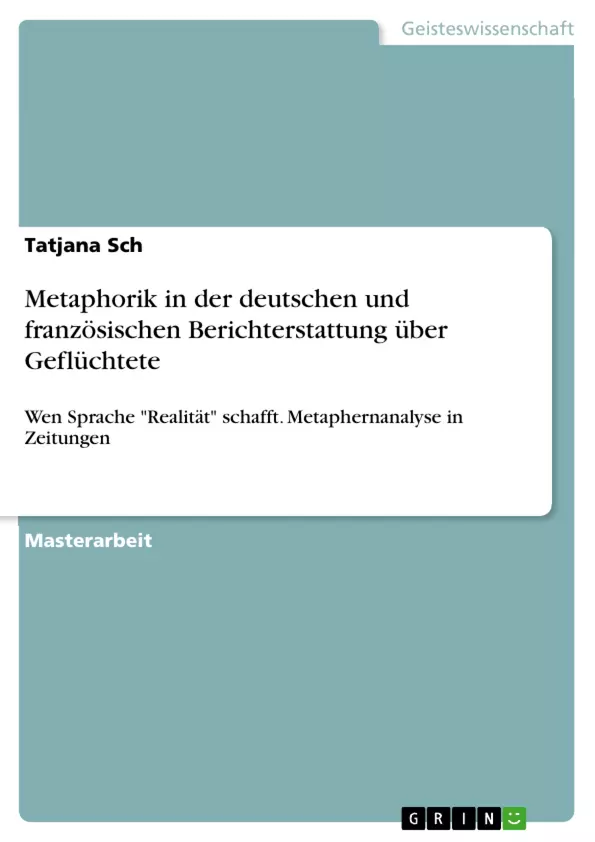In dieser Arbeit soll anhand des Korpusmaterials nicht nur das grundsätzliche Vorhandensein übergeordneter Strukturen der Bildlichkeit in der Berichterstattung von Geflüchteten in deutschen und französischen Pressetexten empirisch überprüft werden, sondern auch eine vergleichende Mikroanalyse der Strukturiertheit der Bildfelder in den untersuchten Einzelsprachen vorgenommen werden. Für diese Arbeit viel bedeutsamer als die Feststellung der bloßen Bildfeld-Konvergenz sollen deshalb Fragen sein, wie intensiv ein Bildfeld in einer Sprache genutzt wird, ob Produktivitätsunterschiede bestehen und inwiefern weitere Charakteristika in der deutschen und französischen Sprachverwendung vorliegen.
Möchte man die Metaphern im Geflüchtetendiskurs interpretieren, ist es unabdingbar, sie zunächst in den Kontext der aktuellen Flüchtlingsbewegungen zu integrieren. Aus diesem Grund wird im nächsten Kapitel (2.) zunächst der politische Hintergrund der Thematik skizziert und mit Zahlen für die EU, Deutschland und Frankreich (2.1) unterlegt werden. Daraufhin erfolgt eine Einführung in die Theorie der Metaphern (3.). Zunächst wird ein umfassender Forschungsüberblick geschaffen, in dem die gängigsten Ansätze vorgestellt werden (3.1), anschließend werden die Funktionen von Metaphern thematisiert (3.2). Um die Frage nach den kommunikativ-pragmatischen Aspekten der Metaphern in den Zeitungsartikeln angemessen erörtern zu können, wird zudem konkret der Stellenwert der Metaphorik in der Pressesprache betrachtet und die drei wichtigsten Funktionen, die metaphorische Ausdrücke in dieser Textsorte erfüllen können, charakterisiert (3.2.1). Die Vorgehensweise der Metapheranalyse sowie Korpuszusammensetzung werden ausführlich in Kapitel 4 erklärt. Nach dem das Fundament des Forschungsgegenstands und der –methode gelegt wurde, werden im Hauptteil zunächst die quantitativen Ergebnisse (5.1) vorgestellt. In der anschließenden qualitativen Analyse (5.2) folgt eine vergleichende Betrachtung des Metapherngebrauchs in den untersuchten deutschen und französischen Medien. Dort werden die Herkunftsbereiche, die sich durch die Metaphernanalyse als dominierend herausgestellt haben, interpretiert und mit Beispielen untermauert..Es folgt abschließend eine vergleichende Betrachtung des Metapherngebrauchs in deutschen und französischen Medien.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der aktuellen Flüchtlingsbewegungen
- 2.1 Statistiken für die EU, Deutschland und Frankreich
- 3. Annäherung an den Begriff Metapher
- 3.1 Theorien der Metaphern
- 3.1.1 Metaphernverständnis der antiken Rhetorik
- 3.1.2 Metaphernverständnis in der modernen Semantik
- 3.1.3 Metaphernverständnis der Textlinguistik
- 3.1.4 Metaphernverständnis der kognitiven Linguistik
- 3.2 Funktionen von Metaphern
- 3.2.1 Metaphorik in der Pressesprache
- 4. Methodik
- 4.1 Methode der Korpusanalyse
- 4.1.1 Metaphernrekonstruktion und Kategorisierung
- 4.1.2 Auswertung und Deutung des Metaphereinsatzes
- 4.1.3 Metaphern im Sprachvergleich
- 4.2 Wahl des Analysekorpus
- 5. Analyse - Metaphorik in der deutschen und französischen Berichterstattung über Geflüchtete
- 5.1 Makroanalyse - Quantitative Auswertung
- 5.2 Mikroanalyse
- 5.2.1 KAMPF - Metaphorik
- 5.2.2 PERSONIFIKATION - Metaphorik
- 5.2.3 BEHÄLTER - Metaphorik
- 5.2.4 BAUWESEN - Metaphorik
- 5.2.5 WASSER - Metaphorik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Untersuchung von Metaphern im Kontext der deutschen und französischen Berichterstattung über Geflüchtete. Ziel der Arbeit ist es, die in der Berichterstattung verwendeten Metaphern zu analysieren und deren Funktion im Diskurs über Migration zu untersuchen. Darüber hinaus soll ein möglicher Unterschied in der Verwendung von Metaphern zwischen den beiden Ländern aufgezeigt werden.
- Metaphorik im Geflüchtetendiskurs
- Sprachvergleich zwischen Deutsch und Französisch
- Funktion von Metaphern in der Medienkommunikation
- Theorien der Metaphernanalyse
- Methoden der Korpusanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Kontext der Flüchtlingsbewegungen beleuchtet und die Forschungsfrage der Arbeit stellt. Kapitel 2 behandelt die Grundlagen der aktuellen Flüchtlingsbewegungen und stellt relevante Statistiken für die EU, Deutschland und Frankreich vor. Kapitel 3 beleuchtet den Begriff Metapher und stellt verschiedene Theorien der Metaphernanalyse vor, beginnend mit der antiken Rhetorik bis hin zur kognitiven Linguistik. Dieses Kapitel untersucht auch die Funktionen von Metaphern, insbesondere im Kontext der Pressesprache.
Kapitel 4 beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit, die sich auf eine Korpusanalyse stützt. Die Methode der Korpusanalyse wird detailliert erklärt, wobei die Rekonstruktion und Kategorisierung von Metaphern, sowie die Auswertung und Deutung des Metaphereinsatzes im Fokus stehen. Kapitel 5 präsentiert die Analyse der Metaphorik in der deutschen und französischen Berichterstattung über Geflüchtete. Die Analyse umfasst sowohl quantitative als auch qualitative Aspekte, wobei die dominanten Herkunfts- und Zielbereiche der Metaphern betrachtet werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Metapher, Geflüchtete, Migration, Sprachvergleich, Deutsch, Französisch, Medienkommunikation, Korpusanalyse, Diskurslinguistik, kognitiv-konzeptuelle Theorie.
Häufig gestellte Fragen
Wie werden Geflüchtete in deutschen und französischen Medien dargestellt?
Die Berichterstattung nutzt häufig Metaphern aus Bereichen wie Wasser (z.B. "Flüchtlingsstrom"), Kampf oder Bauwesen, um die Thematik zu strukturieren.
Welche Funktion haben Metaphern in der Pressesprache?
Metaphern dienen der Veranschaulichung komplexer Sachverhalte, der emotionalen Bewertung und der pragmatischen Steuerung der Leserwahrnehmung.
Was ist der Unterschied zwischen Makro- und Mikroanalyse in dieser Arbeit?
Die Makroanalyse betrachtet quantitative Ergebnisse (Häufigkeit), während die Mikroanalyse die qualitative Struktur einzelner Bildfelder (z.B. KAMPF-Metaphorik) untersucht.
Welche Rolle spielt die kognitive Linguistik bei der Metaphernanalyse?
Sie liefert das theoretische Fundament, um Metaphern nicht nur als Schmuckelemente, sondern als grundlegende Denk- und Ordnungsmuster zu verstehen.
Gibt es länderspezifische Unterschiede bei der Metaphernwahl?
Die Arbeit vergleicht die Intensität und Produktivität bestimmter Bildfelder in Deutschland und Frankreich, um kulturelle Nuancen in der Sprachverwendung aufzuzeigen.
- Quote paper
- Tatjana Sch (Author), 2017, Metaphorik in der deutschen und französischen Berichterstattung über Geflüchtete, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/386935