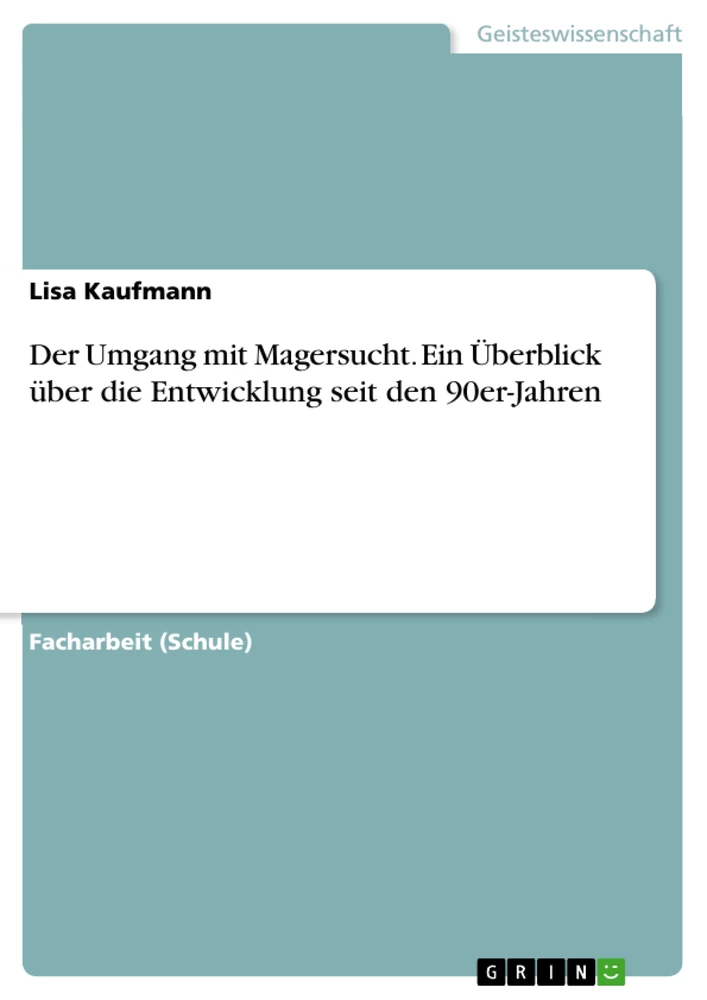Diese Arbeit möchte auf den Ernst von Magersucht aufmerksam machen und unterstreichen, wie wichtig es ist, nicht wegzusehen, sondern möglichst bald Hilfe anzubieten, um damit Heilungschancen zu verbessern.
Die Arbeit widmet sich primär dem Umgang mit Magersucht seit den 90er-Jahren Vor allem durch soziale Netzwerke oder die die Magersucht-favorisierenden Pro-Ana Webseiten wird diese Krankheit für viele junge Menschen oft verharmlost dargestellt, beziehungsweise zum Teil auch propagiert und findet dort überwiegend bei Mädchen Anklang.
Recherchen zeigen, dass vor allem Perfektionisten/-innen in der Magersucht Halt und Sicherheit finden, weil sie ihr Essverhalten dabei kontrollieren können und das Abnehmen somit zu einem stetigen Erfolg wird. Magersucht wird oft unterschätzt und als Mittel zur Erregung von Aufmerksamkeit gesehen, was jedoch nicht zwingend zutreffen muss. Da sich die Zahl der erkrankten Personen seit den letzten 25 Jahren nicht beachtlich geändert hat, wird heutzutage daran gearbeitet, mehr Menschen über diese Krankheit zu informieren, um schneller handeln und die Anzahl der Leidtragenden verringern zu können. Bis heute jedoch gibt es immer noch kein universelles Heilmittel gegen diese in erster Linie psychische Erkrankung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Definition von Magersucht
- 3. Der Umgang mit Magersucht
- 3.1. Der Wandel der Schönheitsideale
- 3.1.1. Die Anfänge
- 3.1.2. Magermodels
- 3.2. Zunehmende Bedeutung von Essstörungen im Sport
- 3.2.1. Sportmagersucht
- 3.2.2. Der Adonis-Komplex
- 3.2.3. Der Body-Mass-Index
- 3.3. Verändertes Ernährungsbewusstsein
- 3.1. Der Wandel der Schönheitsideale
- 4. Der Einfluss von Medien im Umgang mit Magersucht
- 4.1. Die sozialen Netzwerke
- 4.2. Pro-Anorexia Seiten
- 4.3. Die Massenmedien
- 5. Wer von der Krankheit betroffen ist
- 5.1. Die Auslöser der Krankheit
- 5.2. Die Geschlechter und Altersgruppen
- 5.3. Die sozialen Schichten
- 6. Die Therapiemöglichkeiten
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang mit Magersucht seit den 1990er Jahren. Ziel ist es, die Entwicklung der Krankheit im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen, insbesondere im Hinblick auf Schönheitsideale und den Einfluss der Medien, zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet auch die Betroffenen selbst, ihre Motive und die verfügbaren Therapiemöglichkeiten.
- Der Wandel der Schönheitsideale und sein Einfluss auf die Entstehung von Magersucht.
- Die Rolle von sozialen Netzwerken und Medien im Kontext der Magersucht.
- Die Verbreitung von Magersucht in verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
- Die Auslöser und Ursachen von Magersucht.
- Aktuelle Therapiemöglichkeiten und ihre Wirksamkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Magersucht ein und skizziert die Problematik des Umgangs mit dieser Krankheit, insbesondere im Kontext von sozialen Netzwerken und der Verharmlosung oder gar Propagierung der Erkrankung. Sie gibt einen Ausblick auf die Forschungsfragen und den Aufbau der Arbeit.
2. Die Definition von Magersucht: Dieses Kapitel liefert eine präzise Definition von Magersucht, differenziert zwischen dem Wunsch nach Gewichtsreduktion und der krankhaften Kontrolle des eigenen Körpers und beschreibt die damit verbundenen körperlichen und psychischen Folgen. Es unterstreicht den psychischen Aspekt der Erkrankung und die damit verbundene hohe Todesrate.
3. Der Umgang mit Magersucht: Dieses Kapitel analysiert den Umgang mit Magersucht im Wandel der Zeit. Es betrachtet den Wandel der Schönheitsideale, die zunehmende Bedeutung von Essstörungen im Sport (Sportmagersucht, Adonis-Komplex) und das veränderte Ernährungsbewusstsein der Gesellschaft. Die einzelnen Unterkapitel beleuchten diese Aspekte detailliert und zeigen deren Zusammenhänge mit der Entwicklung der Magersucht auf.
4. Der Einfluss von Medien im Umgang mit Magersucht: Hier wird der Einfluss von sozialen Netzwerken, Pro-Ana-Webseiten und den Massenmedien auf die Wahrnehmung und Verbreitung von Magersucht untersucht. Es wird analysiert, wie diese Plattformen die Krankheit verharmlosen, propagieren oder als erstrebenswertes Ideal darstellen können.
5. Wer von der Krankheit betroffen ist: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte der Betroffenen. Es analysiert die Auslöser der Krankheit, die betroffenen Geschlechter und Altersgruppen sowie die sozialen Schichten. Es bietet somit ein umfassendes Bild der Personengruppen, die von Magersucht betroffen sind.
6. Die Therapiemöglichkeiten: Das Kapitel bietet einen Überblick über die aktuellen Therapiemöglichkeiten bei Magersucht. Es thematisiert den Mangel an einem universellen Heilmittel und die Herausforderungen bei der Behandlung dieser psychischen Erkrankung, inklusive der hohen Sterblichkeitsrate und der langfristigen Folgen.
Schlüsselwörter
Magersucht, Anorexia nervosa, Essstörung, Schönheitsideale, Medien, soziale Netzwerke, Pro-Ana, Sportmagersucht, Adonis-Komplex, Body-Mass-Index, Therapiemöglichkeiten, psychische Erkrankung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Umgang mit Magersucht seit den 1990er Jahren
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht umfassend den Umgang mit Magersucht seit den 1990er Jahren. Sie beleuchtet die Entwicklung der Krankheit im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen, insbesondere im Hinblick auf Schönheitsideale und den Einfluss der Medien. Die Arbeit betrachtet auch die Betroffenen selbst, ihre Motive und die verfügbaren Therapiemöglichkeiten. Es werden die Definition von Magersucht, der Wandel der Schönheitsideale, die Rolle der Medien (soziale Netzwerke, Pro-Ana-Seiten), die Verbreitung der Krankheit in verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die Auslöser und Ursachen sowie aktuelle Therapiemöglichkeiten behandelt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Wandel der Schönheitsideale und deren Einfluss auf die Entstehung von Magersucht, die Rolle von sozialen Netzwerken und Medien, die Verbreitung von Magersucht in verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die Auslöser und Ursachen von Magersucht sowie aktuelle Therapiemöglichkeiten und deren Wirksamkeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Definition von Magersucht, Umgang mit Magersucht (inklusive Wandel der Schönheitsideale, Essstörungen im Sport und verändertem Ernährungsbewusstsein), Einfluss von Medien, Betroffene der Krankheit (Auslöser, Geschlechter, Altersgruppen, soziale Schichten), Therapiemöglichkeiten und Fazit. Jedes Kapitel wird in Unterkapitel weiter unterteilt.
Was wird unter dem Wandel der Schönheitsideale verstanden?
Dieser Aspekt analysiert die Entwicklung von Schönheitsidealen seit den 1990er Jahren und deren Einfluss auf die Entstehung und Verbreitung von Magersucht. Es wird untersucht, wie sich diese Ideale verändert haben und wie sie mit der Zunahme von Essstörungen zusammenhängen.
Welche Rolle spielen die Medien bei Magersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von sozialen Netzwerken, Pro-Ana-Webseiten und Massenmedien auf die Wahrnehmung und Verbreitung von Magersucht. Es wird analysiert, wie diese Plattformen die Krankheit verharmlosen, propagieren oder als erstrebenswertes Ideal darstellen können.
Wer ist von Magersucht betroffen?
Dieses Kapitel analysiert die Auslöser der Krankheit, die betroffenen Geschlechter und Altersgruppen sowie die sozialen Schichten. Es bietet ein umfassendes Bild der Personengruppen, die von Magersucht betroffen sind.
Welche Therapiemöglichkeiten werden besprochen?
Die Arbeit bietet einen Überblick über aktuelle Therapiemöglichkeiten bei Magersucht, thematisiert den Mangel an einem universellen Heilmittel und die Herausforderungen bei der Behandlung dieser psychischen Erkrankung, inklusive der hohen Sterblichkeitsrate und langfristigen Folgen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Magersucht, Anorexia nervosa, Essstörung, Schönheitsideale, Medien, soziale Netzwerke, Pro-Ana, Sportmagersucht, Adonis-Komplex, Body-Mass-Index, Therapiemöglichkeiten, psychische Erkrankung.
- Citar trabajo
- Lisa Kaufmann (Autor), 2017, Der Umgang mit Magersucht. Ein Überblick über die Entwicklung seit den 90er-Jahren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387005