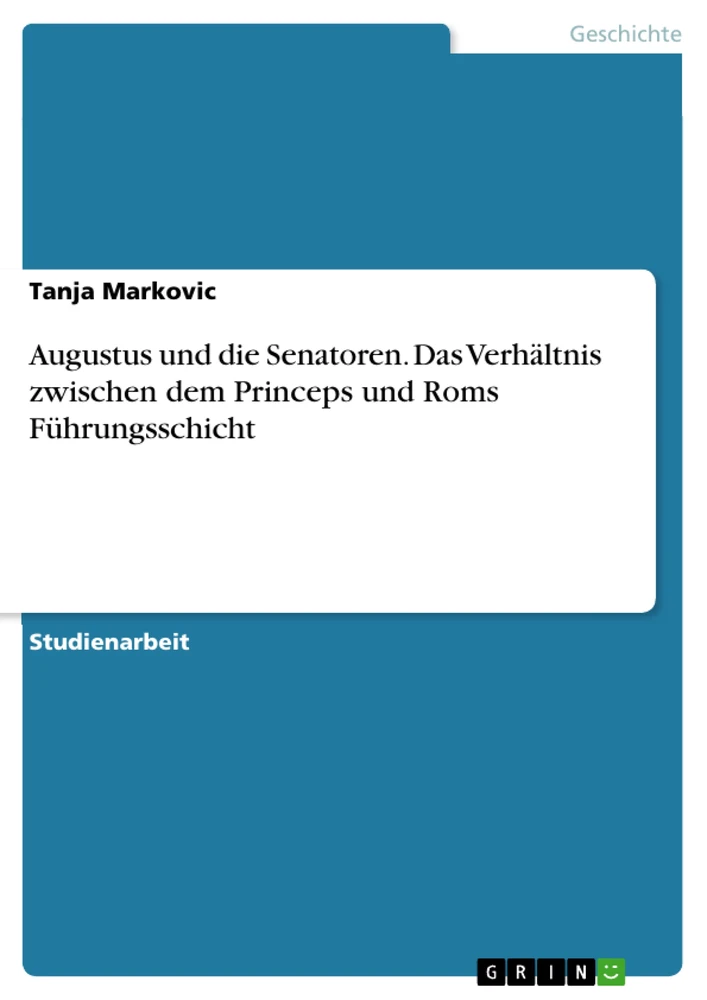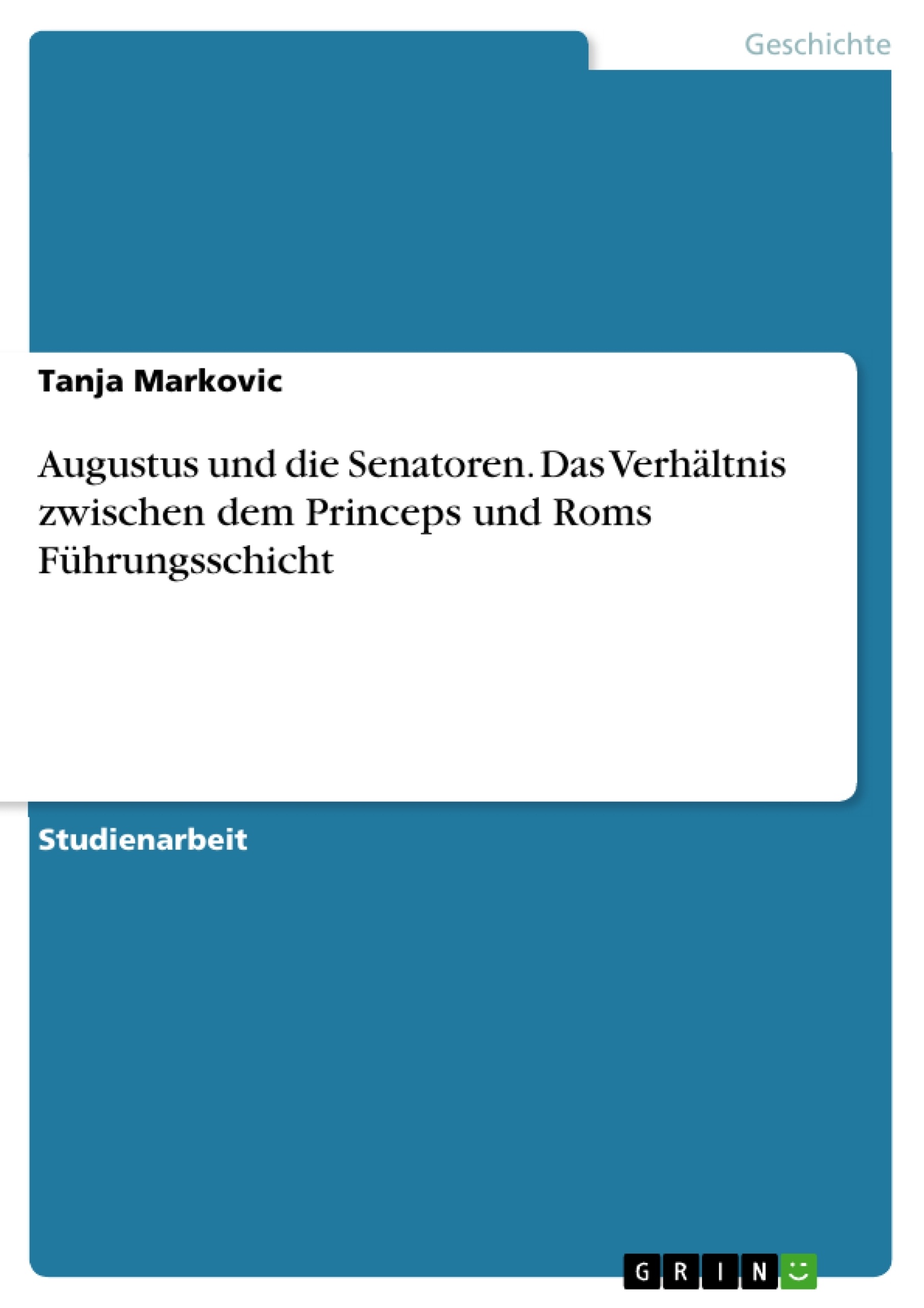Nach Caesars Tod am 15. März 44 trat eine neue Person in die politische Welt des alten Roms, sein Adoptivsohn und Erbe C. Iulius Caesar, später Augustus genannt. Er blieb eine zentrale Figur in dieser Welt bis zu seinem Tod 14 n. Chr. Hunderte und sogar tausende Jahre später ist er nach wie vor eine faszinierende Figur, deren Persönlichkeit und politisches Handeln noch heutzutage im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Diskussion stehen.
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dem Thema Augustus und die Senatoren auseinander und erstellt eine Beschreibung des Verhältnisses zwischen dem Princeps und Roms Führungsschicht, das mit andauernden Dispute und Konsense erfüllt war. Im Folgenden wird die Rolle des Senats und der Senatoren in der römischen Republik und der frühen Kaiserzeit erläutert und die Hauptmerkmale des Senatorenstandes genannt. Es werden folgende Fragen im Mittelpunkt stehen: „Wie verhält sich Augustus gegenüber der politischen Institution des Senats?” und „Wie verändert sich der Senat unter Augustus, wie beeinflusst er ihn?” Aus den Wirren des römischen Bürgerkriegs trat Augustus als Sieger hervor, aber sein verfassungsrechtlicher Status war noch unsicher. Er wollte auf seine Macht auf keinen Fall verzichten, daher musste er unbedingt eine Übereinkunft mit dem Senat als damaligen Machtträger erzielen. Augustus wollte nicht den gleichen Fehler wie sein Adoptivvater machen, der auf seine Absicht, allein zu herrschen, allzu deutlich anspielte. Es soll in diesem Text aufgezeigt werden, wie es Augustus gelang, durch verschiedene Inszenierungen, neue Sittengesetze und Senatsreformen die Zusammensetzung des Senats zu bestimmen und zu kontrollieren. Im Laufe der Zeit verlor der Senat allmählich seine Macht und Augustus sicherte seine Stellung, was ihm den endgültigen Durchbruch zur Alleinherrschaft ermöglichte.
Diese Arbeit ist nicht streng chronologisch gegliedert, sondern viel mehr in thematische Einheiten unterteilt. Der Schwerpunkt liegt auf den Jahren 27 bis 18 v. Chr. 27 v. Chr. als das Jahr der Zeitenwende für sowohl Augustus, als auch für die Geschichte Roms allgemein. 23 v. Chr. ist das Jahr der Krise und 18 v. Chr. das Jahr der größten Senatssäuberung und mehrerer Senatsreformen von hoher Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Senatorenstand (ordo senatorius)
- Äußere Standesabzeichen
- Der Senat(or) in der römischen Republik
- Der Princeps und die römische Oberschicht
- Übergabe der res publica
- Neustrukturierung des Senats
- Senatsreformen, neue Sittengesetze und ihre Folgen
- Consilium
- Homines novi
- Das Jahr der Krise
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen Augustus und dem Senatorenstand im Römischen Reich. Sie analysiert die Entwicklung des Verhältnisses zwischen dem Princeps und der Führungsschicht Roms, die von fortwährenden Auseinandersetzungen und Kompromissen geprägt war. Ziel ist es, die Rolle des Senats und der Senatoren in der römischen Republik und der frühen Kaiserzeit zu beleuchten und die Hauptmerkmale des Senatorenstandes zu beschreiben. Im Mittelpunkt stehen die Fragen nach dem Umgang Augustus' mit der Institution des Senats und der Veränderung des Senats unter Augustus' Einfluss.
- Das Verhältnis zwischen Augustus und dem Senatorenstand
- Die Rolle des Senats in der römischen Republik und der frühen Kaiserzeit
- Die Hauptmerkmale des Senatorenstandes
- Augustus' Einfluss auf die Zusammensetzung und Funktionsweise des Senats
- Die Senatsreformen und -säuberungen unter Augustus
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt Augustus' Rolle in der römischen Politik nach Caesars Tod. Sie beleuchtet den Konflikt zwischen Augustus und dem Senat sowie die Notwendigkeit einer Übereinkunft zwischen beiden. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, wie Augustus durch verschiedene Maßnahmen die Zusammensetzung und Kontrolle des Senats beeinflussen konnte.
- Der Senatorenstand (ordo senatorius): Dieses Kapitel beschreibt den Senatorenstand als Teil der Führungsschicht im Römischen Reich. Es behandelt die sozialen Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Senat, die Standesabzeichen und die verschiedenen Ränge innerhalb des Senatorenstandes, einschließlich der Nobilität. Die Kapitel fokussiert auf die Rolle der Senatoren in der römischen Gesellschaft und ihre politische Macht.
- Äußere Standesabzeichen: Das Kapitel beleuchtet die äußeren Zeichen, anhand derer ein Senator in der römischen Gesellschaft identifiziert werden konnte. Es beschreibt die Kleidung, Schuhe und andere Kennzeichen, die den Senatorenstand von anderen gesellschaftlichen Schichten abgrenzten.
Schlüsselwörter
Augustus, Senat, Senatorenstand, römische Oberschicht, Princeps, res publica, Senatsreformen, Sittengesetze, Nobilität, Standesabzeichen, Consilium, Homines novi, römischer Bürgerkrieg, Kaiserzeit, Republik.
- Citation du texte
- Tanja Markovic (Auteur), 2017, Augustus und die Senatoren. Das Verhältnis zwischen dem Princeps und Roms Führungsschicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387017