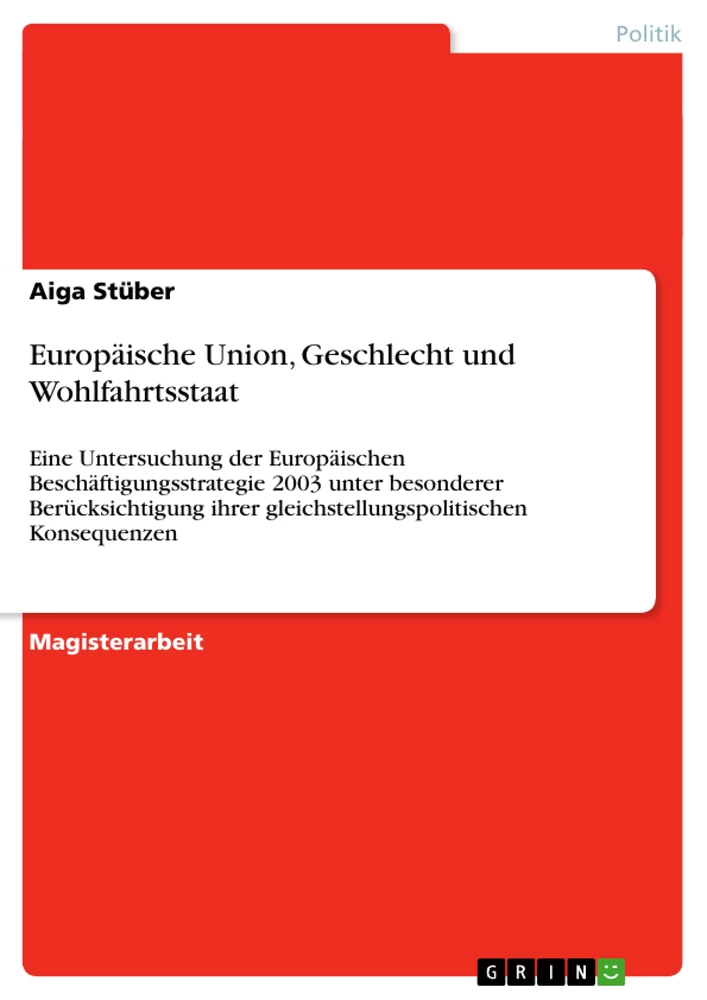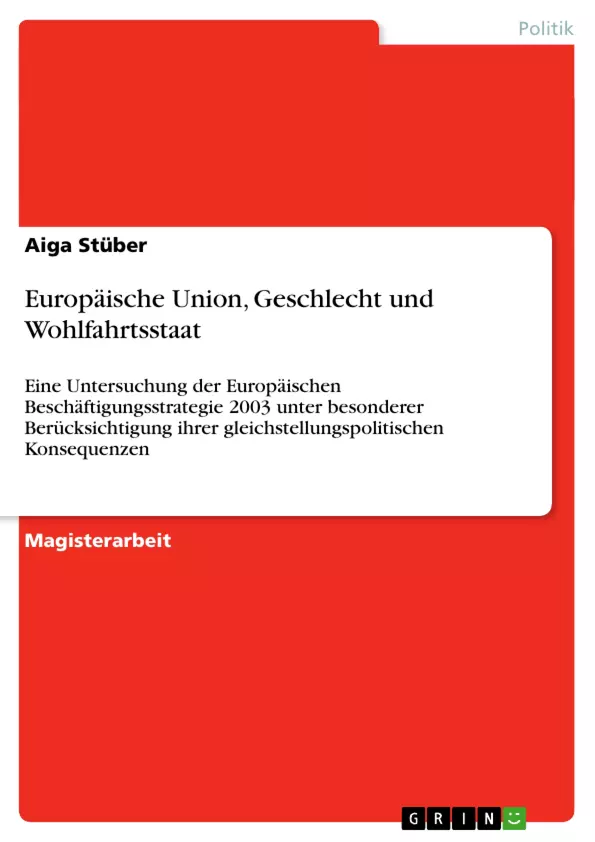Die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS), die entwickelt wurde, um Vollbeschäftigung in Europa zu erreichen, ist jung. Erst auf der Tagung des Europäischen Rates in Amsterdam im Jahre 1997 ist der rechtliche und institutionelle Rahmen zur Unterstützung der beschäftigungspolitischen Annäherung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) geschaffen worden: der neue Beschäftigungstitel im Vertrag von Amsterdam. Seitdem ist sie unter Berücksichtigung ihrer Ergebnisse kontinuierlich weiter entwickelt worden. Im Ergebnis unterscheiden sich die beschäftigungspolitischen Leitlinien aus dem Jahre 2003 deutlich von den vorangegangenen.
Durch die Selbstverpflichtung der Europäischen Union in Art. 3, 3 des Vertrages der Europäischen Gemeinschaft (EGV) unterliegt die EBS - ebenso wie jedes andere Betätigungsfeld der EU - dem Prinzip des Gender Mainstreaming. Hiermit ist die im Vertrag von Amsterdam festgelegte Einbeziehung der gender-Perspektive in alle Prozesse, auf allen Ebenen, in allen Entscheidungsmomenten durch alle beteiligten Akteuren gemeint. Prinzip, Erfolge und Misserfolge dieser gleichstellungspolitischen Strategie wurden von der Forschung vielfach disku-tiert. Eine Untersuchung der gleichstellungspolitischen Dimension der jüngsten beschäftigungspolitischen Leitlinien und ihrer Umsetzung in den Nationalen Aktionsplänen für die Jahre 2003-2006 steht noch aus.
Die Wohlfahrtsstaatsforschung ist ein etablierter sozialwissenschaftlicher Forschungszweig mit elaboriertem, umfangreichem und für eine geschlechtersensible Analyse der Europäischen Union möglicherweise fruchtbarem methodologischem Handwerkszeug. Wohlfahrtsstaatsforschung beschäftigt sich dabei traditionell mit Staatstätigkeit. Kann der EU eine solche Staatstätigkeit in welcher Form auch immer nachgewiesen werden, eröffnet sich die Möglichkeit der Verwendung dieses Instrumentariums für eine Betrachtung der EU. Denkbar wäre dann eine Einschätzung von politischen Prozessen auf der Ebene der EU und damit auch der zu erwartenden Wechselwirkungen zwischen Institutionen und Gesetzgebung der EU und den Mitgliedstaaten. In dieser Arbeit ist der Versuch unternommen worden, die Ergebnisse der Wohlfahrtsstaatsforschung für eine Untersuchung der Europäischen Beschäftigungsstrategie zu nutzen. Dabei stand im Mittelpunkt des Interesses, ob die Auswirkungen der Europäischen Staatstätigkeit auf verschiedene Typen von nationalen Wohlfahrtsstaaten unterschiedlich sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Begriffsklärungen
- Theoretisch fassbare Gestalt der EBS
- Wohlfahrtsstaatsforschung und Beschäftigungspolitik
- Geschlecht und Gender Mainstreaming
- Wohlfahrtsstaat und Gleichstellungspolitik
- Staat und Geschlechterverhältnis
- Entstehung der modernen Nationalstaaten
- Rechtsstaat
- Wohlfahrtsstaat
- Feministische Reaktionen auf androzentrische Staaten
- Staatskritische Frauenbewegung
- Mittelbare und unmittelbare Diskriminierung
- Frauenfreundlicher Staat?
- Skandinavischer Staatsfeminismus
- Kritik an der skandinavischen Position
- Herrschaft als ambivalenter Begriff
- Wohlfahrtsstaatsforschung
- Vergleichende Wohlfahrtsstaatsforschung
- Maßstab: Dekommodifikation
- Einteilung von Wohlfahrtsstaaten in Typen
- Der liberale Wohlfahrtsstaat
- Der korporatistische Wohlfahrtsstaat
- Der universalistische Wohlfahrtsstaat
- Der lateinisch-katholische Wohlfahrtsstaat
- Feministische Wohlfahrtsstaatsforschung
- Maßstab: Defamilialisation
- Typologisierung nach dem männlichen Brotverdienermodell
- Starke Version: Deutschland/Großbritannien
- Abgeschwächte Version: Frankreich
- Schwache Version: Schweden
- Fragen an eine geschlechtergerechte Beschäftigungspolitik
- Die Europäische Union als beschäftigungspolitischer Akteur
- Die EU als dynamisches Gebilde, Rechtsgemeinschaft und Mehrebenensystem
- Die sozial- und beschäftigungspolitische Staatstätigkeit der EU
- Der Vertrag von Amsterdam
- Beschäftigungspolitik
- Die Europäische Beschäftigungsstrategie
- Das erste Stadium der EBS (1997-2002)
- Erste Erfahrungen und Kritik
- Die aktuelle Form: Die beschäftigungspolitischen Leitlinien für 2003
- Gleichstellungspolitik in der Europäischen Union
- Geschichte der Gleichstellungspolitik
- Reproduktionssphäre und Gender Mainstreaming in der EU
- Analyse der Europäischen Beschäftigungsstrategie von 2003
- Zugang zur Beschäftigung
- Die Leitlinien
- Aktive und präventive Maßnahmen für Arbeitslose und Nichterwerbspersonen
- Schaffung von Arbeitsplätzen und Unternehmergeist
- Erhöhung des Arbeitskräfteangebots und Förderung des aktiven Alterns
- Gleichstellung der Geschlechter
- Exkurs I: Zugang zur Beschäftigung in den Nationalen Aktionsplänen
- Bildungspolitik
- Wiedereingliederung
- Aufstiegschancen und Unternehmensgründungsunterstützung für Frauen
- Zwischenfazit I
- Organisation der Reproduktionsarbeit
- Die Leitlinien
- Betreuung von Abhängigen
- Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse
- Einbezug von Männern in häusliche Arbeiten
- Exkurs II: Reproduktionsarbeit in den Nationalen Aktionsplänen
- Öffentliche Kinderbetreuung
- Ältere Angehörige
- Einbezug der Väter
- Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse
- Zwischenfazit II
- Vergleich mit den vorangegangenen beschäftigungspolitischen Leitlinien
- Schluss
- Ergebnisse
- Ausblick
- Der Einfluss der EBS auf nationale Wohlfahrtsstaatsmodelle
- Die Umsetzung von Gender Mainstreaming in der EBS
- Die Rolle der EBS in der Gestaltung von Geschlechterverhältnissen
- Der Vergleich der EBS mit den vorangegangenen beschäftigungspolitischen Leitlinien
- Die Bedeutung der Wohlfahrtsstaatsforschung für die Analyse der EBS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) und ihrer gleichstellungspolitischen Dimension. Ziel ist es, die EBS aus der Perspektive der Wohlfahrtsstaatsforschung zu analysieren und die Frage zu untersuchen, ob die Auswirkungen der europäischen Staatstätigkeit auf verschiedene Typen von nationalen Wohlfahrtsstaaten unterschiedlich sind. Die Arbeit setzt sich mit der Integration der Gender-Perspektive in die EBS auseinander und analysiert die Wechselwirkungen zwischen europäischen und nationalen Geschlechterpolitiken.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Fragestellung definiert und wichtige Begriffe wie die EBS, Wohlfahrtsstaatsforschung und Gender Mainstreaming erläutert. Kapitel 2 beleuchtet die Beziehung zwischen Staat und Geschlechterverhältnis und analysiert die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates im Kontext von feministischen Strömungen. Kapitel 3 widmet sich der Wohlfahrtsstaatsforschung und untersucht verschiedene Ansätze sowie deren Relevanz für eine geschlechtersensible Analyse der EU. In Kapitel 4 wird die Europäische Union als beschäftigungspolitischer Akteur vorgestellt, wobei insbesondere die EBS und ihre Entwicklung im Fokus stehen. Kapitel 5 schließlich analysiert die EBS von 2003, insbesondere im Hinblick auf den Zugang zur Beschäftigung und die Organisation der Reproduktionsarbeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen wie Europäische Beschäftigungsstrategie, Gender Mainstreaming, Wohlfahrtsstaat, Wohlfahrtsstaatsforschung, Gleichstellungspolitik, Geschlechterverhältnisse, Reproduktionsarbeit, nationale Aktionspläne, EU-Staatstätigkeit, und die Wechselwirkungen zwischen europäischen und nationalen Politikbereichen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Europäische Beschäftigungsstrategie (EBS)?
Die EBS ist ein 1997 ins Leben gerufener Rahmen zur Annäherung der Beschäftigungspolitik der EU-Mitgliedstaaten mit dem Ziel der Vollbeschäftigung.
Wie wird Gender Mainstreaming in der EBS umgesetzt?
Es verpflichtet die EU, die Gender-Perspektive in alle Prozesse, Entscheidungsmomente und Ebenen der Beschäftigungspolitik einzubeziehen.
Welche Rolle spielt die Wohlfahrtsstaatsforschung in dieser Analyse?
Sie liefert methodische Werkzeuge (wie Dekommodifikation und Defamilialisation), um die Auswirkungen der EU-Politik auf verschiedene nationale Wohlfahrtsmodelle zu untersuchen.
Welche Wohlfahrtsstaatstypen werden im Text unterschieden?
Es wird zwischen liberalen, korporatistischen, universalistischen und lateinisch-katholischen Wohlfahrtsstaaten differenziert.
Was bedeutet "Defamilialisation" im Kontext der Gleichstellung?
Es ist ein Maßstab dafür, wie stark ein Wohlfahrtsstaat Individuen von der Abhängigkeit von familiärer Unterstützung (z.B. bei der Kinderbetreuung) entlastet.
- Citar trabajo
- Aiga Stüber (Autor), 2004, Europäische Union, Geschlecht und Wohlfahrtsstaat, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38710