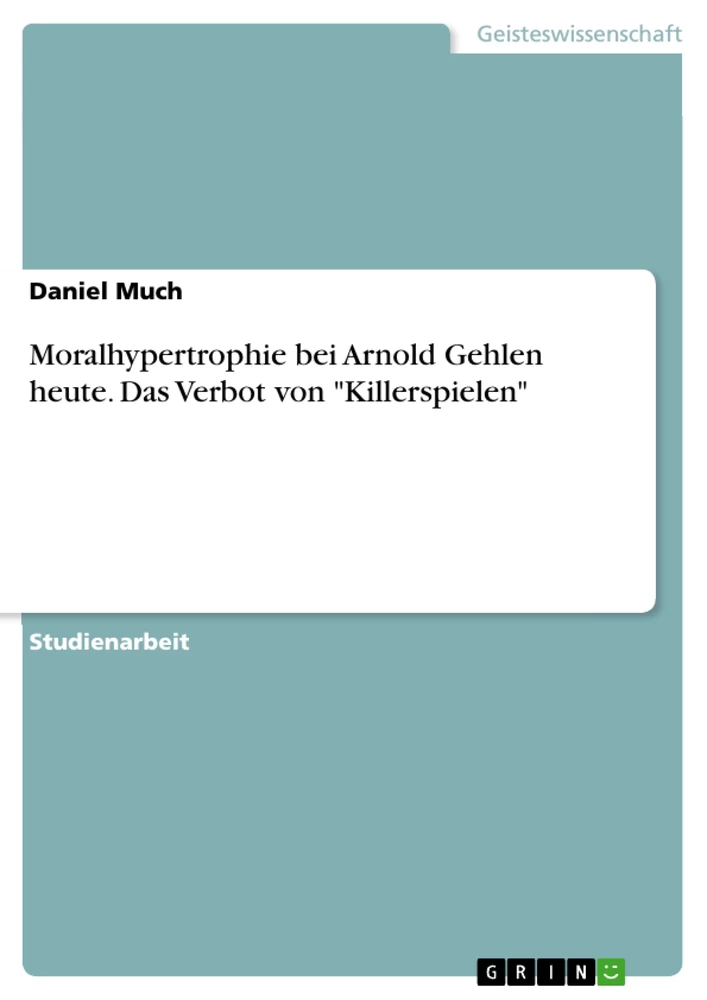In seinem Buch "Moral und Hypermoral" beschreibt Arnold Gehlen die moderne Industriegesellschaft und ihre moralischen Probleme. Er vertritt die Auffassung, dass unsere Moral nicht mit den technischen Entwicklungen Schritt halten kann, da sie nur für ein Handeln innerhalb unseres direkten Umfeldes sinnvoll ist. Die Technik ermöglicht uns heute aber einen Einblick in die Lebensverhältnisse und Probleme von Menschen rund um den Globus. Durch unsere, von Mitleid und Nachsicht geprägte, "Nahmoral" empfinden wir ein Bedürfnis zu handeln oder doch wenigstens mitzufühlen weltweit. Da ein solches Handeln uns natürlich maßlos überfordert, stehen wir den globalen Problemen ohnmächtig gegenüber und ziehen uns in den privaten Raum zurück, in dem unsere Moral noch funktioniert. Diese Überdehnung unserer Moral ins Weltweite nennt Gehlen "Moralhypertrophie".
Dass diese nicht nur ein Problem von Gehlens Zeit war, sondern auch heute noch, in leicht veränderter Form, auftritt möchte ich hier zeigen. Dazu werde ich den Begriff der Moralhypertrophie näher erläutern, bevor ich auf die Modifikation, die sie heute erfahren hat, näher eingehe. Anschließend möchte ich als Beispiel für ein moralhypertrophes Verhalten die aktuelle Diskussion über ein Verbot gewaltverherrlichender Computerspiele, die für gewalttätiges und menschenverachtendes Verhalten von Jugendlichen verantwortlich gemacht werden, analysieren. Abschließend soll ein möglicher Lösungsansatz für das Problem der Moralhypertrophie und, bezogen darauf, für das Problem der sog. „Killerspiele“ genannt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gehlens Begriff der Moralhypertrophie
- Moralhypertrophie heute
- „Killerspiele“
- Die Überwindung der Moralhypertrophie
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Phänomen der Moralhypertrophie, das von Arnold Gehlen in seinem Werk "Moral und Hypermoral" beschrieben wird. Der Autor analysiert, wie sich die moderne Industriegesellschaft durch die rasante Entwicklung der Technik und Informationsmedien mit einer Überlastung ihrer moralischen Werte konfrontiert sieht. Gehlen kritisiert dabei den Humanitarismus und den Masseneudaimonismus als treibende Kräfte der Moralhypertrophie.
- Moralhypertrophie als Folge der Überforderung der Moral durch die technischen Entwicklungen
- Kritik am Humanitarismus und Masseneudaimonismus
- Die Rolle der Informationsmedien in der Entwicklung der Moralhypertrophie
- Die Überwindung der Moralhypertrophie durch die Förderung von Mut, Selbstopfer und altruistischem Einsatz
- Die Analyse der aktuellen Diskussion über ein Verbot von gewaltverherrlichenden Computerspielen als Beispiel für moralhypertrophes Verhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text beginnt mit einer Einführung in den Begriff der Moralhypertrophie, der von Arnold Gehlen in seinem Buch "Moral und Hypermoral" geprägt wurde. Die Einleitung erklärt, wie die moderne Gesellschaft durch die rasante technische Entwicklung und die damit verbundene globale Vernetzung mit einer Überdehnung ihrer moralischen Werte konfrontiert ist.
Gehlens Begriff der Moralhypertrophie
Dieses Kapitel behandelt Gehlens Definition der Moralhypertrophie als eine Überbeanspruchung der Moral, die durch die Entwicklung der Informations- und Kommunikationsmedien entsteht. Der Text analysiert, wie die Moral mit der Entwicklung der Technik nicht Schritt halten kann und dadurch überfordert ist. Die Entzauberung der Natur und die Ideale der Aufklärung führen dazu, dass der Mensch auf sich selbst zurückgeworfen wird und mit den Problemen der ganzen Welt belastet ist. Der Humanitarismus und der Masseneudaimonismus werden als Ursachen für die Überdehnung der Moral kritisiert.
Moralhypertrophie heute
Dieses Kapitel untersucht, wie sich die Moralhypertrophie in der heutigen Zeit manifestiert. Der Text analysiert die Modifikationen, die der Begriff der Moralhypertrophie seit Gehlens Zeit erfahren hat, und zeigt auf, wie die moralischen Probleme in der heutigen Gesellschaft noch aktueller sind als zu Gehlens Zeit.
„Killerspiele“
Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Diskussion um ein Verbot von gewaltverherrlichenden Computerspielen als ein Beispiel für moralhypertrophes Verhalten. Der Text untersucht, wie die moralische Überforderung der Gesellschaft dazu führt, dass Computerspiele als Ursache für gewalttätiges und menschenverachtendes Verhalten von Jugendlichen verantwortlich gemacht werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind Moralhypertrophie, Moral, Technik, Informationsmedien, Humanitarismus, Masseneudaimonismus, „Killerspiele“, Gewalt, Überforderung, Gesellschaft, und Moderne.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Arnold Gehlen unter „Moralhypertrophie“?
Es beschreibt die Überdehnung unserer Moral ins Weltweite durch moderne Technik. Wir fühlen uns für globale Probleme verantwortlich, die wir faktisch nicht lösen können, was zu Ohnmacht führt.
Warum ist unsere „Nahmoral“ für die moderne Welt problematisch?
Unsere Moral ist auf das direkte Umfeld ausgelegt. Die Technik zeigt uns aber Leid auf der ganzen Welt, wodurch unser Mitgefühl maßlos überfordert wird.
Wie wird die Diskussion um „Killerspiele“ in diesem Kontext analysiert?
Die Debatte wird als Beispiel für moralhypertrophes Verhalten gesehen, bei dem komplexe gesellschaftliche Gewaltprobleme vereinfacht auf Computerspiele projiziert werden.
Welche Rolle spielen Informationsmedien bei der Moralhypertrophie?
Sie fungieren als Treiber, da sie uns ständig mit den Problemen und Lebensverhältnissen von Menschen rund um den Globus konfrontieren.
Gibt es laut Gehlen einen Lösungsansatz?
Gehlen schlägt vor, die Moralhypertrophie durch die Förderung von Mut, Selbstopfer und konkretem, altruistischem Einsatz im machbaren Rahmen zu überwinden.
- Citation du texte
- Daniel Much (Auteur), 2007, Moralhypertrophie bei Arnold Gehlen heute. Das Verbot von "Killerspielen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387213