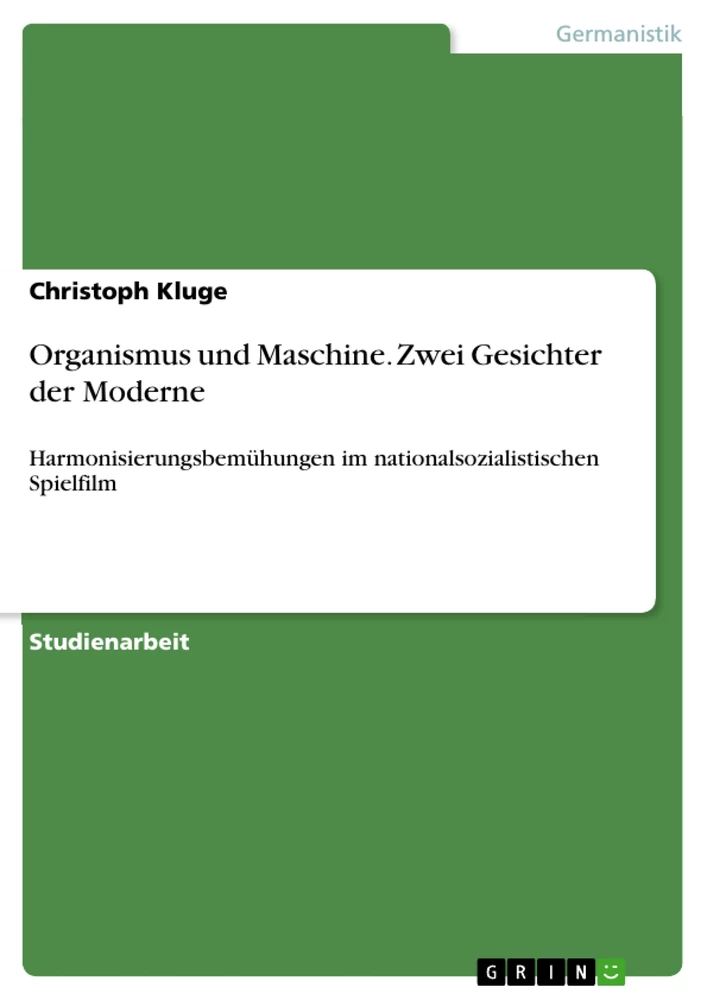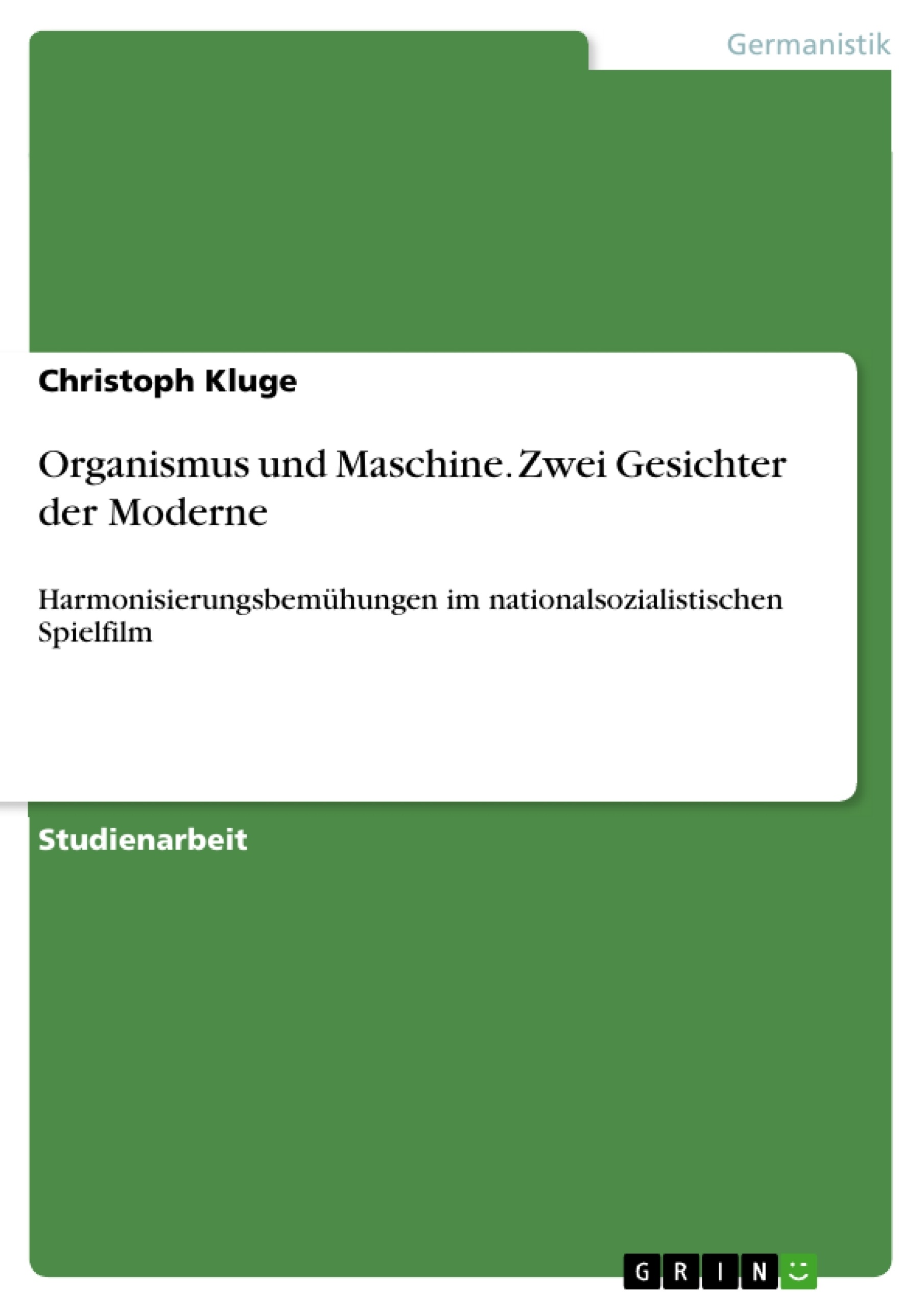Der Spielfilm des ‚Dritten Reichs‘ war nie ein reines Propagandaprodukt. Die Filmproduktion folgte auch bestehenden Konventionen und Kontinuitäten der Branche, Gewohnheiten des Publikums und Anforderungen, die sich aus der internationalen Konkurrenz ergaben, vor allem der zu Hollywood. Die Inhalte wurden ebenfalls von einer Vielzahl von Faktoren bestimmt, kommerziellen Interessen ebenso wie künstlerischen Ambitionen und politischen Erwägungen in einer Gesellschaft, die auch ohne Demokratie noch heterogen und voller Bruchlinien war.
In dieser spannungsreichen Situation stand der Film vor einer Aufgabe, die sich speziell aus dem Nationalsozialismus ergab. Die NSDAP war mit dem Versprechen angetreten, ein System zu errichten, das die Widersprüche der Moderne überwinden könne. Der soziale Klassenkonflikt und die Frage nach der Rolle der Frau, die die Weimarer Republik beschäftigt und gespalten hatten, galten als gelöst, Konservative und Modernisierer als versöhnt. Der Spielfilm sollte nun Geschichten erzählen, die dieser imaginierten Harmonie Ausdruck verleihen und gleichzeitig das Publikum begeistern konnten.
Um das Problemfeld abzustecken, wird im Theorieteil dieser Arbeit auf einige mechanistische und organologische Konzeptionen von Gesellschaft eingegangen – zwei Diskursfelder, die in einem dialektischen Verhältnis zueinander stehen. Der Hauptteil untersucht fünf Filme aus der NS-Zeit, vier Liebeskomödien und einen Kriegsfilm, die Probleme und Unsicherheiten der Bevölkerung aufgriffen und versuchten, Antworten auf offene Fragen zu liefern. Widersprüchliche Gesellschafts- und Menschenbilder mussten zumindest oberflächlich in Einklang gebracht werden, um die nationalsozialistische Gegenwart als ‚alternative Moderne‘ darzustellen, in der technologischer Fortschritt und traditionelle Werte friedlich koexistieren können.
In einem Exkurs wird zudem Fritz Langs Film Metropolis untersucht, der bereits 1927 den Versuch einer Harmonisierung von zwei gegensätzlichen Vorstellungen von Moderne unternahm.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorieteil: Die zwei Modernen
- Organismus und Maschine
- Die Suche nach Heimat im frühen 20. Jahrhundert
- Die Maschine als autoritäre Versuchung
- Der Futurismus
- Ernst Jünger
- Von der Modernefeindlichkeit zur „alternativen Moderne“
- Exkurs: Fritz Langs Metropolis (1927)
- Hauptteil: Versuche der Harmonisierung im NS-Spielfilm
- Urlaub auf Ehrenwort (1938)
- Wunschkonzert (1940)
- Die große Liebe (1942)
- Zwei in einer großen Stadt (1942)
- Großstadtmelodie (1943)
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Versuche des nationalsozialistischen Spielfilms, eine „alternative Moderne“ zu konstruieren, die technologischen Fortschritt und traditionelle Werte harmonisiert. Dabei wird der Fokus auf die Widersprüche zwischen mechanistischen und organologischen Gesellschaftsmodellen gelegt, die sich in der NS-Zeit als Spannungsfeld darstellten.
- Die zwei Modernen: Organismus und Maschine als gegensätzliche Konzepte der Gesellschaftsordnung
- Die Suche nach Heimat und die Rolle der Großstadt im nationalsozialistischen Gesellschaftsbild
- Die Maschine als autoritäre Versuchung: Der Futurismus und Ernst Jüngers Vision einer totalitären Ordnung
- Harmonisierungsversuche im NS-Spielfilm: Die Darstellung von Liebe, Familie und Gesellschaft in ausgewählten Filmen
- Die Bedeutung von Tradition und Fortschritt in der NS-Ideologie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problemfeld der Arbeit vor, die untersucht, wie der Spielfilm des „Dritten Reichs“ die Widersprüche der Moderne in einer imaginierten Harmonie darzustellen versuchte. Der Theorieteil befasst sich mit den mechanistischen und organologischen Konzeptionen von Gesellschaft, die in einem dialektischen Verhältnis zueinander stehen. Es werden die historischen Wurzeln dieser Konzepte beleuchtet, von der Antike über die Aufklärung bis zum frühen 20. Jahrhundert. Der Exkurs widmet sich Fritz Langs Film „Metropolis“ (1927), der bereits früh den Versuch einer Harmonisierung von zwei gegensätzlichen Vorstellungen von Moderne unternahm.
Der Hauptteil analysiert fünf ausgewählte NS-Spielfilme, die sich mit Liebeskomödien und einem Kriegsfilm beschäftigen. Hier werden die Versuche der Harmonisierung von widersprüchlichen Gesellschafts- und Menschenbildern in der nationalsozialistischen Gegenwart untersucht, die als „alternative Moderne“ dargestellt werden sollte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Schlüsselbegriffe „Organismus“, „Maschine“, „Heimat“, „Großstadt“, „moderne“, „alternative Moderne“, „Nationalsozialismus“, „Spielfilm“, „Harmonisierung“, „Propagandaprodukt“, „Tradition“, „Fortschritt“, „Gesellschaft“, „Menschenbild“, „technologischer Fortschritt“ und „Völkische Ideologie“. Die Arbeit befasst sich mit den Themen der NS-Ideologie, dem Gesellschaftsbild der NS-Zeit, dem Verhältnis von Mensch und Maschine, dem Einfluss des technischen Fortschritts auf die Gesellschaft und der Rolle des Spielfilms als Propagandainstrument.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „alternative Moderne“ im Kontext des NS-Spielfilms?
Es beschreibt den Versuch, technologischen Fortschritt und traditionelle völkische Werte in einer imaginierten Harmonie darzustellen, um gesellschaftliche Widersprüche zu überdecken.
Welche Rolle spielt Fritz Langs „Metropolis“ in dieser Arbeit?
In einem Exkurs wird Metropolis als früher Versuch analysiert, die gegensätzlichen Vorstellungen von Organismus und Maschine filmisch zu harmonisieren.
Welche Filme aus der NS-Zeit werden im Hauptteil untersucht?
Analysiert werden unter anderem „Wunschkonzert“, „Die große Liebe“, „Urlaub auf Ehrenwort“ und „Zwei in einer großen Stadt“.
Wie standen „Organismus“ und „Maschine“ zueinander?
Diese beiden Konzepte bilden ein dialektisches Spannungsfeld zwischen mechanistischer Gesellschaftsordnung und organologischer Gemeinschaftsideologie.
War der NS-Spielfilm ein reines Propagandaprodukt?
Nein, die Filmproduktion folgte auch kommerziellen Interessen, künstlerischen Ambitionen und internationalen Konventionen, um das Publikum trotz politischer Ziele zu begeistern.
- Arbeit zitieren
- Christoph Kluge (Autor:in), 2017, Organismus und Maschine. Zwei Gesichter der Moderne, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387605