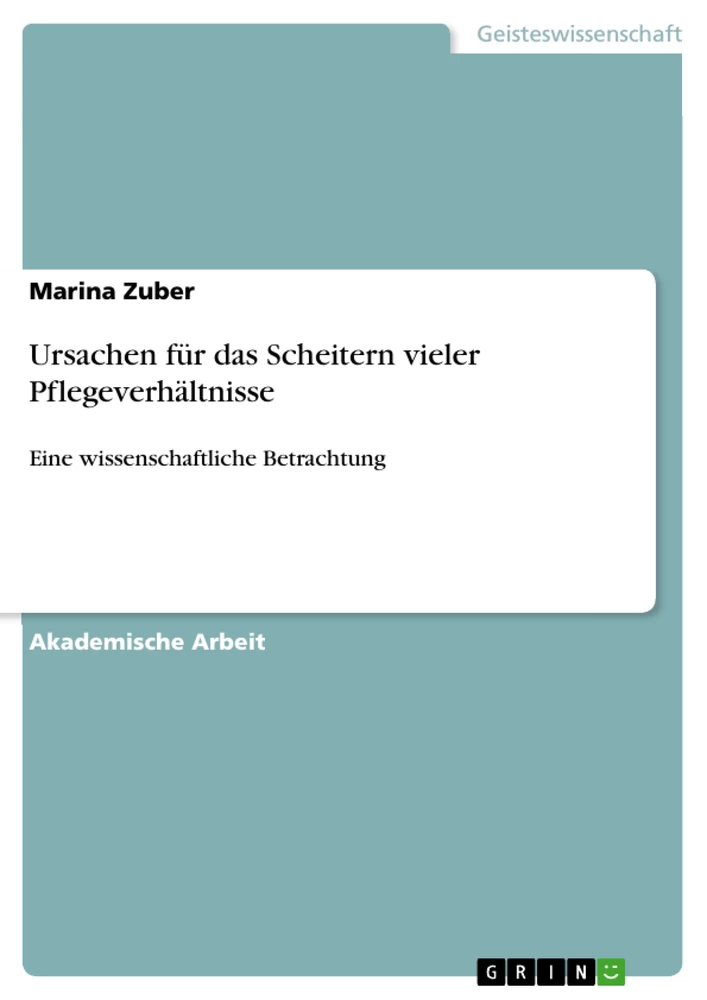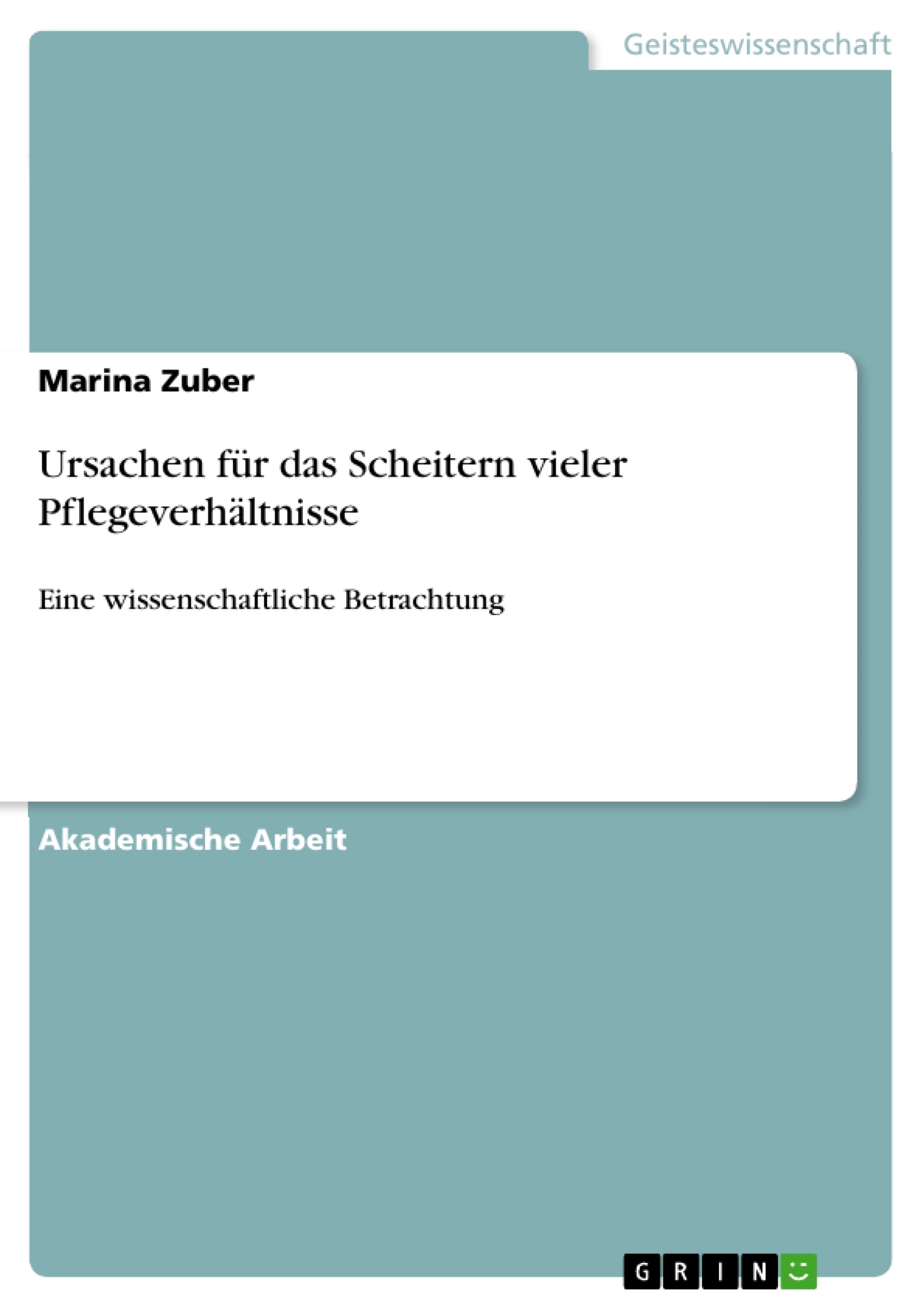In dieser wissenschaftlichen Abhandlung wird der Frage nachgegangen, welche Prozesse zu einer Beendigung von Pflegeverhältnissen in Pflegefamilien führen. Nach einer kurzen einleitenden theoretischen Heranführung an die Thematik der Pflegeelternschaft, wird das Sozialisations- bzw. Spannungsfeld der Pflegefamilie näher dargestellt. Das heißt auf die sozialen Strukturen des komplexen Systems Pflegefamilie intensiver eingegangen und Problemstellungen der Sozialisation konzeptionell analysiert, sowie die Faktoren herausgearbeitet, die ein Scheitern begünstigen.
Die Grundlage der Jugendhilfe bildet das achte Sozialgesetzbuch, welches bundeseinheitlich Leistungen gegenüber jungen Menschen, Kindern, Jugendlichen sowie deren Eltern, Sorgeberechtigten, Erziehungsberechtigten und Personensorgeberechtigten regelt. Im Falle eine Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII, wie vorliegender Arbeit obliegt die Durchführung den Landes- und den Jugendämtern. Unter anderem auch Spezialisierten Dienste der Jugendhilfe, demzufolge die Hilfen zur Erziehung, aber auch Inobhutnahmen, Jugendschutz, Vormundschaften. Geregelt werden darüber hinaus auch sachliche und örtliche Zuständigkeiten und vieles mehr. Kernaufgabe der Jugendhilfe ist es vornehmlich, zugunsten der Kinder zu handeln und den Schutz der Kinder zu gewährleisten.
Immer mehr leibliche Eltern versagen oder sind nicht mehr in der Lage, die eigenen Kinder adäquat zu versorgen. Frühe traumatische Erfahrungen, wie beispielsweise Vernachlässigung, körperliche, psychische und/oder sexuelle Gewalt, unzureichende Förderung, Versorgungsmängel aber auch Trennungserfahrungen wirken ein Leben lang auf die Kinder ein und verändern ihr Sozial- und auch ihr Bindungsverhalten, indes wird auch ihr Leistungsverhalten beeinflusst. Der häufigste Anlass für eine Aufnahme in einer Pflegefamilie ist eine Gefährdung des Kindeswohls. Kinder brauchen ein Zuhause um sich entwickeln zu können. Ziele der Vollzeitpflege nach § 33 SGV VIII, sind prinzipiell unterschiedlich, möglich ist eine befristete Vollzeitpflege (Bereitschaftspflege) für Kinder und Jugendliche, die für kurze Zeit nicht in ihrer eigenen Familie leben können. In diesem Fall hat die Pflegefamilie die Aufgabe, dem Kind für diesen begrenzten Zeitraum, meist bis zu sechs Monaten, einen geschützten Bereich zu bieten. Hintergrund für befristete Vollzeitpflegen sind fast immer akute familiäre Belastungssituationen oder Krisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Kooperationsbereitschaft und Scheitern
- Scheitern als relative Größe
- Scheitern: Chancen für eine neue Entwicklung
- Scheitern in der Handlungstheorie
- Graduelles Scheitern und neue Handlungsmöglichkeiten
- Abbruch des Pflegeverhältnisses als Prozess
- Herausnahme aus der Pflegefamilie
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit den Ursachen für das Scheitern von Pflegeverhältnissen. Die Autorin analysiert die sozialen Strukturen der Pflegefamilie, die Herausforderungen der Sozialisation und die Faktoren, die zu einem Abbruch des Pflegeverhältnisses führen können. Darüber hinaus werden die Perspektiven des Scheiterns aus verschiedenen theoretischen Ansätzen beleuchtet, wie der Handlungstheorie und der pragmatischen Handlungstheorie.
- Analyse der sozialen Strukturen der Pflegefamilie
- Herausforderungen der Sozialisation von Pflegekindern
- Faktoren, die zum Scheitern von Pflegeverhältnissen beitragen
- Theoretische Perspektiven auf den Begriff des Scheiterns
- Bedeutung des Scheiterns für die Entwicklung von Pflegekindern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen des Scheiterns von Pflegeverhältnissen in Pflegefamilien. Sie erläutert die Bedeutung des Themas und stellt den rechtlichen Rahmen der Jugendhilfe im Kontext der Vollzeitpflege vor.
Hauptteil
Der Hauptteil befasst sich mit den Herausforderungen und Problemen, die im Zusammenhang mit Pflegeverhältnissen auftreten können. Er analysiert die Rolle der Pflegeeltern, die Herausforderungen der Sozialisation von Pflegekindern und die Faktoren, die zum Scheitern von Pflegeverhältnissen beitragen können. Des Weiteren werden verschiedene theoretische Perspektiven auf den Begriff des Scheiterns aus der Psychologie und Soziologie beleuchtet.
- Kooperationsbereitschaft und Scheitern: Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Pflegeeltern, Fachdiensten und Jugendhilfe für den Erfolg des Pflegeverhältnisses.
- Scheitern als relative Größe: Die subjektive Perspektive des Scheiterns und seine Bedeutung für die Entwicklung von Pflegekindern.
- Scheitern: Chancen für eine neue Entwicklung: Die Möglichkeit des Abbruchs eines Pflegeverhältnisses als Chance für eine neue Entwicklung des Kindes.
- Scheitern in der Handlungstheorie: Die pragmatische Handlungstheorie von Mead und die Bedeutung des Scheiterns für das menschliche Handeln.
- Graduelles Scheitern und neue Handlungsmöglichkeiten: Die Rolle des Scheiterns als Ausgangspunkt für neue Handlungsoptionen und Perspektiven.
- Abbruch des Pflegeverhältnisses als Prozess: Die verschiedenen Gründe für einen Abbruch des Pflegeverhältnisses und die Auswirkungen auf alle Beteiligten.
- Herausnahme aus der Pflegefamilie: Die Herausnahme des Kindes aus der Pflegefamilie als Maßnahme, wenn das Pflegeverhältnis nicht mehr gewährleistet werden kann.
Schlüsselwörter
Pflegeverhältnisse, Pflegefamilien, Sozialisation, Jugendhilfe, Scheitern, Handlungstheorie, Krisenbewältigung, Abbruch, Herausnahme, Perspektivplanung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die häufigsten Gründe für die Aufnahme in eine Pflegefamilie?
Der häufigste Anlass ist eine Gefährdung des Kindeswohls durch Vernachlässigung, Gewalt oder die Unfähigkeit der leiblichen Eltern, das Kind adäquat zu versorgen.
Warum scheitern manche Pflegeverhältnisse?
Gründe können mangelnde Kooperation zwischen Beteiligten, Überforderung der Pflegeeltern durch Traumata des Kindes oder strukturelle Probleme in der Jugendhilfe sein.
Was versteht man unter § 33 SGB VIII?
Dieser Paragraf regelt die Vollzeitpflege als Form der Hilfe zur Erziehung, bei der ein Kind zeitlich befristet oder dauerhaft in einer anderen Familie lebt.
Kann das Scheitern eines Pflegeverhältnisses auch eine Chance sein?
Die Arbeit beleuchtet die Perspektive, dass ein Abbruch (Herausnahme) manchmal notwendig ist, um eine passendere Umgebung für die Entwicklung des Kindes zu finden.
Wie wirken sich frühe Traumata auf Pflegekinder aus?
Traumatische Erfahrungen können das Sozial-, Bindungs- und Leistungsverhalten lebenslang beeinflussen und stellen hohe Anforderungen an die pädagogischen Fähigkeiten der Pflegeeltern.
- Arbeit zitieren
- Marina Zuber (Autor:in), 2018, Ursachen für das Scheitern vieler Pflegeverhältnisse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387637