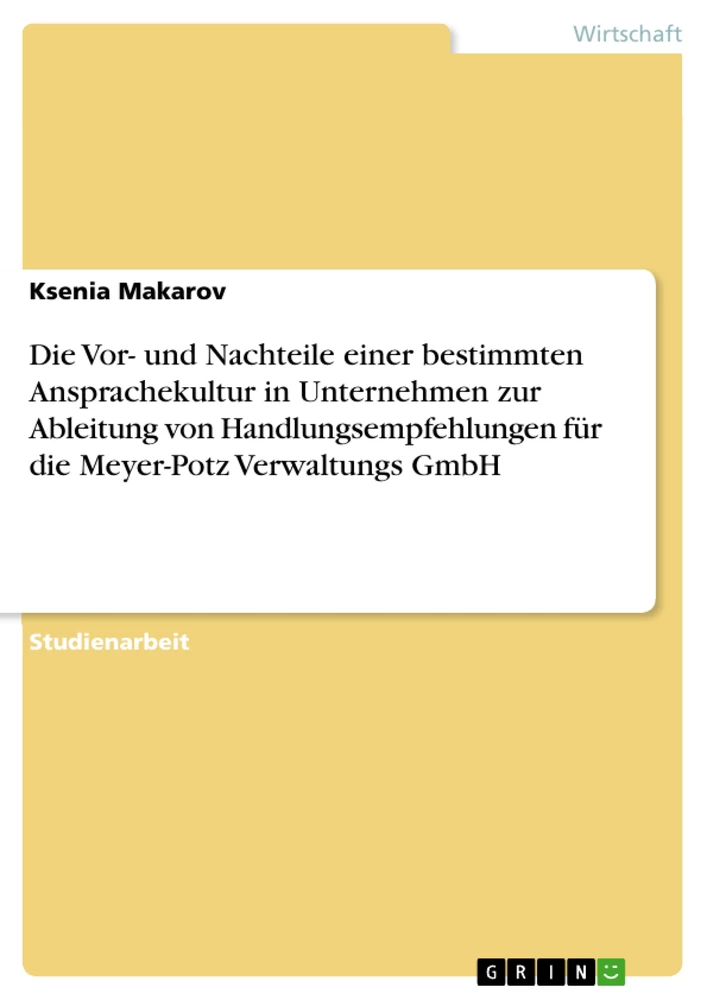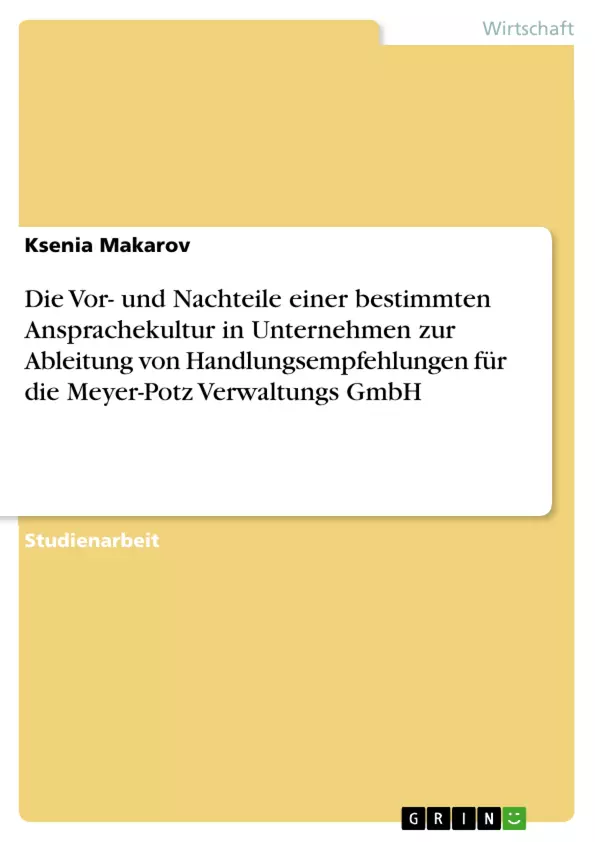Ziel dieser Studienarbeit ist es, zunächst eine Beurteilung der Vor- und Nachteile der Ansprachen „Du“ und „Sie“ durchzuführen. Es gilt, in der darauffolgenden Bachelorthesis eine grundlegende Empfehlung zur Einführung oder Nichteinführung des Duzens in der Meyer Potz GmbH abgeben zu können. Hieraus ergibt sich folgende Forschungsfrage: Welche Vor- und Nachteile lassen sich bei der Ansprache per Du in deutschsprachigen Unternehmen mit einer Mitarbeiteranzahl ab 50 Beschäftigten im Hinblick auf die Gewinnung, die Bindung und das Engagement dieser im Unternehmen feststellen?
Im ersten Kapitel wird die Anredeform anhand des sprachwissenschaftlichen Kontextes erläutert. Dabei gilt es, herauszustellen, welche Bedeutung die Ansprache in der Vergangenheit hatte und welcher Stellenwert ihr gegenwärtig im Sprachgebrauch zugewiesen wird. Daraufhin soll die Verbreitung des Siezens und Duzens im deutschsprachigen Raum skizziert werden. Im zweiten Kapitel wird nach den Gründen für den Wandel der Ansprachekultur geforscht. Es gilt, mögliche Konsequenzen für den Arbeitsmarkt herauszustellen. Dabei wird der Wandel der Arbeitnehmer- wie auch der Arbeitgebergenerationen dargestellt. Gemäß dessen können notwendige Veränderungen im Hinblick auf die Kommunikationskultur im Allgemeinen und die des Duzens und Siezens im Besonderen herausgearbeitet werden. Das dritte Kapitel behandelt die Einführung des Personalpronomens „Du“ als Voraussetzung zur Optimierung der Motivationsfaktoren von Mitarbeitern. Um eine Aussage darüber treffen zu können, ob diese Anspracheform ein Erfolgsfaktor sein kann, wird ihr Einfluss auf die drei großen Motivationsziele (a) Rekrutierung, (b) Bindung und (c) Engagement der Mitarbeiter betrachtet. Das darauffolgende Kapitel beschäftigt sich mit der Anrede im angloamerikanischen Sprachraum. Es werden Erkenntnisse und Vorgehensweisen aus diesem Sprachgebrauch auf ihre Anwendungsmöglichkeiten in deutschen Unternehmen hin überprüft. Hierbei liegt der Fokus auf der Herausstellung sprachlicher und kultureller Unterschiede und der Ableitung von Erkenntnissen für den deutschen Sprachraum. Im letzten Kapitel erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse anhand derer die möglichen Vor-und Nachteile einer Du-Ansprache aufgezeigt werden.
Durch das Aufwiegen der Vor- und Nachteile soll dann eine vorläufige Empfehlung im Hinblick auf die zukünftig anzustrebende Anredeform in der Meyer-Potz GmbH gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anredeformen
- Definitionen und Abgrenzungen der Anrede
- Historischer Hintergrund und Entwicklung
- Verwendung der Anredepronomen im heutigen Sprachgebrauch
- Versuch einer Trendanalyse und Herleitung entstehender Konsequenzen für den Arbeitsmarkt
- Die Globalisierung und der Wertewandel
- Das Unternehmen der Zukunft
- Der Arbeitnehmer der Zukunft
- Mögliche Auswirkungen auf die Kommunikationskultur
- Du-Ansprache als Motivationsfaktor
- Anredeformen im angloamerikanischem Sprachraum
- Kommunikation mit Briten
- Kommunikation mit Amerikanern
- Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile
- Vorläufige Empfehlung an die Meyer Potz Verwaltungs GmbH
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit analysiert die Vor- und Nachteile einer bestimmten Ansprachekultur in Unternehmen, um Handlungsempfehlungen für die Meyer-Potz Verwaltungs GmbH abzuleiten. Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Anspracheformen im Kontext gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Veränderungen. Dabei werden die aktuellen Trends in der Arbeitswelt sowie die Auswirkungen der Globalisierung und des Wertewandels auf die Unternehmenskommunikation beleuchtet.
- Die Bedeutung von Anredeformen in der Unternehmenskultur
- Die Entwicklung der Anredeformen im historischen Kontext
- Die Auswirkungen von Globalisierung und Wertewandel auf die Ansprachekultur
- Die Bedeutung der Du-Ansprache als Motivationsfaktor
- Die Vor- und Nachteile der Du- und Sie-Ansprache im Vergleich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und beleuchtet die aktuelle Debatte über die Veränderung der Anspracheformen in Unternehmen.
Das Kapitel „Anredeformen“ beschäftigt sich mit der Definition und Abgrenzung der Anredeformen sowie deren historischer Entwicklung.
Das Kapitel „Versuch einer Trendanalyse“ befasst sich mit der Frage, wie die Globalisierung und der Wertewandel die Ansprachekultur im Unternehmen beeinflussen.
Das Kapitel „Du-Ansprache als Motivationsfaktor“ analysiert die Möglichkeiten der Du-Ansprache als Mittel zur Motivation und Teambildung.
Das Kapitel „Anredeformen im angloamerikanischem Sprachraum“ untersucht die Anspracheformen in britischen und amerikanischen Unternehmen.
Das Kapitel „Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile“ bietet einen Überblick über die jeweiligen Vorteile und Nachteile der Du- und Sie-Ansprache.
Schlüsselwörter
Ansprachekultur, Unternehmenskommunikation, Anredeformen, Du- und Sie-Ansprache, Globalisierung, Wertewandel, Arbeitsmarkt, Motivation, Führungsstil, Unternehmenskultur.
Häufig gestellte Fragen
Sollte man sich im Unternehmen duzen oder siezen?
Die Arbeit wägt die Vor- und Nachteile beider Formen ab, insbesondere im Hinblick auf Mitarbeiterbindung, Engagement und Rekrutierung.
Welche Vorteile bietet die Du-Ansprache?
Das "Du" kann Barrieren abbauen, das Teamgefühl stärken und wird oft von jüngeren Generationen als motivierender empfunden.
Wie beeinflusst die Globalisierung die Ansprachekultur?
Der angloamerikanische Einfluss (das universelle "You") führt in deutschen Unternehmen zunehmend zu einer Lockerung der förmlichen Sie-Kultur.
Was sind die Risiken des Duzens im Beruf?
Es kann zu einem Verlust an professioneller Distanz und Respekt führen, was besonders in Konfliktsituationen oder Hierarchien problematisch sein kann.
Gibt es branchenspezifische Unterschiede bei der Anrede?
Ja, während Start-ups und kreative Branchen oft das "Du" bevorzugen, halten traditionelle Sektoren wie Banken oder Verwaltungen häufiger am "Sie" fest.
- Quote paper
- Ksenia Makarov (Author), 2017, Die Vor- und Nachteile einer bestimmten Ansprachekultur in Unternehmen zur Ableitung von Handlungsempfehlungen für die Meyer-Potz Verwaltungs GmbH, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/387704