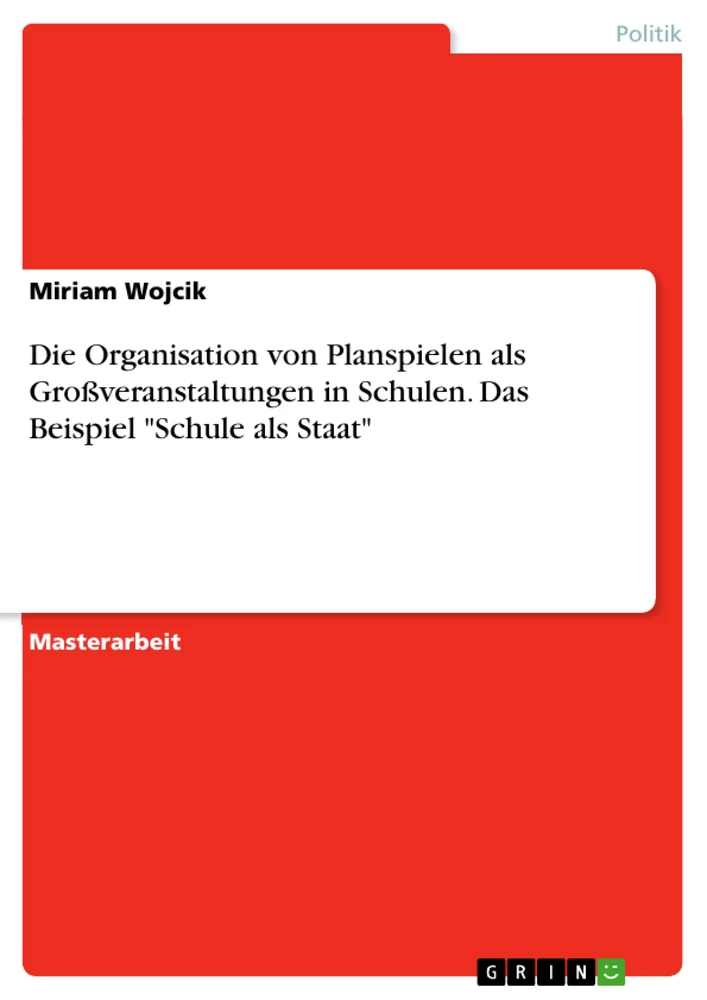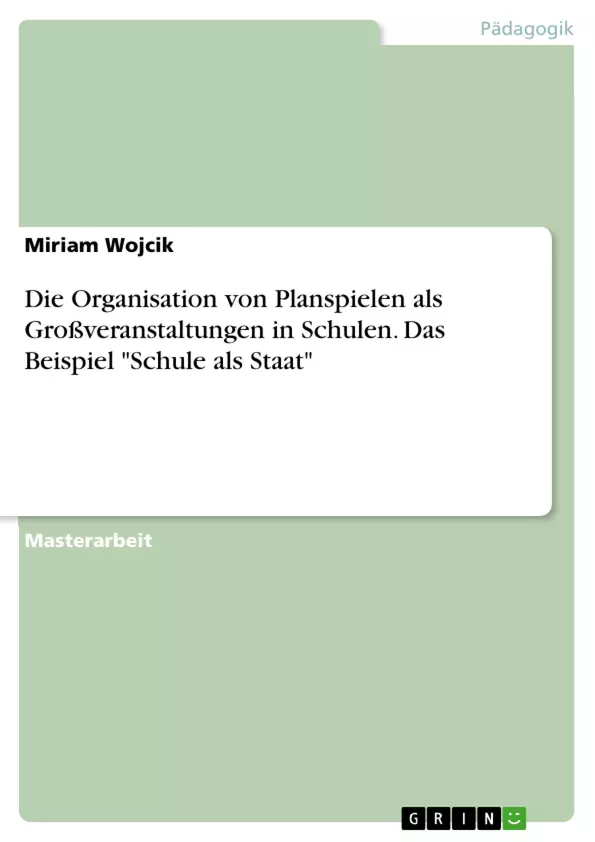Für mehrere Tage verwandelt sich die Schule in einen eigenständigen Staat mit all seinen Funktionen. Es werden staatlich-politische sowie wirtschaftliche und ökonomische Zusammenhänge dargestellt. Entscheidungsprozesse werden erprobt und staatliche Organisationen für die Teilnehmer/innen erlebbar gemacht. Im Vorfeld werden eine Verfassung, ein Finanzsystem und Parteien ausgearbeitet, ein Wahlkampf geführt und ein Parlament gegründet. Eine Staatsflagge und Staatshymne werden ebenfalls ausgearbeitet. Es werden staatliche und nichtstaatliche Betriebe gegründet, in denen Schüler/innen und Lehrer/innen gemeinsam arbeiten. Dabei bilden die Schüler/innen und Lehrer/innen ein gleichberechtigtes Volk. Hier liegt auch eine der Besonderheiten dieser Simulation. Lehrer/innen geben einen Teil ihrer Autorität an die Schüler/innen ab. Die starke Schülerorientierung soll dabei auf keinen Fall auf eine geringe Strukturierung hindeuten. Damit soll vielmehr der Aktivierungs- und Motivationsgrad der Schülerinnen und Schüler gesteigert und Ideen der Lernenden umgesetzt und erprobt werden
Inhaltsverzeichnis
- Theoretischer Teil
- 1. Einleitung
- 2. Die Planspielmethode
- 2.1 Begriffserklärung
- 2.2 Herkunft und Entwicklung der Methode
- 2.3 Aufbau von Planspielen
- 2.4 Einsatzmöglichkeiten von Planspielen
- 3. Das Planspiel in der Schule
- 3.1. Methodische Einordnung
- 3.2 Ziele von Planspielen
- 3.2 Vorteile und Nachteile von Planspielen
- 3.3 Ziele der schulischen Bildung
- 3.3.1 Schulgesetz
- 3.3.2 Lehrplan Gemeinschaftskunde
- 3.4. Stärken und Schwächen bei Großveranstaltungen in Schulen
- 4. Die Konzeption des Planspiels „Schule als Staat“
- 4.1 Spielvorbereitung
- 4.1.1 Aufgabenmanagement
- 4.1.2 Grundelemente für „Schule als Staat“
- 4.2 Einführungsphase
- 4.2.1 Politikbereich
- 4.2.2 Wirtschaftsbereich
- 4.2.3 Gesellschaftsbereich
- 4.3 Spielphase
- 4.3.1 Staatsalltag
- 4.3.2 Staatsfeiertag
- 4.4 Auswertungsphase
- 4.4.1 Emotionale Auswertung
- 4.4.2 Inhaltliche Auswertung
- 4.4.3 Organisatorische Auswertung
- Methodischer Teil
- 5. Methodisches Vorgehen zur Erhebung von Einflussfaktoren auf den Erfolg von „Schule als Staat“
- 5.1 Erhebungsmethode 1: Strukturierte Beobachtung
- 5.1.1 Beobachtungskriterien
- 5.1.2 Teilnehmende Beobachtung
- 5.2 Erhebungsmethode 1: Leitfrageninterviews
- 5.2.1 Instrument Leitfragenentwicklung
- 5.2.2 Durchführung der Interviews
- 5.2.3 Analyseschritte
- 6. Die Praktische Durchführung von „Schule als Staat“ im Vergleich an zwei Gymnasien
- 6.1 Durchführung an Schule A in Baden-Württemberg
- 6.1.1 Vorbereitung
- 6.1.2 Einführungsphase
- 6.1.3 Spielphase
- 6.1.4 Reflexion
- 6.2 Durchführung an Schule B in Rheinland Pfalz
- 6.2.1 Vorbereitung
- 6.2.2 Einführungsphase
- 6.2.3 Spielphase
- 6.2.4 Reflexion
- 7. Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei der Umsetzung des Projektes „Schule als Staat“
- 7.1 Vorbereitung
- 7.1.1 Projektziele
- 7.2 Einführung / Spielphase
- 7.3 Debriefing / Reflexionsphase
- 8. Schwierigkeiten und Lösungsansätze beim Planspiels „Schule als Staat“
- 8.1 Vorbereitung
- 8.1.1 Steuerungsgruppe
- 8.1.2 Lernzielformulierung
- 8.1.3 Verfassung, Politik und Wirtschaft
- 8.1.4 Betriebsgründung
- 8.2 Einführung / Spielphase
- 8.2.1 Eröffnungsfeier
- 8.2.2 Staatsalltag
- 8.3 Debriefing / Reflexionsphase
- 8.3.1 Kommunikation in Projekten
- 9. Schluss
- Die methodische Einordnung und Bedeutung von Planspielen im Bildungsbereich
- Die Herausforderungen und Chancen der Organisation von Planspielen als Großveranstaltungen in Schulen
- Die Konzeption und Umsetzung des Planspiels "Schule als Staat" als Beispiel für eine erfolgreiche Anwendung
- Die Analyse von Erfolgsfaktoren und Einflussgrößen auf die Durchführung von Planspielen im Schulumfeld
- Die Herausarbeitung von Problemen und Lösungsansätzen für die Organisation und Durchführung von Planspielen als Großveranstaltungen in Schulen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Organisation von Planspielen als Großveranstaltungen in Schulen anhand des Beispiels "Schule als Staat". Sie analysiert die methodischen Grundlagen und Einsatzmöglichkeiten von Planspielen im Bildungskontext sowie die konkreten Herausforderungen und Lösungsansätze bei der Durchführung eines solchen Planspiels im Schulumfeld.
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen der Planspielmethode beleuchtet. Es wird auf den Begriff, die Herkunft und Entwicklung der Methode sowie auf die Gestaltung von Planspielen eingegangen. Anschließend wird die Anwendung von Planspielen in der Schule mit Fokus auf deren methodische Einordnung, Ziele, Vorteile und Nachteile sowie die Integration in den Lehrplan beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich der detaillierten Konzeption des Planspiels "Schule als Staat". Es werden die einzelnen Phasen der Spielvorbereitung, der Einführungsphase, der Spielphase und der Auswertungsphase vorgestellt. Im methodischen Teil werden die Erhebungsmethoden zur Analyse von Einflussfaktoren auf den Erfolg des Planspiels vorgestellt.
Kapitel 6 beschreibt die praktische Durchführung des Planspiels an zwei verschiedenen Gymnasien und beleuchtet dabei die Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei der Umsetzung. Kapitel 7 geht detailliert auf die Schwierigkeiten und Lösungsansätze bei der Durchführung des Planspiels "Schule als Staat" ein.
Schlüsselwörter
Planspielmethode, Großveranstaltungen, Schule, Bildung, "Schule als Staat", Methodenentwicklung, Methodische Einordnung, Ziele von Planspielen, Stärken und Schwächen, Konzeption, Einführungsphase, Spielphase, Auswertungsphase, Erfolgsfaktoren, Einflussgrößen, Schwierigkeiten, Lösungsansätze.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Planspiel „Schule als Staat“?
Es ist eine mehrtägige Simulation, bei der sich eine Schule in einen eigenständigen Staat mit eigener Verfassung, Währung, Parlament und Wirtschaftssystem verwandelt.
Welche Lernziele werden mit diesem Planspiel verfolgt?
Schüler sollen politische und ökonomische Zusammenhänge spielerisch erleben, Entscheidungsprozesse erproben und ihre Eigenverantwortung und Motivation stärken.
Wie verändert sich die Rolle der Lehrer während der Simulation?
Lehrer geben einen Teil ihrer Autorität ab und werden zu gleichberechtigten Bürgern des Staates, was die Schülerorientierung des Projekts unterstreicht.
Was sind die Phasen bei der Durchführung von „Schule als Staat“?
Das Projekt gliedert sich in Spielvorbereitung (Aufgabenmanagement), Einführungsphase (Politik/Wirtschaft), die eigentliche Spielphase (Staatsalltag) und die Auswertung (Reflexion).
Welche Schwierigkeiten können bei der Organisation auftreten?
Herausforderungen liegen oft im komplexen Aufgabenmanagement, der Finanzierung, der Kommunikation innerhalb der Steuerungsgruppe und der Einhaltung der Verfassung im Staatsalltag.
- Quote paper
- Miriam Wojcik (Author), 2016, Die Organisation von Planspielen als Großveranstaltungen in Schulen. Das Beispiel "Schule als Staat", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388129