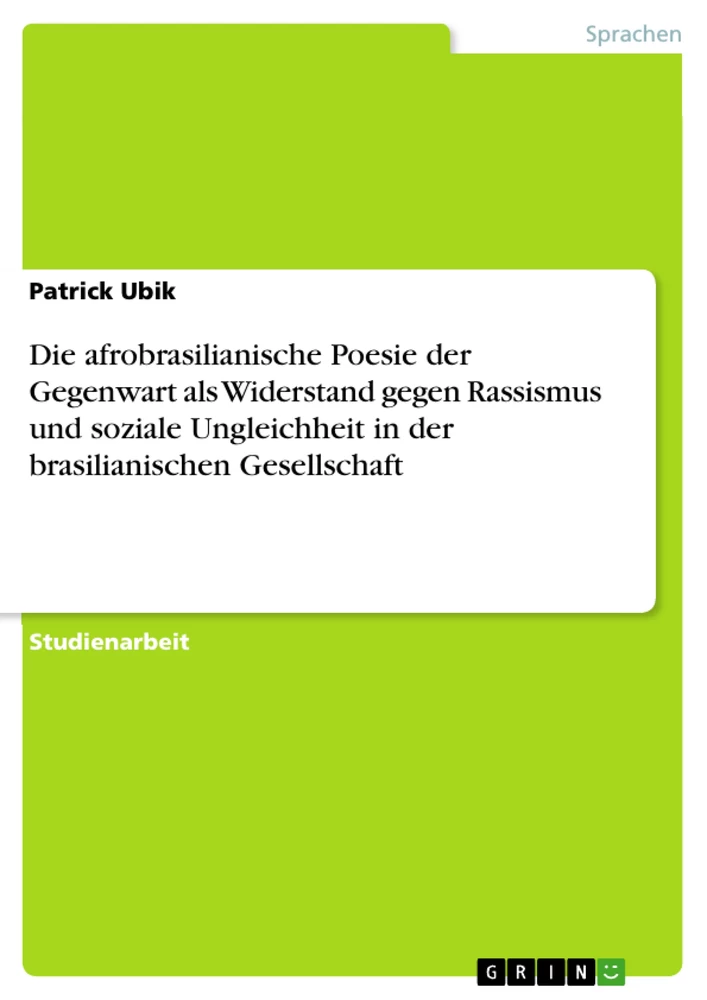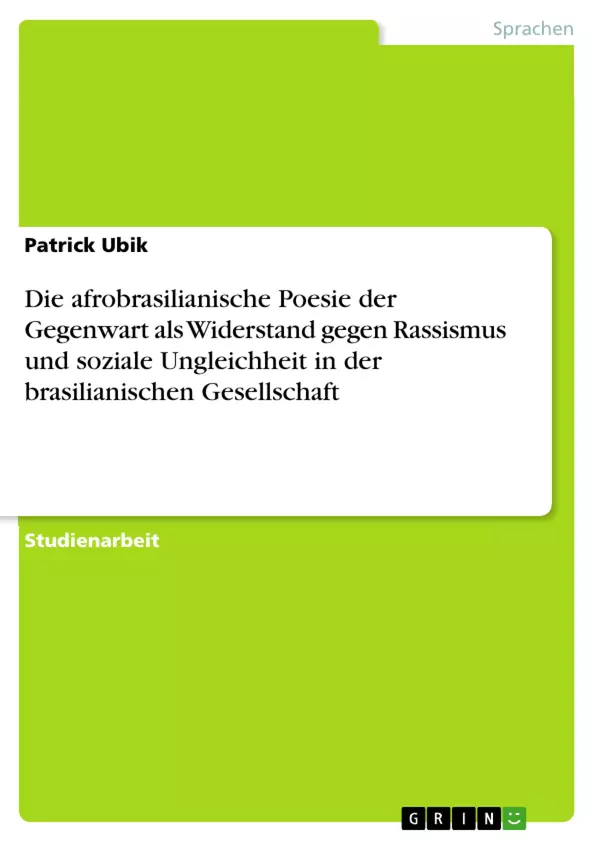„Der Kampf der schwarzen Bevölkerung in Brasilien ist so alt wie das Land selbst“. Dies gab ein Interview mit dem brasilianischen Schriftsteller, Poeten und Dramaturgen Luiz Silva, der sich nach seinem Pseudonym „Cuti“ betiteln lässt, hervor. Alle Bausteine dieser facettenreichen Aussage hängen mit dem Thema der vorliegenden Seminararbeit zusammen. Im Vordergrund stehen hier die afrobrasilianische Bevölkerung und ihr Kampf gegen sozioökonomische Begebenheiten, die in der Geschichte Brasiliens begründet liegen. In diesem Kontext soll der Zusammenhang der Begriffe „Rassendiskriminierung“ und „soziale Ungleichheit“ in dem Land genauer erforscht werden, denn es erscheint wichtig herauszufinden, ob Brasiliens soziale Ungleichheit auf die Diskriminierung phänotypischer Merkmalsträger zurückzuführen ist.
Nachdem die sozialen Probleme erläutert und zu deren Nachvollzug ein historischer Rückblick skizziert worden ist, wird ein Bogen zur Gegenwart gespannt, denn die Leitfrage richtet sich hier nach der kontemporären poesía negra, bzw. afrobrasilianischen oder „schwarzen“ Lyrik. Es soll geklärt werden, in welchem Zusammenhang diese mit der in den Köpfen der brasilianischen Gesellschaft verankerten Ideologie der Identität steht und inwiefern sie als mögliche Antwort auf die sozialen Missstände fungiert. Wie ist die schwarze Lyrik entstanden? Mit welchen Absichten wird sie produziert? und welche Auswirkungen hat sie auf die Gesellschaft? sind zentrale Fragen, die hier geklärt versucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das umstrittene Konzept „Lusotropicalismo“
- Rassendiskriminierung und soziale Ungleichheit in Brasilien
- Die Historiographie der Sklaverei und des Widerstands
- Der Mythos der Rassendemokratie
- Afrobrasilianische Poesie der Gegenwart
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die afrobrasilianische Poesie der Gegenwart und ihre Rolle im Widerstand gegen Rassismus und soziale Ungleichheit in Brasilien. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Landes und untersucht, inwieweit die in der brasilianischen Gesellschaft verankerte Ideologie der Identität die schwarze Lyrik beeinflusst. Die Arbeit stellt die Frage, wie die schwarze Lyrik entstanden ist, mit welchen Absichten sie produziert wird und welche Auswirkungen sie auf die Gesellschaft hat.
- Die historische Entwicklung von Rassendiskriminierung und sozialer Ungleichheit in Brasilien
- Die Kritik am Konzept des "Lusotropicalismo" und seine Auswirkungen auf die brasilianische Identität
- Die afrobrasilianische Poesie der Gegenwart als Form des Widerstands gegen Rassismus und soziale Ungleichheit
- Die Rolle der schwarzen Lyrik in der brasilianischen Gesellschaft
- Die Beziehung zwischen schwarzer Lyrik und der Ideologie der Identität in Brasilien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt das Thema der afrobrasilianischen Poesie der Gegenwart im Kontext der sozialen Ungleichheit in Brasilien vor. Sie beleuchtet die Geschichte des Kampfes der schwarzen Bevölkerung in Brasilien und die Bedeutung der Begriffe "Rassendiskriminierung" und "soziale Ungleichheit" im Land.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem umstrittenen Konzept des "Lusotropicalismo", das von Gilberto Freyre geprägt wurde. Es werden die zentralen Behauptungen des Konzepts analysiert, die ein positives Bild von der portugiesischen Kolonisation Brasiliens zeichnen. Der Text beleuchtet die Kritik an diesem Konzept, die die Realität der sozialen Ungleichheit und des Rassismus in Brasilien hervorhebt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit Rassendiskriminierung und sozialer Ungleichheit in Brasilien. Es analysiert die historische Entwicklung der Sklaverei und des Widerstands sowie den Mythos der Rassendemokratie in Brasilien. Die Arbeit beleuchtet die soziologischen und politischen Faktoren, die die soziale Ungleichheit in Brasilien geprägt haben.
Schlüsselwörter
Afrobrasilianische Poesie, Rassismus, soziale Ungleichheit, Lusotropicalismo, Gilberto Freyre, Rassendemokratie, Sklaverei, Widerstand, Identität, brasilianische Gesellschaft, poesía negra.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Arbeit zur afrobrasilianischen Poesie?
Die Arbeit untersucht die zeitgenössische afrobrasilianische Lyrik (poesía negra) als Form des Widerstands gegen Rassismus und soziale Ungleichheit in Brasilien.
Was versteht man unter dem Konzept "Lusotropicalismo"?
Es ist ein von Gilberto Freyre geprägtes Konzept, das ein positives Bild der portugiesischen Kolonisation zeichnet, jedoch wegen der Verschleierung von Rassismus kritisiert wird.
Was ist der "Mythos der Rassendemokratie" in Brasilien?
Es ist die Vorstellung, dass in Brasilien aufgrund der Rassenmischung keine signifikante Rassendiskriminierung existiert – ein Mythos, den die Arbeit kritisch hinterfragt.
Wie entstand die moderne schwarze Lyrik in Brasilien?
Die schwarze Lyrik entwickelte sich aus dem historischen Kampf gegen Sklaverei und soziale Ausgrenzung und dient heute als Stimme für Identität und Gleichberechtigung.
Welche Rolle spielt die Identität in dieser Poesie?
Die Poesie hilft dabei, eine afrobrasilianische Identität zu festigen und dient als Antwort auf die in der Gesellschaft verankerten Ideologien der Ungleichheit.
- Citation du texte
- Patrick Ubik (Auteur), 2018, Die afrobrasilianische Poesie der Gegenwart als Widerstand gegen Rassismus und soziale Ungleichheit in der brasilianischen Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388198