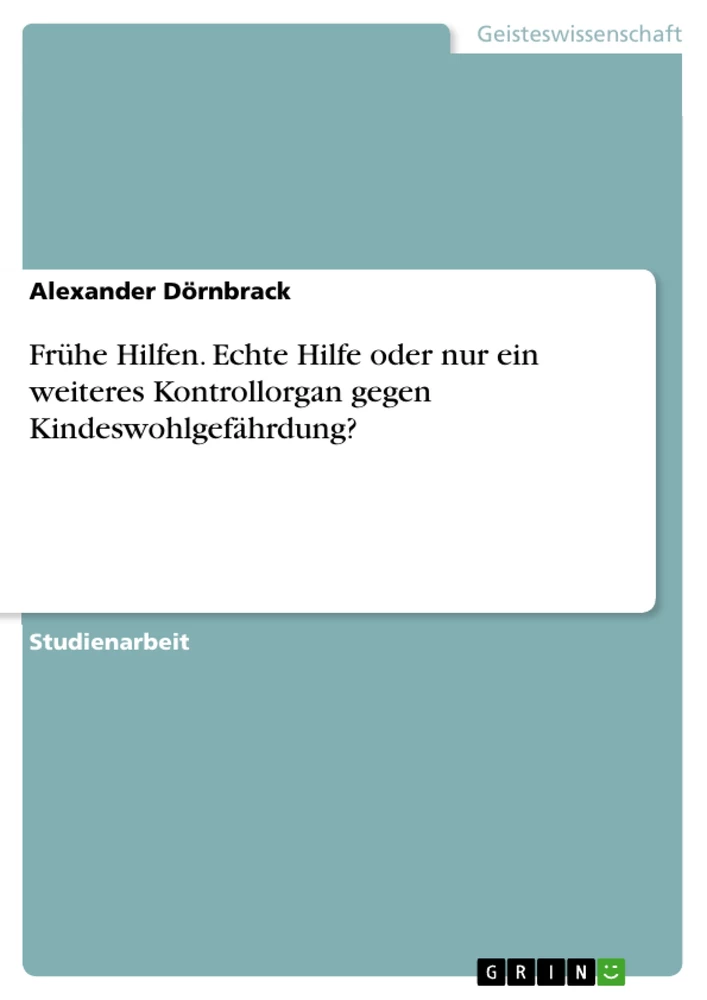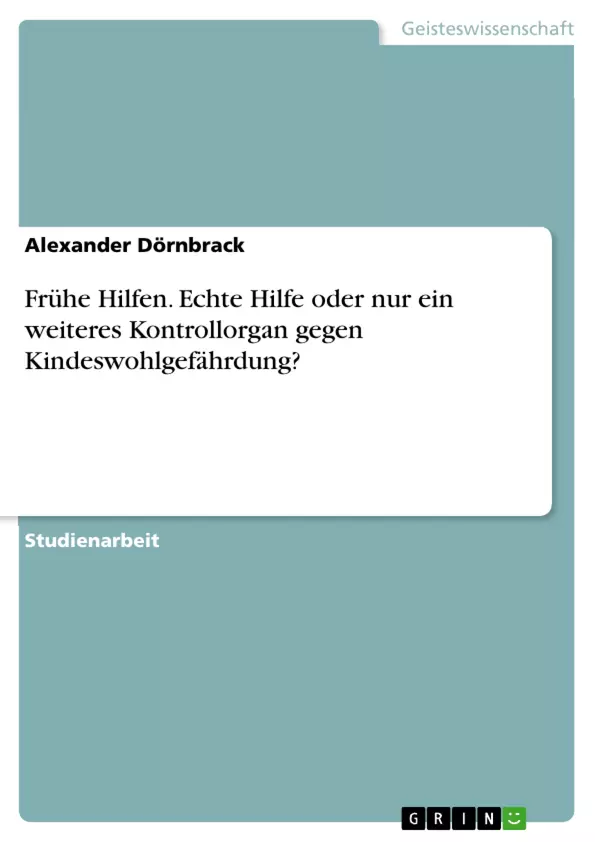Die hier aufgeworfene Fragestellung befasst sich mit einem der brisantesten Handlungsfelder im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Im Rahmen meiner Studien für diese Arbeit bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sowohl die Intention und Konzeption, welche den Frühen Hilfen zugrunde liegen, als auch die gesetzlichen Veränderungen durch das BKiSchG dafür geeignet sind, Fälle von Kindeswohlgefährdung in einem frühen Stadium zu erkennen, und diese ebenso die Möglichkeit bieten, einer Kindeswohlgefährdung aktiv entgegenwirken zu können. Durch das BKiSchG wird in Form der Frühen Hilfen ein präventives und niedrigschwelliges Angebot im Katalog der Kinder- & Jugendhilfe installiert, welches darauf ausgerichtet ist, Fehlentwicklung innerhalb Familiensystemen im Sinne der Kinder frühzeitig und direkt entgegenzuwirken, um so langwierige wie kostenintensive Interventionen zu einem späteren Zeitpunkt zu vermeiden.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Begriffsklärung
- Kindeswohlgefährdung
- Frühe Hilfen
- Gesetzliche Rahmenbedingungen
- Entstehungshintergrund des BKiSchG
- Rolle der Frühen Hilfen nach dem BKISCHG
- Überblick über die Strukturen und Akteure in den Frühen Hilfen
- Netzwerkstrukturen der Frühen Hilfen durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen/Familienhebammen
- Wirkung der Frühen Hilfen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Wirksamkeit von Frühen Hilfen als Instrument zur Prävention von Kindeswohlgefährdung. Im Zentrum steht die Frage, ob die durch das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) gestärkten Frühen Hilfen eine effektive Maßnahme zur frühzeitigen Erkennung und Intervention bei Kindeswohlgefährdung darstellen.
- Analyse des Konzepts und der Ziele von Frühen Hilfen
- Bewertung der Auswirkungen des BKiSchG auf die Frühen Hilfen
- Beurteilung der Netzwerkarbeit im Bereich der Frühen Hilfen
- Untersuchung der Finanzierungsmodelle und deren Auswirkungen
- Bewertung der Rolle der Familienhebammen im Kontext der Frühen Hilfen
Zusammenfassung der Kapitel
- Zusammenfassung der Ergebnisse: Die Einleitung legt die zentrale Fragestellung dar und stellt die Hypothese auf, dass die Stärkung der Frühen Hilfen durch das BKiSchG ein geeigneter Schritt zur Prävention von Kindeswohlgefährdung ist.
- Begriffsklärung: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Kindeswohlgefährdung und Frühe Hilfen. Es wird die rechtliche Grundlage und die verschiedenen Formen von Kindeswohlgefährdung erläutert.
- Gesetzliche Rahmenbedingungen: Der Entstehungshintergrund des BKiSchG wird dargestellt und die Rolle der Frühen Hilfen im neuen Gesetz beschrieben. Der Text stellt die Strukturen und Akteure der Frühen Hilfen vor und erklärt die Bedeutung der Netzwerkstrukturen, die durch die Bundesinitiative Frühe Hilfen/Familienhebammen gefördert werden.
- Wirkung der Frühen Hilfen: Das Kapitel analysiert die Auswirkungen der Frühen Hilfen auf die Prävention von Kindeswohlgefährdung. Es untersucht die Vor- und Nachteile des BKiSchG und befasst sich mit den Herausforderungen der Finanzierung, der Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren und der Rolle der Familienhebammen.
Schlüsselwörter
Kindeswohlgefährdung, Frühe Hilfen, BKiSchG, Familienhebammen, Prävention, Netzwerkstrukturen, Jugendamt, Finanzierungsmodelle, Intervention, Kinderschutz, Familienhilfe.
Häufig gestellte Fragen
Was sind "Frühe Hilfen"?
Frühe Hilfen sind präventive Angebote für Eltern und Kinder ab der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr. Sie zielen darauf ab, Entwicklungschancen frühzeitig zu verbessern und Belastungen abzumildern.
Welche Rolle spielt das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)?
Das BKiSchG hat die Frühen Hilfen gesetzlich verankert und gestärkt, um den Kinderschutz durch Kooperation und frühe Intervention zu verbessern.
Sind Frühe Hilfen ein Kontrollorgan?
Die Arbeit diskutiert, ob Frühe Hilfen primär unterstützend wirken oder als Überwachungsinstrument wahrgenommen werden. Die Intention ist jedoch ein niedrigschwelliges Hilfsangebot.
Was leisten Familienhebammen?
Familienhebammen unterstützen psychosozial belastete Familien über die normale Hebammenhilfe hinaus bis zum ersten Geburtstag des Kindes.
Wie wird Kindeswohlgefährdung definiert?
Kindeswohlgefährdung liegt vor, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl eines Kindes durch das Verhalten der Eltern oder Dritter nachhaltig gefährdet ist.
- Arbeit zitieren
- Alexander Dörnbrack (Autor:in), 2015, Frühe Hilfen. Echte Hilfe oder nur ein weiteres Kontrollorgan gegen Kindeswohlgefährdung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388206