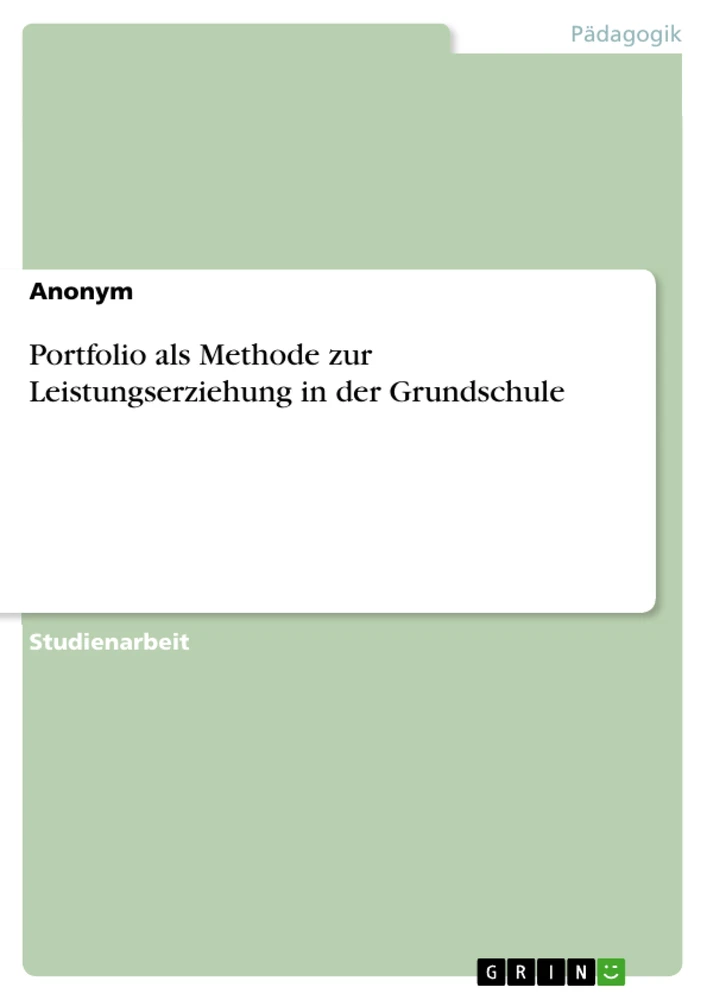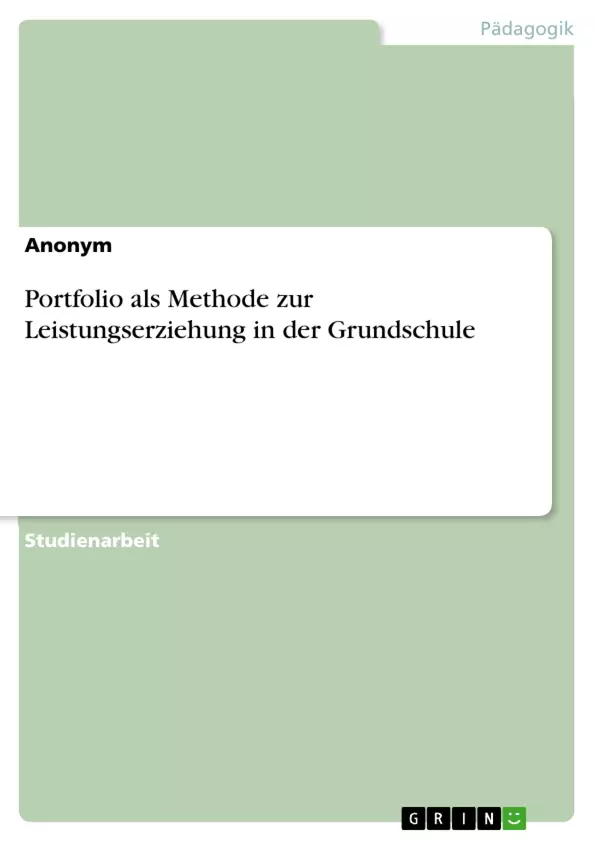Auf der Grundlage der Erziehungsziele einer demokratischen Gesellschaft, die sich der Erziehung zur Mündigkeit und Emanzipation verschrieben haben, begründet Klafki das pädagogische Leistungsverständnis. Inwiefern kann man mit der Portfolioarbeit in der Grundschule dieses Verständnis realisieren?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der pädagogische Leistungsbegriff nach Klafki
- Begriffsbestimmung schulisches Portfolio
- Chancen der Portfoliomethode für die Leistungserziehung
- Prozessorientierung
- Intrinsische Motivation und gemeinsame Aufgabenlösung
- Beteiligung der Schüler_innen bei Zielvereinbarung und Bewertung
- Individualisierung
- Herausforderungen der Portfoliomethode für die Leistungserziehung
- Zeit- und Arbeitsaufwand
- Angemessener Grad an Selbstständigkeit
- Vorgaben und Selektionsauftrag
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht, inwiefern die Unterrichtsmethode „Portfolio“ dem pädagogischen Leistungsbegriff nach Klafki gerecht wird. Hierfür werden der pädagogische Leistungsbegriff und die Portfoliomethode detailliert betrachtet.
- Die Bedeutung des pädagogischen Leistungsbegriffs im Vergleich zum gesellschaftlichen Leistungsverständnis.
- Die Prinzipien des pädagogischen Leistungsbegriffs nach Klafki, die auf Mündigkeit und Emanzipation zielen.
- Die verschiedenen Formen und Einsatzmöglichkeiten von Portfolios im schulischen Kontext.
- Die Chancen der Portfoliomethode für die Realisierung von Klafkis pädagogischem Leistungsbegriff.
- Die Herausforderungen und Kritikpunkte, die mit der Anwendung von Portfolios in der Praxis verbunden sind.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit stellt die Relevanz des Leistungsbegriffs in Schule und Gesellschaft dar und beleuchtet die Unterschiede zwischen dem gesellschaftlichen und dem pädagogischen Leistungsverständnis. Sie führt den Fokus auf das pädagogische Leistungsverständnis nach Klafki und die Untersuchung der Portfoliomethode als geeignete Unterrichtsform für die Umsetzung dieses Ansatzes.
Der pädagogische Leistungsbegriff nach Klafki
Klafki kritisiert das gesellschaftliche Leistungsverständnis, das Chancengleichheit unterstellt, und setzt sich für ein pädagogisches Leistungsverständnis ein, das auf Mündigkeit und Emanzipation zielt. Er definiert vier Prinzipien, die die Schüler_innen in ihrer Entwicklung zu selbstbestimmten und verantwortungsvollen Menschen fördern sollen.
Begriffsbestimmung schulisches Portfolio
Der Begriff des schulischen Portfolios wird erläutert, verschiedene Formen und Ziele von Portfolios werden vorgestellt. Es wird auf die Bedeutung der Sammlung von Arbeitsproben und die Lernreflexion sowie die Rolle der Lehrkraft bei der Rückmeldung eingegangen.
Chancen der Portfoliomethode für die Leistungserziehung
Die Chancen der Portfoliomethode für die Umsetzung der Prinzipien des pädagogischen Leistungsbegriffs nach Klafki werden untersucht. Die Vorteile wie Prozessorientierung, intrinsische Motivation, Schülerbeteiligung und Individualisierung werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Pädagogischer Leistungsbegriff, gesellschaftliches Leistungsverständnis, Klafki, Portfoliomethode, Leistungserziehung, Unterrichtsform, Mündigkeit, Emanzipation, Prozessorientierung, intrinsische Motivation, Schülerbeteiligung, Individualisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der pädagogische Leistungsbegriff nach Klafki?
Klafki versteht Leistung als einen Prozess, der auf die Mündigkeit und Emanzipation der Schüler zielt, statt nur auf gesellschaftliche Selektion und Verwertbarkeit.
Welche Vorteile bietet die Portfoliomethode in der Grundschule?
Sie fördert die Prozessorientierung, die intrinsische Motivation, die Individualisierung des Lernens und die aktive Beteiligung der Kinder an der Bewertung ihrer eigenen Arbeit.
Was sind die Herausforderungen bei der Arbeit mit Portfolios?
Ein hoher Zeit- und Arbeitsaufwand für Lehrkräfte und Schüler sowie die Schwierigkeit, den richtigen Grad an Selbstständigkeit zu finden.
Wie unterstützt das Portfolio die Individualisierung?
Durch die Sammlung individueller Arbeitsproben können Schüler an ihrem eigenen Leistungsstand anknüpfen und ihre persönliche Entwicklung reflektieren.
Was ist das Ziel der Erziehung in einer demokratischen Gesellschaft laut Text?
Die Erziehung zur Mündigkeit, Emanzipation und zur verantwortungsvollen Teilhabe an der Gesellschaft.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Portfolio als Methode zur Leistungserziehung in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388279