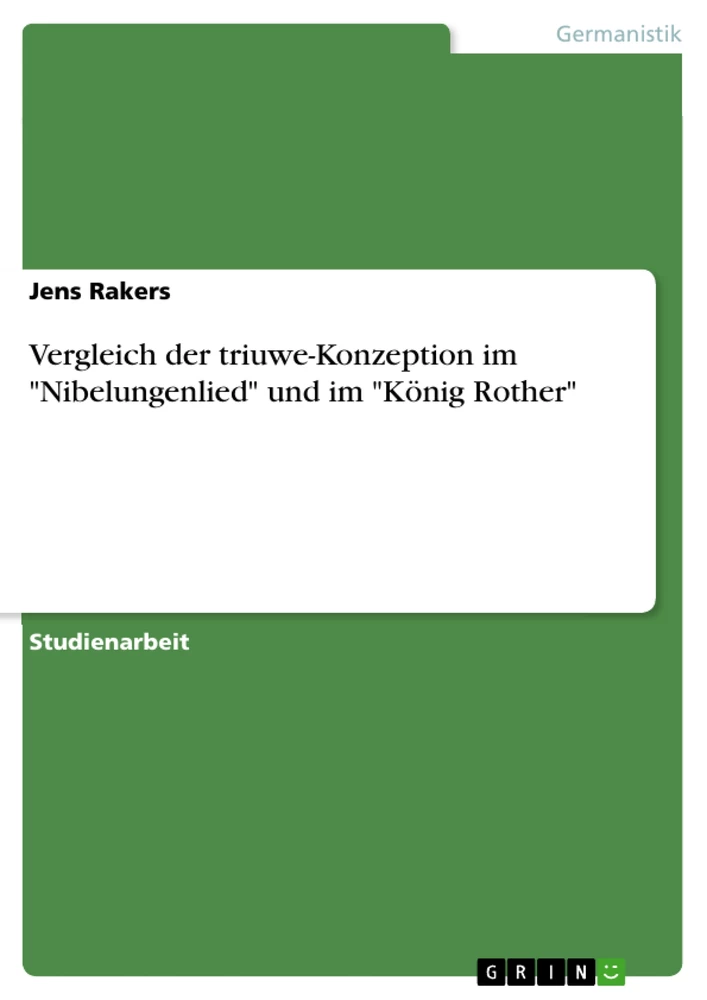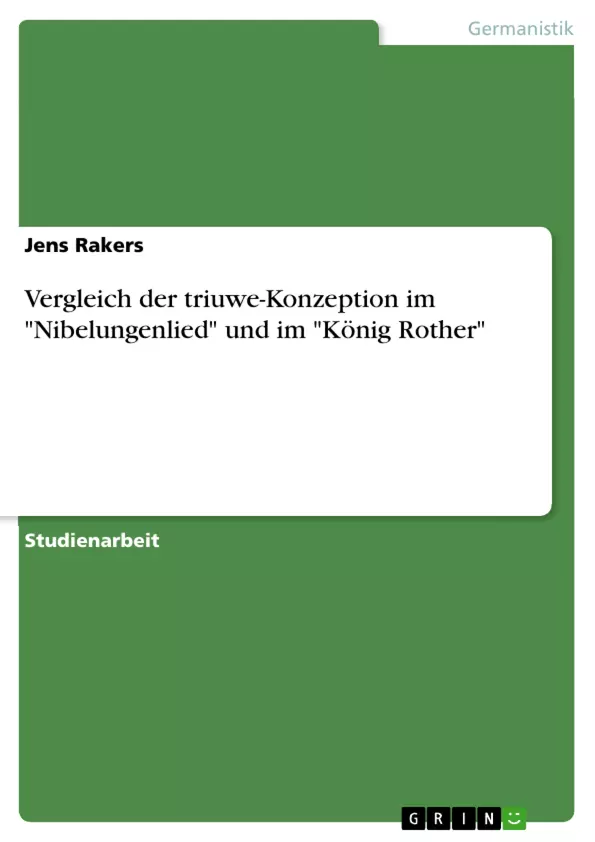In dieser Arbeit werden die Konzeptionen der triuwe im Nibelungenlied und im König Rother analysierend herausgearbeitet und im Anschluss miteinander verglichen. Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet: Inwiefern unterscheiden sich die Konzeptionen der triuwe im Nibelungenlied und im König Rother voneinander?
Um sich der mit dieser Fragestellung verbundenen Zielsetzung inhaltlich zu nähern, ist es im Rahmen des Kapitels 2.1 zunächst erforderlich, eine definitorische Begriffsbestimmung der triuwe vorzunehmen. Daran anschließend wird in Kapitel 2.2 eine Analyse der triuwe-Konzeption im Nibelungenlied vorgenommen. Um der ambivalenten Verwendung des triuwe-Begriffs im Nibelungenlied gerecht zu werden, erfolgt anschließend in Anlehnung an Kückemanns eine Darstellung derjenigen Arten der triuwe, die im Nibelungenlied besonders handlungsrelevant erscheinen.
Im Anschluss daran, erfolgt in Kapitel 2.3 die Analyse der Konzeption der triuwe in Bezug auf den König Rother. Hier ist es naheliegend, dass die beiden Herrscher Rother und Konstantin jeweils separat hinsichtlich ihres Verhaltens betrachtet werden, sodass Rückschlüsse auf die Bedeutung der triuwe für das jeweilige Herrscherbild gezogen werden können. Es bietet sich an, das Verhalten Rothers im Zusammenhang mit seinem Vasallen Lupold zu analysieren, da insbesondere in dieser wechselseitigen Beziehung bedeutende Aspekte für den Charakter der Figur Rothers entdeckt werden können. Ohne an dieser Stelle bereits zu sehr auf Unterschiede zwischen Rother und Konstantin eingehen zu wollen, ist es in Bezug auf Konstantin hingegen nicht naheliegend, sich auf einen bestimmten Vasallen zu fokussieren, da das königliche Umfeld Konstantins im Gegensatz zum Regierungsverbund Rothers keine namentliche Erwähnung findet, sondern vielmehr durch anonyme Figuren verkörpert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Definitorische Begriffsbestimmung der triuwe
- triuwe im Nibelungenlied
- triuwe im König Rother
- Vergleich der triuwe-Konzeptionen
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Konzeptionen der triuwe im Nibelungenlied und im König Rother. Ziel ist es, die unterschiedlichen Konzeptionen der triuwe in beiden Werken herauszuarbeiten und zu vergleichen. Die zentrale Fragestellung lautet: Inwiefern unterscheiden sich die Konzeptionen der triuwe im Nibelungenlied und im König Rother?
- Definitorische Begriffsbestimmung der triuwe
- Analyse der triuwe-Konzeption im Nibelungenlied
- Analyse der triuwe-Konzeption im König Rother
- Vergleich der triuwe-Konzeptionen in beiden Werken
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit zeigt auf, dass die triuwe in mittelalterlichen Epen wie dem Nibelungenlied und dem König Rother eine zentrale Rolle spielt. Sie stellt fest, dass in der bisherigen Forschung die triuwe oft nur für ein einzelnes Werk analysiert oder nur beiläufig erwähnt wird. Diese Arbeit möchte diese Forschungslücke schließen, indem sie die Konzeption der triuwe in beiden Epen vergleichend analysiert.
Definitorische Begriffsbestimmung der triuwe
Dieses Kapitel widmet sich der Klärung des mittelalterlichen Begriffsverständnisses der triuwe und grenzt ihn vom heutigen Treuebegriff ab. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Begriffe werden herausgestellt.
triuwe im Nibelungenlied
Dieses Kapitel analysiert die triuwe-Konzeption im Nibelungenlied. Es werden verschiedene Arten der triuwe vorgestellt, die im Nibelungenlied eine wichtige Rolle spielen. Die Analyse stützt sich auf exemplarische Textbelege, die die Konfliktträchtigkeit der verschiedenen Arten der triuwe verdeutlichen.
triuwe im König Rother
Dieses Kapitel analysiert die triuwe-Konzeption im König Rother. Die Analyse betrachtet das Verhalten der beiden Herrscher Rother und Konstantin und zeigt, wie die triuwe in ihren jeweiligen Herrscherbildern zum Ausdruck kommt. Das Verhalten Rothers wird im Zusammenhang mit seinem Vasallen Lupold analysiert, während das Handeln Konstantins im Fokus steht, da sein königliches Umfeld im Vergleich zu Rothers Regierungsverbund nicht durch konkrete Figuren dargestellt wird.
Vergleich der triuwe-Konzeptionen
Dieses Kapitel vergleicht die triuwe-Konzeptionen im Nibelungenlied und im König Rother anhand der wesentlichen Ergebnisse der jeweiligen Analyse. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Konzeptionen herausgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind triuwe, Nibelungenlied, König Rother, mittelalterliche Literatur, höfische Literatur, Ethik, Treue, Pflichtverhältnis.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „triuwe“ in der mittelalterlichen Literatur?
„triuwe“ umfasst weit mehr als den modernen Treuebegriff; es beschreibt ein umfassendes ethisches Pflichtverhältnis, Zuverlässigkeit und die Bindung zwischen Lehnsherr und Vasall.
Wie wird die „triuwe“ im Nibelungenlied dargestellt?
Im Nibelungenlied ist die „triuwe“ oft ambivalent und konfliktträchtig, da verschiedene Treuepflichten (z. B. gegenüber Verwandten vs. Lehnsherrn) kollidieren und zur Katastrophe führen.
Wie unterscheidet sich das Herrscherbild von Rother und Konstantin bezüglich der „triuwe“?
König Rother verkörpert ein Ideal der wechselseitigen Treue zu seinen Vasallen (z.B. Lupold), während Konstantin eher als distanzierter, weniger durch persönliche Treuebindungen geprägter Herrscher erscheint.
Welche Rolle spielen Vasallen für die Konzeption der „triuwe“?
Vasallen sind die zentralen Bezugspunkte, an denen sich die Standhaftigkeit und Qualität der herrscherlichen „triuwe“ im mittelalterlichen Epos misst.
Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen dem Nibelungenlied und König Rother?
Beide Werke nutzen die „triuwe“ als zentrales Motiv zur Charakterisierung ihrer Helden, wobei die Ausprägung im Nibelungenlied tragischer und im König Rother eher herrschaftslegitimierend ist.
- Quote paper
- Jens Rakers (Author), 2017, Vergleich der triuwe-Konzeption im "Nibelungenlied" und im "König Rother", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388454