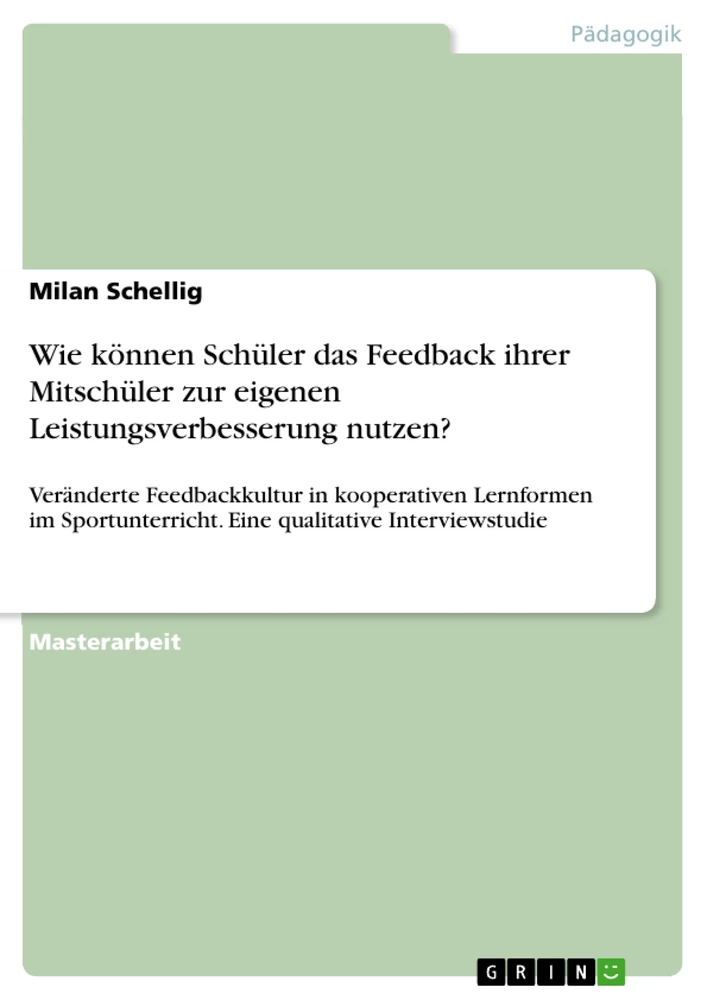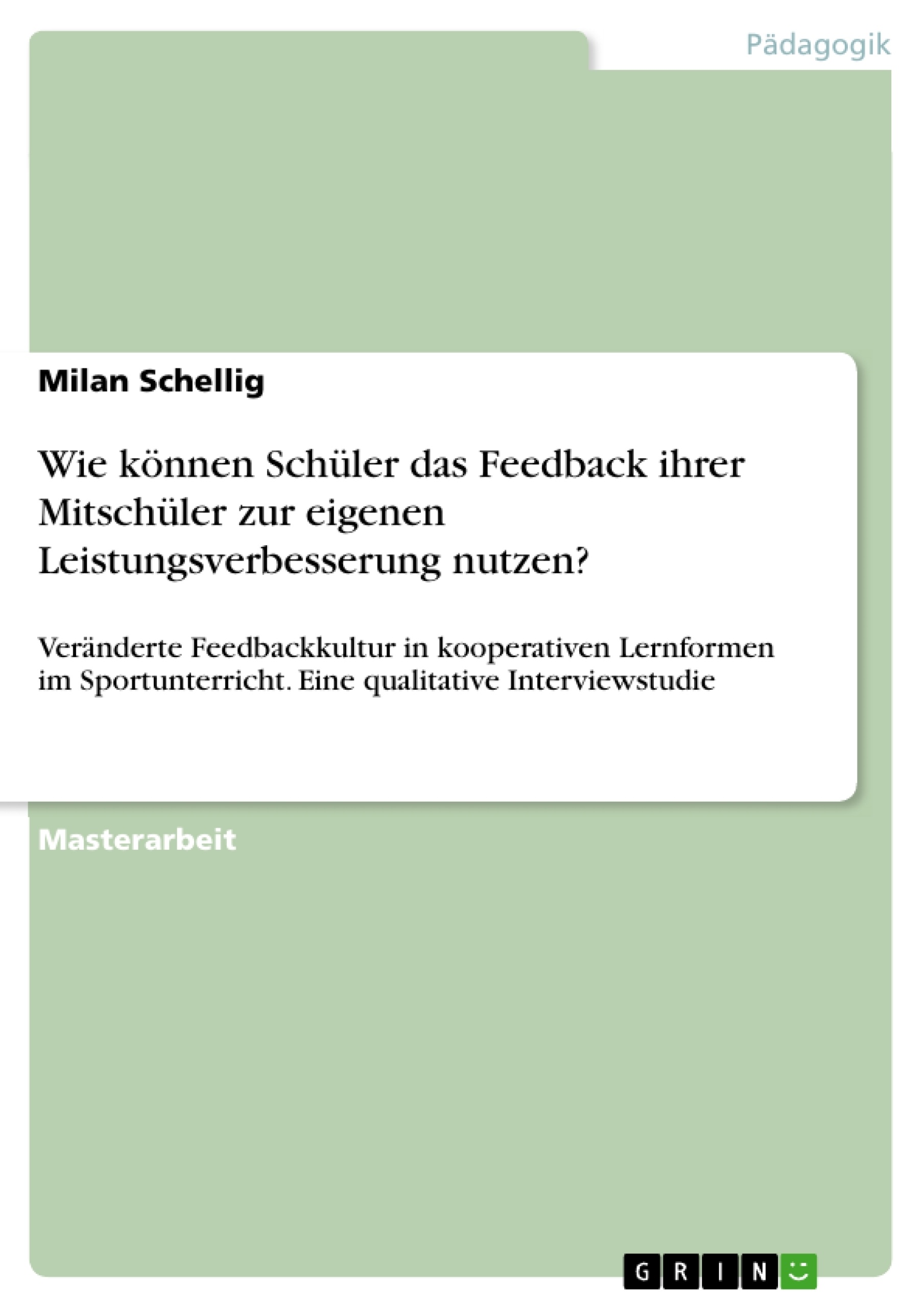Ein zentraler Bestandteil menschlicher Kommunikation ist der Austausch von Informationen. Besonders im Kontext der Schule ist dieser Informationsaustausch häufig durch Rückmeldungen von anderen gekennzeichnet. In der Regel kommt in diesen Situationen der Lehrperson die Rolle des Rückmelders zu, die Schülerinnen und Schüler fungieren als Empfänger seiner Botschaften. Dahinter kann die Absicht stehen, einem störenden Schüler sein unsoziales Verhalten zu verdeutlichen oder in Form von Bewertungen schulische Leistungen durch Noten rückzumelden. Rückmeldungen finden in Lehr-Lernkontexten auch häufig als unterstützendes Element für die Kontrolle und Gewährleistung eines progressiven Lernverlaufes statt. Für diese Situationen hat sich der englische Begriff „Feedback“ in der deutschen Sprache etabliert.
Während in klassisch geschlossenen Unterrichtsformen diese Rollenverteilung unangetastet bleibt, gibt es offenere Unterrichtskonzepte, in denen die Lehrkraft nicht mehr die alleinige Rückmeldeinstanz für die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler sein muss. Diese Arbeit beschäftigt sich ausgehend vom Konzept Kooperatives Lernen, mit der wechselseitigen Kommunikation im Unterrichtsgeschehen, die dort zu großen Teilen unter den Mitschülern stattfindet.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Perspektive der Schülerinnen und Schüler auf Feedback und ihre Beteiligung an den Feedbackprozessen, die in der Übernahme von für sie ungewohnten Rollen besteht, zu erfassen. Es geht darum, wie sie mit diesen Rollen umgehen und wie sie das Feedback ihrer Mitschüler zur eigenen Leistungsverbesserung nutzen.
Zur Beantwortung dieser Fragen gliedert sich die Arbeit in einen vorangehenden Theorieteil und einen anschließenden empirischen Teil. Im theoretischen Teil der Arbeit werden die beiden theoretischen Bausteine erläutert. Das ist zum einen das Kooperative Lernen sowie die veränderte Feedbackkultur in kooperativen Settings. Hinzu kommt der anshließende empirische Teil der Arbeit. Hierfür wird auf ein qualitatives Untersuchungsdesign in Form von problemzentrierten Interviews zurückgegriffen, die mit Schülerinnen und Schülern eines Gymnasiums geführt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kooperatives Lernen im Sportunterricht
- 2.1 Begründungsmuster für Kooperatives Lernen
- 2.2 Zum Potential Kooperativen Lernens im Sportunterricht
- 2.3 Problemebenen Kooperativen Lernens
- 2.4 Konstitutive Merkmale Kooperativen Lernens
- 2.4.1 Gemeinsames Gruppenziel
- 2.4.2 Spielraum für Entscheidungen
- 2.4.3 Individuelle Verantwortung für das Gruppenziel
- 2.4.4 Positive Wechselbeziehung in Bezug auf den Lernprozess
- 2.5 Handlungsmuster im Konzept Kooperatives Lernen
- 2.5.1 Die Rolle und Aufgaben der Lehrkraft
- 2.5.2 Die Rolle und Aufgaben der Schülerinnen und Schüler
- 2.6 Aktueller Forschungsstand
- 3. Veränderte Feedbackkultur im Sportunterricht
- 3.1 Definition und Differenzierung des Feedbackbegriffs
- 3.2 Feedbackfunktionen
- 3.3. Bedingungen für ein gelingendes Feedback
- 3.4. Zum Einsatz von Feedback im Sportunterricht
- 3.4.1 Feedback und Bewegungslernen
- 3.4.2 Feedbackarbeit in kooperativen Lernarrangements
- 4. Zwischenfazit und Fragestellung
- 5. Untersuchungsdesign
- 5.1 Bestimmung der Stichprobe
- 5.2 Auswahl der Untersuchungsmethode
- 5.3 Methodenentwicklung und Leitfadenkonstruktion
- 5.4 Untersuchungsdurchführung
- 5.5 Datenaufbereitung
- 5.6 Datenauswertung
- 6. Untersuchungsergebnisse
- 6.1 Leistungsentwicklung
- 6.1.1 Individuelle Leistungsentwicklung
- 6.1.2 Leistungsentwicklung der Kleingruppe
- 6.1.3 Faktoren zur Leistungsentwicklung
- 6.1.4 Feedbackeinfluss auf die Leistungsentwicklung
- 6.2 Beteiligung an Feedbackprozessen
- 6.2.1 Die Rolle des Feedbackgebers
- 6.2.1.1 Umgang mit dem Feedbackgeben
- 6.2.2 Erkenntnisse aus beiden Rollen
- 6.2.2.1 Subjektives Begriffsverständnis
- 6.2.2.1 Subjektive Gelingensbedingungen
- 6.3.1 Rolle als Feedbackempfänger
- 6.3.1.1 Wahrnehmung des Mitschülerfeedbacks
- 6.3.1.2 Wahrnehmung des Lehrerfeedbacks
- 6.3.1.3 Mitschüler- oder Lehrerfeedback
- 7. Diskussion
- 7.1 Methodisches Vorgehen
- 7.2 Ergebnisdiskussion
- 8. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der veränderten Feedbackkultur im Sportunterricht im Kontext von kooperativen Lernformen. Das Ziel ist es, die Perspektive der Schülerinnen und Schüler auf Feedback und ihre Beteiligung an den Feedbackprozessen zu erfassen. Dabei steht im Vordergrund, wie sie mit ihren neuen Rollen umgehen und wie sie das Feedback ihrer Mitschüler zur eigenen Leistungsverbesserung nutzen.
- Kooperatives Lernen im Sportunterricht
- Veränderte Feedbackkultur im Sportunterricht
- Die Rolle der Schülerinnen und Schüler im Feedbackprozess
- Der Einfluss von Mitschülerfeedback auf die Leistungsentwicklung
- Subjektive Begriffsverständnisse und Gelingensbedingungen für Feedback
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der veränderten Feedbackkultur im Sportunterricht ein und erläutert die Bedeutung von Feedback für den Lernprozess. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Konzept des kooperativen Lernens im Sportunterricht, dessen Begründungsmuster, Potentiale und Probleme beleuchtet werden. Außerdem werden konstitutive Merkmale und Rollen im Rahmen dieser Lernform besprochen. Kapitel 3 widmet sich der veränderten Feedbackkultur im Sportunterricht und definiert den Feedbackbegriff. Die verschiedenen Feedbackfunktionen und Gelingensbedingungen werden erläutert, sowie der Einsatz von Feedback im Sportunterricht, insbesondere im Zusammenhang mit Bewegungslernen.
Kapitel 4 fasst die bisherige Diskussion zusammen und stellt die Forschungsfrage der Arbeit. Kapitel 5 beschreibt das methodische Vorgehen der Studie, die in Form problemzentrierter Interviews durchgeführt wurde. Hier werden die Stichprobenauswahl, die Untersuchungsmethode und die Datenauswertung erläutert. Kapitel 6 präsentiert die Untersuchungsergebnisse, die sich auf die Leistungsentwicklung, die Beteiligung an Feedbackprozessen und die Wahrnehmung von Feedback beziehen.
Schlüsselwörter
Kooperatives Lernen, Sportunterricht, Feedback, Feedbackkultur, Mitschülerfeedback, Leistungsentwicklung, Lernprozess, Gelingensbedingungen, qualitative Interviewstudie, subjektives Begriffsverständnis.
Häufig gestellte Fragen
Wie können Schüler Feedback zur Leistungsverbesserung nutzen?
Schüler nutzen Feedback von Mitschülern, um ihre eigenen Bewegungsabläufe oder Leistungen aus einer anderen Perspektive zu sehen, Fehler zu korrigieren und ihre Selbstwahrnehmung zu schärfen.
Was ist kooperatives Lernen im Sportunterricht?
Es handelt sich um ein Lernkonzept, bei dem Schüler in Kleingruppen zusammenarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen, wobei jeder Verantwortung für den Lernprozess der Gruppe trägt.
Welche Rolle nehmen Schüler beim Peer-Feedback ein?
Schüler wechseln zwischen der Rolle des Feedbackgebers (Beobachter und Berater) und des Feedbackempfängers, was soziale Kompetenzen und fachliches Verständnis fördert.
Welche Bedingungen müssen für gelingendes Feedback erfüllt sein?
Feedback muss konstruktiv, konkret, verständlich und wertschätzend sein. Zudem benötigen Schüler klare Kriterien, anhand derer sie die Leistung beurteilen können.
Ist Lehrerfeedback oder Mitschülerfeedback effektiver?
Beide Formen ergänzen sich. Während Lehrer fachliche Expertise bieten, wird Mitschülerfeedback oft als weniger bedrohlich wahrgenommen und kann im Unterrichtsalltag häufiger und unmittelbarer erfolgen.
- Quote paper
- Milan Schellig (Author), 2016, Wie können Schüler das Feedback ihrer Mitschüler zur eigenen Leistungsverbesserung nutzen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388470