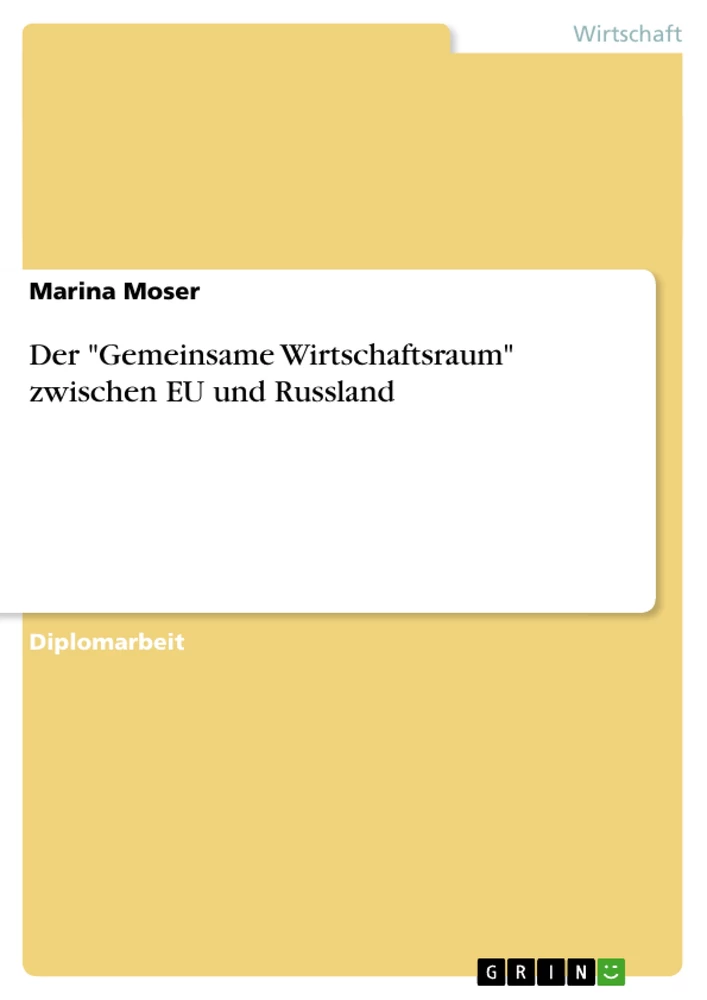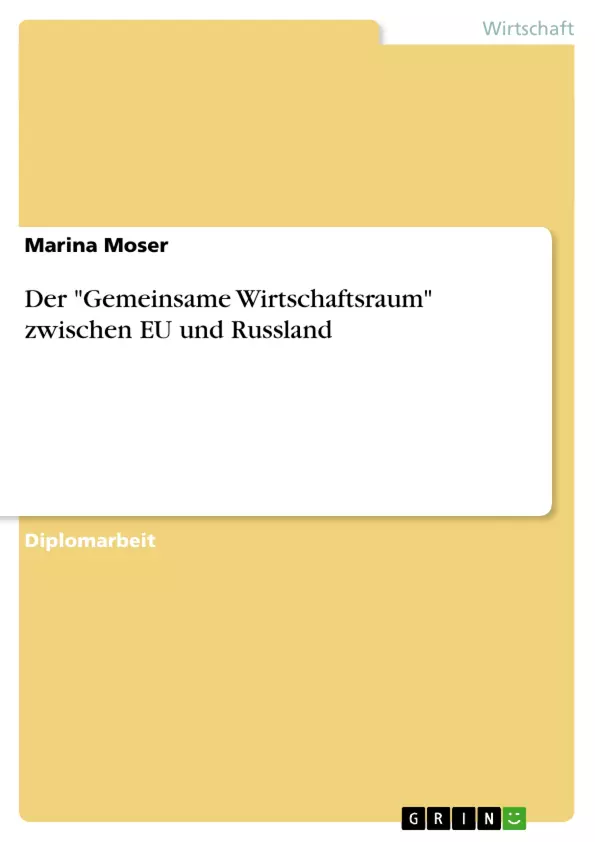[...] In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob die geplante Harmonisierung von Regeln, Strukturen und Prozeduren aus ökonomischer Perspektive sinnvoll ist. Dabei wird von einem gemeinsamen Ziel Russlands und der EU ausgegangen, nämlich der wirtschaftlichen Entwicklung Russlands. Für eine intensive Kooperation gibt es gute Gründe: Die gemeinsame Grenze hat sich durch die unlängst erfolgte Erweiterung der EU verlängert und von einer Integration der Märkte könnten beide Seiten profitieren. Die EU hat Interesse an einem prosperierenden Russland, mit dem ein reger Handel stattfindet, der beiden Parteien zugute kommt. Russlands wirtschaftliche Situation hat sich in den letzten Jahren zwar erheblich gebessert, dennoch ist eine weitere Entwicklung in Richtung Wohlstand keineswegs als selbstverständlich anzusehen, und die wirtschaftlichen Beziehungen zur EU werden aller Voraussicht nach einen wesentlichen Beitrag zum russischen Wirtschaftswachstum leisten. Die vorgesehene regulatory convergence soll die Handelsintegration begleiten und fördern, und sich somit positiv auf Wohlstand und Wachstum auswirken. Dieser Gedanke entsteht offensichtlich in Anlehnung an die Erweiterungspolitik der EU, und man erhofft sich dadurch einen ähnlichen Erfolg wie in den neuen Mitgliedsstaaten. Den theoretischen Hintergrund der Analyse, der in Kapitel 2 vorgestellt wird, bildet die Literatur, die sich mit der Entstehung und dem Wandel von Regeln und Normen auseinandersetzt (welche in der Ökonomie allgemein als Institutionen bezeichnet werden). Im Zentrum von Kapitel 3 steht das Konzept des CES. Es wird auf die bisherige politische Beziehung zwischen Russland und der EU eingegangen, das offizielle Konzeptpapier zusammengefasst und dessen Interpretation in der Literatur wiedergegeben. Der Beschluss von Russland und der EU, ihre Regeln und Gesetze zu harmonisieren, impliziert im Extremfall eine Übertragung des gesamten acquis communautaire nach Russland, also des Gesamtbestandes an Rechten und Pflichten, der für die Mitgliedsstaaten der EU verbindlich ist. Diese Gesetze und Regeln sind, insofern sie den Handlungsspielraum der Individuen einschränken und steuern und dadurch die Anreizstrukturen der Gesellschaft definieren, Institutionen. Die optimale institutionelle Gestaltung aber, und dies ist der zentrale Gedanke, der in dieser Arbeit aufgenommen wird, ist landesspezifisch. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Institutionen und ihre Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung
- Definition und Relevanz
- Entstehung und Wandel
- Institutionen in der Wirtschaftstheorie und -politik
- Das Konzept des „,Common Economic Space”
- Zum politischen Verhältnis Russlands und der EU
- Das CES-Konzeptpapier
- Der CES in der Literatur.
- Die Übertragung von Institutionen im Rahmen des CES
- Zur wirtschaftlichen Situation Russlands
- Die Übertragung des acquis communautaire
- Der acquis communautaire als Regelsystem.
- Zur Komplementarität des acquis communautaire mit den russischen Institutionen
- Chancen und Risiken einer Übertragung des acquis communautaire
- Der CES als Prozess
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Sinnhaftigkeit der geplanten Harmonisierung von Regeln, Strukturen und Prozeduren im Rahmen des Common Economic Space (CES) aus ökonomischer Perspektive. Sie geht von einem gemeinsamen Ziel Russlands und der EU aus, nämlich der wirtschaftlichen Entwicklung Russlands. Die Analyse berücksichtigt die Vorteile einer intensiven Kooperation, die sich aus der gemeinsamen Grenze und den potenziellen gegenseitigen Vorteilen einer Marktintegration ergeben. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und der EU für das russische Wirtschaftswachstum und analysiert die Rolle der vorgesehenen regulatory convergence bei der Förderung der Handelsintegration.
- Ökonomische Analyse des CES
- Harmonisierung von Regeln und Standards
- Wirtschaftliche Entwicklung Russlands
- Handelsintegration zwischen Russland und der EU
- Regulatory convergence
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den Common Economic Space (CES) als eine Langzeit-Initiative Russlands und der Europäischen Union (EU) vor, die die Bildung eines „Gemeinsamen Wirtschaftsraumes“ zum Ziel hat. Die Einleitung beschreibt den Umfang des Projekts und die Bedeutung der geplanten Harmonisierung von Regeln, Strukturen und Prozeduren (regulatory convergence) für die Integration der Märkte.
- Institutionen und ihre Rolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Institutionen für die wirtschaftliche Entwicklung und diskutiert verschiedene Ansätze zur Analyse der Rolle von Institutionen in der Wirtschaftstheorie und -politik.
- Das Konzept des „Common Economic Space”: Dieses Kapitel stellt die politische Beziehung zwischen Russland und der EU dar und erläutert das CES-Konzeptpapier. Außerdem wird der CES in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert.
- Die Übertragung von Institutionen im Rahmen des CES: Dieses Kapitel behandelt die wirtschaftliche Situation Russlands und untersucht die Übertragung des acquis communautaire, des Regelwerks der Europäischen Union, auf Russland. Es analysiert die Komplementarität des acquis communautaire mit den russischen Institutionen und diskutiert Chancen und Risiken einer Übertragung.
Schlüsselwörter
Common Economic Space, CES, Russland, Europäische Union, EU, wirtschaftliche Entwicklung, Handelsintegration, regulatory convergence, acquis communautaire, Institutionen, Harmonisierung, Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des "Common Economic Space" (CES) zwischen EU und Russland?
Ziel ist die Bildung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums durch die Harmonisierung von Regeln und Strukturen, um die wirtschaftliche Entwicklung Russlands und die Marktintegration zu fördern.
Was bedeutet "regulatory convergence" in diesem Kontext?
Es beschreibt die Angleichung von Gesetzen und technischen Standards, um Handelshemmnisse abzubauen und den Austausch von Waren und Dienstleistungen zu erleichtern.
Was ist der "acquis communautaire"?
Es handelt sich um den Gesamtbestand an Rechten und Pflichten der EU-Mitgliedstaaten. Die Arbeit untersucht die Risiken und Chancen einer Übertragung dieses Regelwerks auf Russland.
Warum ist die institutionelle Gestaltung landesspezifisch wichtig?
Die Arbeit argumentiert, dass Regeln (Institutionen) nur dann effizient funktionieren, wenn sie mit den bestehenden lokalen Strukturen und Anreizsystemen eines Landes kompatibel sind.
Welchen ökonomischen Nutzen hat die EU an einem prosperierenden Russland?
Die EU profitiert von einem stabilen Handelspartner an ihrer Grenze und neuen Absatzmärkten, die durch eine stärkere Integration der Märkte entstehen.
- Citar trabajo
- Marina Moser (Autor), 2004, Der "Gemeinsame Wirtschaftsraum" zwischen EU und Russland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38850