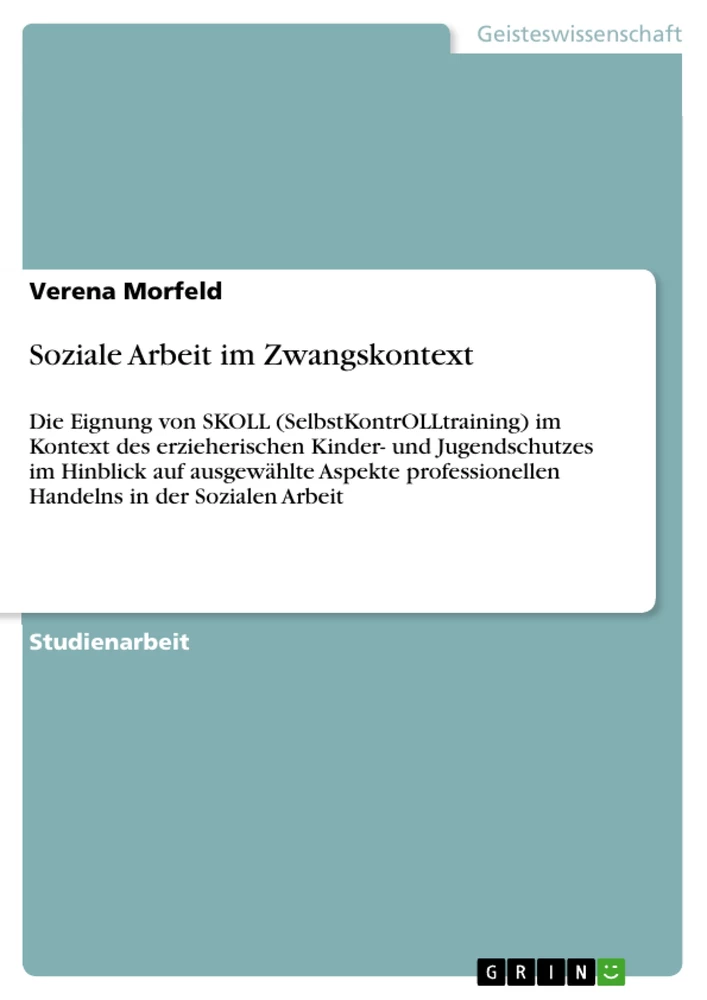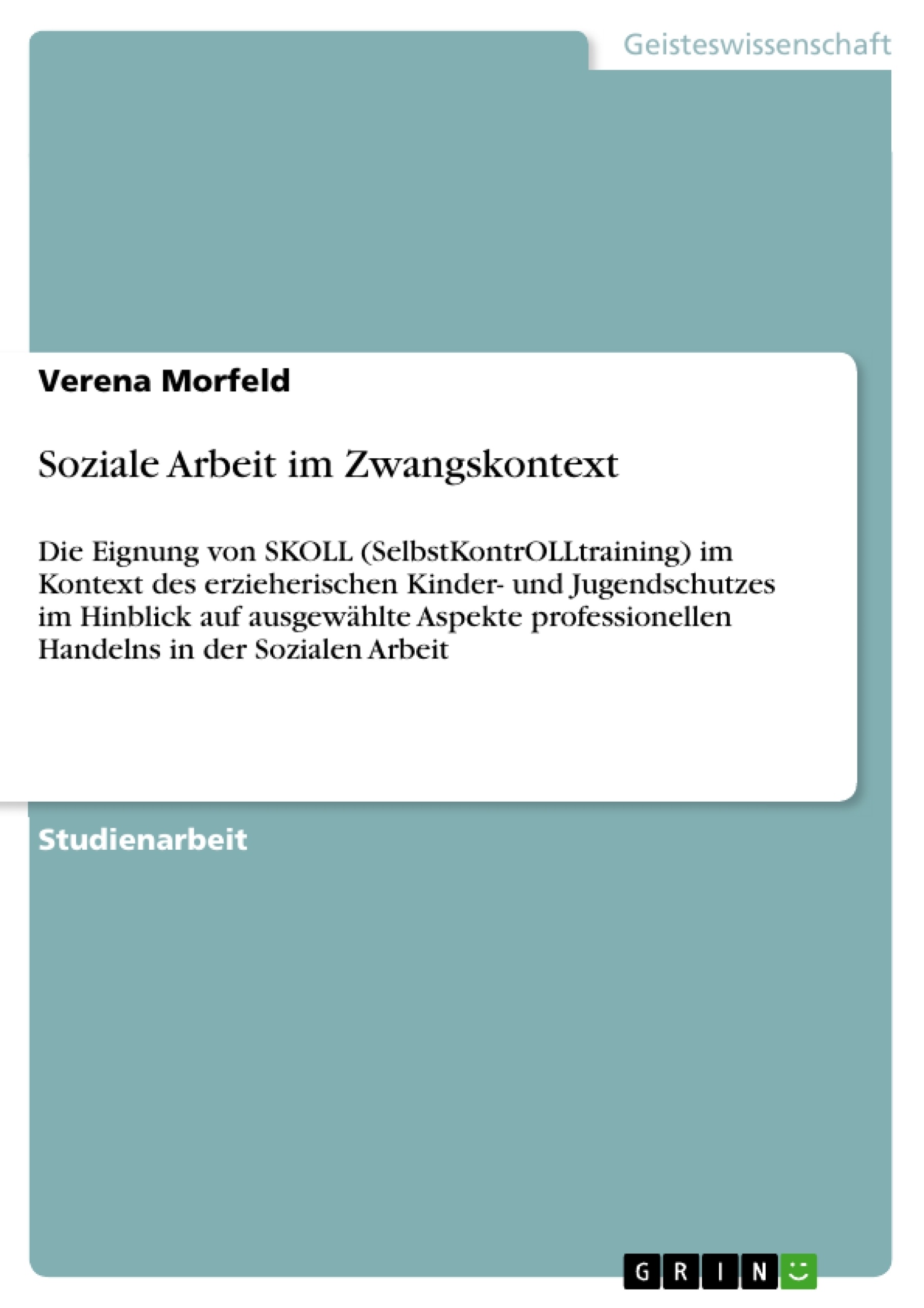Im Zentrum derArbeit steht das Programm SKOLL, welches als Handlungskonzept der Suchtprävention im Kontext des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gem. §14 SGB VIII als professionelles Handlungskonzept der Sozialen Arbeit im Zwangskontext untersucht wird. Dabei wird vor dem Hintergrund exemplarischer theoretischer Annahmen zu professionellem Handeln in der Sozialen Arbeit kritisch analysiert, ob SKOLL als ein geeignetes Handlungskonzept der Sozialen Arbeit im Zwangskontext ausgewiesen werden kann, welche Chancen das Konzept bietet und wo sich ggf. Schwierigkeiten ergeben können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Professionelles Handeln im Zwangskontext
- Zwangskontext: Definition und Bedeutung für Betroffene
- Definition professionelles Handeln
- Bedeutung doppelte Loyalitätsverpflichtung
- Bedeutung Nichtstandardisierbarkeit des Handelns
- Zwischenfazit
- Suchtprävention im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz am Beispiel der Methode SKOLL
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz – eine Definition
- Suchtprävention als Teil des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- SKOLL als Methode der Suchtprävention
- Intention der Methode
- Ziele der Methode
- Umsetzung der Methode
- Kritische Analyse von SKOLL als ein Handlungskonzept der Sozialen Arbeit im Zwangskontext
- Abschließendes Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Eignung des Programms SKOLL (SelbstKOntroLLtraining) als Handlungskonzept der Suchtprävention im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Es soll geklärt werden, ob SKOLL im Kontext des professionellen Handelns in der Sozialen Arbeit innerhalb eines Zwangskontextes geeignet ist. Dazu werden zunächst theoretische Annahmen zu professionellem Handeln in der Sozialen Arbeit herangezogen, um einen analytischen Rahmen zu entwickeln. Anschließend wird das Konzept SKOLL als Präventionsprogramm vorgestellt. Abschließend erfolgt eine kritische Betrachtung des Programms hinsichtlich seiner Anwendbarkeit als Handlungskonzept im Zwangskontext.
- Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit im Zwangskontext
- Das Programm SKOLL als Konzept der Suchtprävention
- Eignung von SKOLL als Handlungskonzept im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
- Chancen und Grenzen von SKOLL im Zwangskontext
- Kritische Analyse von SKOLL im Hinblick auf professionelles Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik von Sucht und Suchtprävention im Kontext von Kindern und Jugendlichen dar und führt in das Thema der Hausarbeit ein. Sie zeigt die Relevanz von Suchtpräventionsmaßnahmen im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz auf und präsentiert die Forschungsfrage: „Ist SKOLL, als Konzept zur Suchtprävention, für professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit innerhalb eines Zwangskontextes geeignet?“.
- Professionelles Handeln im Zwangskontext: Dieses Kapitel definiert den Zwangskontext in der Sozialen Arbeit und erläutert seine Bedeutung für Betroffene. Es werden auch theoretische Annahmen zu Professionalität in der Sozialen Arbeit vorgestellt und exemplarische Aspekte der kooperativen Prozessgestaltung beleuchtet.
- Suchtprävention im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz am Beispiel der Methode SKOLL: Dieses Kapitel definiert den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz und erläutert Suchtprävention als Teil davon. Es stellt das Programm SKOLL als Methode der Suchtprävention vor und geht auf seine Intention, Ziele und Umsetzung ein.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Suchtprävention, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, professionelles Handeln, Zwangskontext, SKOLL (SelbstKOntroLLtraining), kooperative Prozessgestaltung, doppelte Loyalitätsverpflichtung und Nichtstandardisierbarkeit des Handelns.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Soziale Arbeit im Zwangskontext“?
Es beschreibt Situationen, in denen Klienten nicht freiwillig, sondern aufgrund rechtlicher oder behördlicher Auflagen (z.B. Jugendamt) Hilfe in Anspruch nehmen.
Was ist das Programm SKOLL?
SKOLL steht für Selbstkontrolltraining und ist ein Konzept der Suchtprävention, das darauf abzielt, den verantwortungsbewussten Umgang mit Suchtmitteln zu fördern.
Was ist die „doppelte Loyalitätsverpflichtung“ in der Sozialen Arbeit?
Sozialarbeiter sind sowohl dem Wohl des Klienten als auch dem Auftrag des Staates bzw. der Gesellschaft verpflichtet, was besonders im Zwangskontext zu Konflikten führen kann.
Eignet sich SKOLL für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz?
Die Arbeit analysiert kritisch, ob SKOLL gemäß §14 SGB VIII als professionelles Handlungskonzept geeignet ist, um Jugendliche in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen.
Was ist die „Nichtstandardisierbarkeit des Handelns“?
Dies bedeutet, dass soziale Hilfeleistungen individuell auf den Einzelfall zugeschnitten sein müssen und nicht nach einem starren Schema abgearbeitet werden können.
- Citar trabajo
- Verena Morfeld (Autor), 2017, Soziale Arbeit im Zwangskontext, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388562