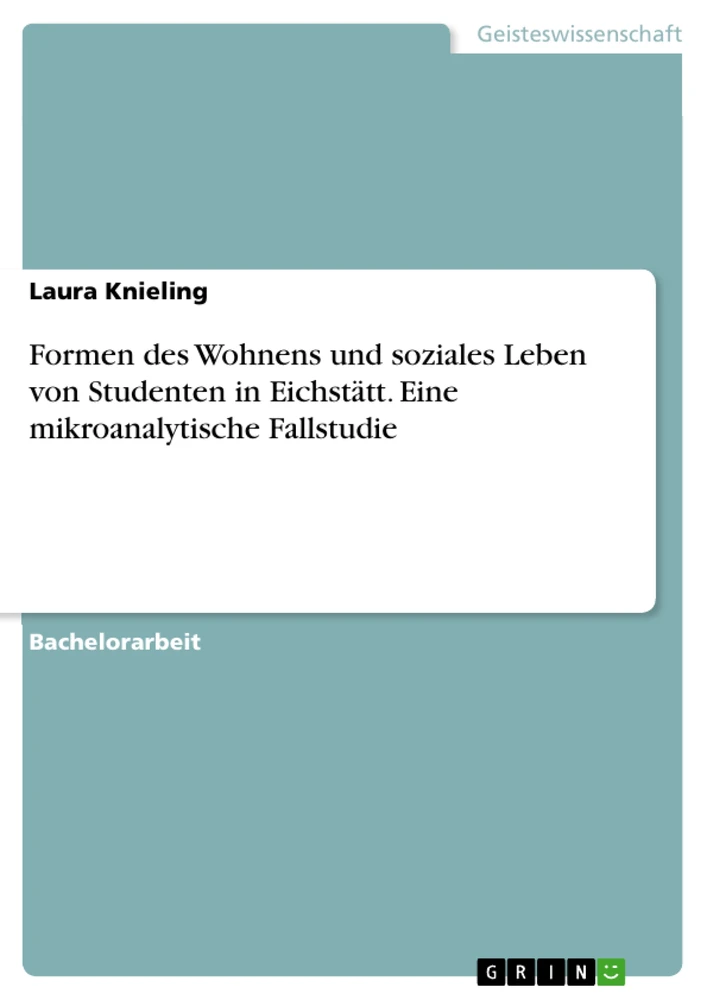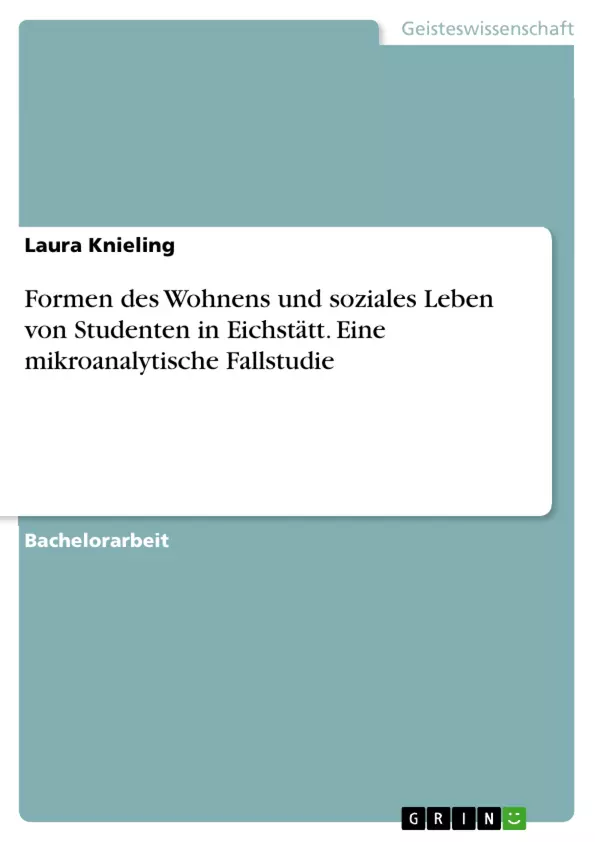Diese Bachelor-Arbeit befasst sich mit wohnkulturellen und freizeitgestalterischen Elementen innerhalb des Studentenlebens in der Universitätsstadt Eichstätt in Bayern. Die Idee für dieses Thema entstand durch persönliche Erfahrungen und durch den Austausch mit anderen Studenten. Studentenstädte sind bekannt für ihr blühendes Nachtleben, das sich aber vornehmlich auf die Vorlesungszeit beschränkt. Nachdem ich selbst schon im Wohnheim und in zwei Wohngemeinschaften (WGs) gelebt habe, konnte ich unterschiedliche Auswirkungen auf mein eigens Sozialleben bemerken. Im Wohnheim musste ich aktiv vor die Tür gehen, um in Interaktion mit anderen Menschen zu treten. Hingegen ist in meiner aktuellen WG oft so viel geboten, dass ich mich weniger an öffentliche Orte begeben muss. Diese Beobachtung an mir selbst hat mich neugierig gemacht. Mich hat nicht nur interessiert, ob es Zusammenhänge zwischen der Wohnform und dem Sozialleben von Studenten gibt, sondern auch, wie andere Studenten wohnen und welche Erfahrungen sie zu verbuchen haben.
Vor dieser Studie hatte ich immer das Gefühl, dass viele Studenten in Eichstätt nur wegen des Studiums wohnen und, sobald das Wochenende beginnt oder die Ferien anfangen, wieder ihre Koffer packen und in rasender Geschwindigkeit abreisen. Sie sind noch nicht hier angekommen, leben nicht in ihren Wohnungen und fühlen sich nicht heimatlich. Andere wiederum gehören zum Eichstätter Leben wie der Dom im Zentrum. Sie haben schon vor langer Zeit begonnen hier zu leben und nicht nur zu wohnen. Der Werbeslogan „Wohnst du noch oder lebst du schon!“ bekommt hier eine neue und treffende Bedeutung. Das eine Lager der Studentenschaft lebt in Eichstätt und fühlt sich hier verwurzelt, der andere Teil wohnt hier nur, solange es nötig ist. Eichstätt ist auch meine neue Wahlheimat. Die Stadt ist sehr überschaubar, die Einwohnerzahl explodiert nahezu während des Semesters und wird von Studenten überschwemmt. Dennoch handelt es sich um eine kleine Universität mit knapp 4.000 Studenten, was eine familiäre und persönliche Atmosphäre entstehen lässt.
Für meine Studie wurden sechs Personen qualitativ untersucht und hinter die Kulissen ihrer Wohnungen geblickt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- WISSENSCHAFTLICHE EINFÜHRUNG
- FORSCHUNGSSTAND
- VERSTÄNDNISBEGRIFFE UND Theoretische ZUGÄNGE: RAUM, WOHNEN, WOHNKULTUR UND LEBENSSTIL
- METHODISCHER ZUGRIFF
- FRAGESTELLUNG
- VORSTELLUNG DER STUDIENTEILNEHMER UND DEREN WOHNSITUATIONEN
- C.
- E.
- F.
- J.
- B.
- ANALYSE DES ERHOBENEN MATERIALS
- ERHEBUNGEN BEZÜGLICH DER WOHNSITUATION: RAUMSTRUKTUREN, EINRICHTUNG, FUNKTIONEN
- FIXE MERKMALE
- MOBILE MERKMALE
- RAUMFUNKTIONEN
- PERSÖNLICHE BEURTEILUNG DURCH DIE BEFRAGTEN
- ANGABEN ZUM SOZIALLEBEN
- FREIZEITAKTIVITÄTEN
- UNTERNEHMUNGEN IM FREUNDESKREIS: PERSONEN, AKTIVITÄTEN, Treffpunkte
- LEBENSALLTÄGLICHE TÄTIGKEITEN
- URLAUBS- BZW. HEIMFAHRVERHALTEN: FREQUENZ, ORTE, MITREISENDE
- PERSÖNLICHE EINSCHÄTZUNGEN BZW. BEURTEILUNGEN
- SCHLUSSSTATEMENTS DER BEFRAGTEN
- ERHEBUNGEN BEZÜGLICH DER WOHNSITUATION: RAUMSTRUKTUREN, EINRICHTUNG, FUNKTIONEN
- INTERPRETATION UND THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN
- EINSCHRÄNKUNGEN DURCH RAUM, PERSONEN UND WOHNORT
- GEMEINSCHAFTLICHE AKTIVITÄTEN INNERHALB UND AUBERHALB DER WOHNUNG
- GEMEINSCHAFTLICH GENUTZTE RÄUME
- TREFFPUNKTE IM ÖFFENTLICHEN RAHMEN
- HEIMFAHR- UND URLAUBSVERHALTEN
- VERORTUNG DER FREUNDESKREISE
- ,,FOTOS\" ALS ZENTRALE OBJEKTE IN DEN ZIMMERN
- FAZIT DER MIKROANALYTISCHEN STUDIE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Wohnformen und dem sozialen Leben von Studenten in Eichstätt. Ziel ist es, durch eine mikroanalytische Fallstudie Einblicke in die Lebenswelt von sechs Studenten zu gewinnen und mögliche Auswirkungen der Wohnform auf ihr Sozialleben zu beleuchten.
- Untersuchung der Wohnkultur und Freizeitgestaltung von Studenten in Eichstätt
- Analyse der Raumstrukturen, Einrichtungsmerkmale und Funktionen von Studentenwohnungen
- Bedeutung des sozialen Lebens von Studenten in Eichstätt
- Beurteilung der Einflüsse der Wohnform auf die Sozialisierung von Studenten
- Verortung der Studenten in Eichstätt im Kontext von Wohnort, Sozialleben und persönlichen Beziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Thema der Wohnkultur und des sozialen Lebens von Studenten in Eichstätt vor und erläutert die Motivation der Autorin für die Durchführung dieser Studie.
- Wissenschaftliche Einführung: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Forschungsstand zum Thema Wohnen, Wohnkultur und Lebensstil in der Volkskunde und Soziologie, wobei die Autorinnen Katschnig-Fasch und Häußermann/Siebel als zentrale Werke dienen.
- Vorstellung der Studienteilnehmer und deren Wohnsituationen: Dieses Kapitel präsentiert die sechs Studienteilnehmer und ihre jeweilige Wohnsituation, welche Einblicke in die unterschiedlichen Wohnformen und Lebensumstände von Studenten in Eichstätt bieten.
- Analyse des erhobenen Materials: Hier werden die erhobenen Daten aus den Interviews und Beobachtungen der Studienteilnehmer systematisch analysiert, wobei die Schwerpunkte auf den Wohnraum, die Einrichtung, die Funktionen der Räume, die sozialen Aktivitäten und die persönlichen Beurteilungen der Studenten liegen.
- Interpretation und theoretische Überlegungen: Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse der Analyse und diskutiert die gewonnenen Erkenntnisse vor dem Hintergrund der relevanten Fachliteratur und der theoretischen Konzepte von Raum, Wohnen, Wohnkultur und Lebensstil.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Wohnen, Wohnkultur, Lebensstil, Studentenleben, Sozialleben, Raum, Raumstrukturen, Freizeittätigkeiten, Beziehungen, Eichstätt, Mikroanalyse und qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen zum Studentenleben in Eichstätt
Welchen Einfluss hat die Wohnform auf das Sozialleben von Studenten?
Die Studie zeigt, dass Wohnformen wie WGs oft mehr interne Interaktion bieten, während Wohnheimbewohner oft aktiver nach außen treten müssen.
Warum pendeln viele Studenten in Eichstätt am Wochenende?
Viele Studenten betrachten Eichstätt primär als Studienort und kehren am Wochenende in ihre Heimatorte zurück, was als "Heimfahrverhalten" analysiert wird.
Was ist das Besondere an der Universität Eichstätt?
Mit etwa 4.000 Studenten bietet sie eine familiäre und persönliche Atmosphäre, die das soziale Miteinander in der Kleinstadt prägt.
Welche Rolle spielen 'Fotos' in der Einrichtung von Studentenzimmern?
Fotos dienen als zentrale Objekte der Identität und helfen den Studenten, sich in der fremden Umgebung zu verorten und heimisch zu fühlen.
Was wurde in der mikroanalytischen Fallstudie untersucht?
Es wurden sechs Personen qualitativ zu ihrer Wohnsituation (Raumstrukturen, Einrichtung) und ihrem Freizeitverhalten befragt.
- Citar trabajo
- Laura Knieling (Autor), 2015, Formen des Wohnens und soziales Leben von Studenten in Eichstätt. Eine mikroanalytische Fallstudie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/388897