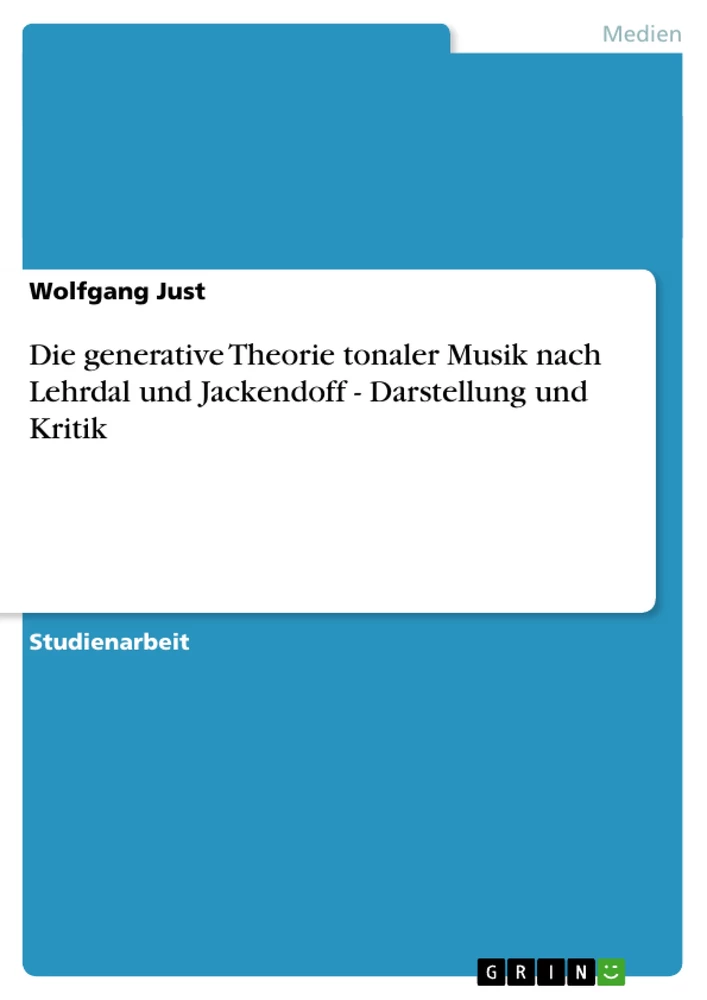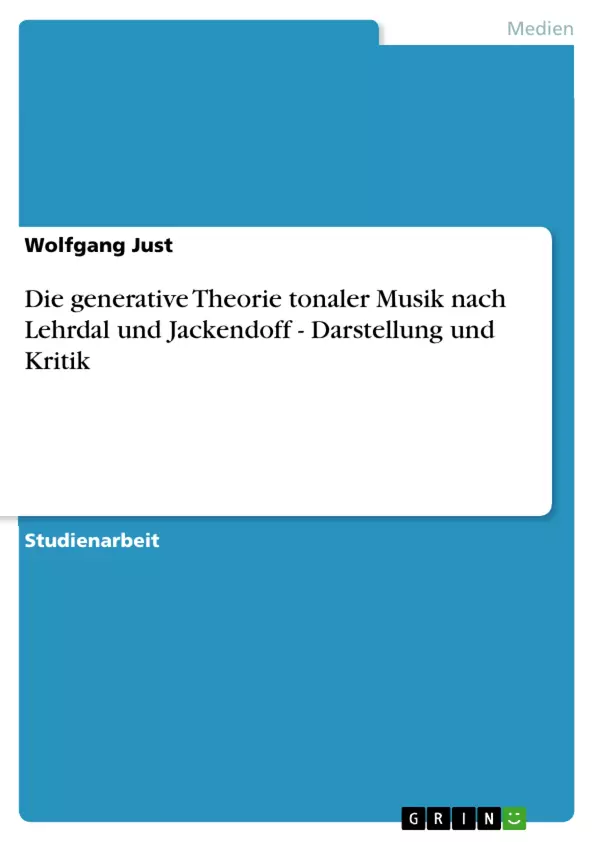Ganz allgemein wird in der Musikwissenschaft oft von Beziehungen zwischen Musik und Sprache gesprochen. Ebendiese können auf verschiedenen Ebenen hergestellt werden. Die Generative Theorie der Tonalen Musik (GTTM) nach Lerdahl und Jackendoff ist ein solcher Versuch, wobei hier als Anknüpfungspunkt die Annahme steht, dass sowohl hinter der Sprache als auch hinter der Musik ein kognitiver Mechanismus steht, der unsere Wahrnehmung prägt. Den Ausgangspunkt für die GTTM bildete die Generative Transformationsgrammatik nach Chomsky, zusammenfassend kann sie als ein Regelwerk, das jeder Sprache, egal welcher, zu Grunde liegt, beschrieben werden. Dieses Regelwerk spiegelt gleichzeitig den Kognitionsmechanismus der Sprache wieder. Lerdahl und Jackendoff versuchten, eine ebensolche generative Grundlage in der kognitiven Wahrnehmung der Musik zu finden und im Rahmen einer Theorie zu formalisieren. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es einerseits, die Theorie von Lerdahl und Jackendoff vorzustellen, wobei der Blick besonders auf die Entstehung aus den Ansätzen Chomskys heraus gelenkt werden soll. Im Anschluss daran soll diskutiert werden, inwiefern die GTTM den Anspruch einlöst, eine kognitives Modell der Musikperzeption entwickelt zu haben, was als zentrale Frage hinter dieser Arbeit erachtet werden kann.
Zur ihrer Beantwortung soll wie folgt vorgegangen werden: In einem ersten Schritt soll die Generative Transformationsgrammatik nach Chomsky dargelegt sowie an einem konkrete Beispiel illustriert werden um die Arbeitsweise der Theorie zu verdeutlichen. In einem weiteren Schritt soll aufgezeigt werden, inwiefern sie Modellcharakter für die GTTM besitzt. Die Darstellung der GTTM beginnt mit einer kurzen Einführung, der verdeutlichen soll, wie die GTTM als Theorie durch die Autoren positioniert wird um anschließend in ihrer Ausarbeitung präsentiert werden zu können. Danach sind die Voraussetzungen geschaffen, um einen eigenen Abschnitt der Kritik an der Theorie zu widmen. In einem abschließenden Kapitel wird ein Resümee gezogen und die Möglichkeit für weitere Forschungsansätze aufgezeigt. Die in der Arbeit verwendete Terminologie stützt sich auf die Übersetzungen von Cornelius Bradters1 aus dem Englischen ins Deutsche. Bradters Bearbeitung des englischen Originalstexts ist eine der einzige umfangreichere deutsche Sekundärtext zu dieser Theorie. Insofern kann seine Übersetzung als Standard erachtet werden und wurde der Einfachheit halber in dieser Arbeit übernommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Generative Transformationsgrammatik nach Chomsky
- Einführende Darstellung
- Modellcharakter für die GTTM
- Die GTTM als kognitive Theorie
- Strukturelle Darstellung der GTTM
- Arbeitsweise und Aufbau der GTTM
- Die Komponenten der GTTM
- Gruppierungsgefüge
- metrisches Gefüge
- Zeitenreduktion
- Prolongationsreduktion
- Praktische Anwendung der GTTM an einem Beispiel
- Kritik an der GTTM
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit präsentiert und kritisiert die Generative Theorie der Tonalen Musik (GTTM) von Lerdahl und Jackendoff. Der Fokus liegt auf der Entstehung der GTTM aus Chomskys Generativer Transformationsgrammatik und der Untersuchung, inwieweit die GTTM ein kognitives Modell der Musikperzeption darstellt. Die Arbeit verfolgt eine systematische Darstellung der Theorie und ihrer Anwendung, gefolgt von einer kritischen Auseinandersetzung.
- Die Generative Transformationsgrammatik als Grundlage der GTTM
- Die Struktur und Komponenten der GTTM
- Die GTTM als kognitives Modell der Musikwahrnehmung
- Anwendung der GTTM an einem Beispiel
- Kritikpunkte an der GTTM
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Zusammenhang zwischen Musik und Sprache, wobei die GTTM als Ansatz zur Erklärung dieser Beziehung vorgestellt wird. Sie erläutert das Ziel der Arbeit, die GTTM darzustellen und zu kritisieren, insbesondere im Hinblick auf ihren Anspruch als kognitives Modell der Musikperzeption. Der methodische Ansatz, der die Generative Transformationsgrammatik Chomskys als Ausgangspunkt nimmt, wird ebenfalls skizziert.
Die Generative Transformationsgrammatik nach Chomsky: Dieses Kapitel beschreibt Chomskys Transformationsgrammatik, deren Ziel die Abbildung des impliziten Sprachwissens durch explizite Regeln ist. Es erklärt Chomskys Ansatz einer formalisierten allgemeinen Sprachtheorie und die Notwendigkeit eines endlichen Regelsystems zur Generierung unendlich vieler Sätze. Die Arbeit von Chomsky „Aspekte der Syntax Theorie“ wird als zentrale Referenz genannt, und die grundlegenden Konzepte der Transformationsgrammatik werden erläutert, inklusive der Unterscheidung zwischen Oberflächen- und Tiefenstruktur.
Schlüsselwörter
Generative Theorie der Tonalen Musik (GTTM), Lerdahl und Jackendoff, Generative Transformationsgrammatik, Noam Chomsky, kognitive Musiktheorie, Musikperzeption, Sprachwissenschaft, Musikwissenschaft, strukturelle Analyse, musikalische Grammatik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Generative Theorie der Tonalen Musik (GTTM)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit der Generativen Theorie der Tonalen Musik (GTTM) von Lerdahl und Jackendoff. Sie analysiert die Entstehung der GTTM aus Chomskys Generativer Transformationsgrammatik und untersucht, inwieweit die GTTM ein kognitives Modell der Musikperzeption darstellt. Die Arbeit präsentiert die Theorie systematisch, wendet sie an und kritisiert sie anschließend.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Die Generative Transformationsgrammatik als Grundlage der GTTM, die Struktur und Komponenten der GTTM, die GTTM als kognitives Modell der Musikwahrnehmung, die Anwendung der GTTM an einem Beispiel und kritische Punkte der GTTM.
Welche Struktur hat die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Generative Transformationsgrammatik nach Chomsky, Die GTTM als kognitive Theorie, Strukturelle Darstellung der GTTM (inklusive Arbeitsweise, Aufbau, Komponenten wie Gruppierungsgefüge, Metrisches Gefüge, Zeitenreduktion und Prolongationsreduktion und einem Anwendungsbeispiel), Kritik an der GTTM und Resümee. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Rolle spielt Chomskys Generative Transformationsgrammatik?
Chomskys Transformationsgrammatik dient als Grundlage und Ausgangspunkt für die GTTM. Die Arbeit erklärt Chomskys Ansatz einer formalisierten allgemeinen Sprachtheorie und die Notwendigkeit eines endlichen Regelsystems zur Generierung unendlich vieler Sätze. Die Unterscheidung zwischen Oberflächen- und Tiefenstruktur wird erläutert und der Bezug zur Musiktheorie hergestellt.
Wie wird die GTTM in der Arbeit dargestellt?
Die GTTM wird systematisch dargestellt, wobei ihre Struktur und Komponenten detailliert beschrieben werden. Es wird ein Beispiel für die praktische Anwendung der Theorie präsentiert, um ihre Arbeitsweise zu veranschaulichen. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Komponenten der GTTM, wie Gruppierungsgefüge, metrisches Gefüge, Zeitenreduktion und Prolongationsreduktion.
Welche Kritikpunkte an der GTTM werden behandelt?
Die Seminararbeit enthält ein separates Kapitel, das sich kritisch mit der GTTM auseinandersetzt. Die spezifischen Kritikpunkte werden in der Arbeit detailliert ausgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Generative Theorie der Tonalen Musik (GTTM), Lerdahl und Jackendoff, Generative Transformationsgrammatik, Noam Chomsky, kognitive Musiktheorie, Musikperzeption, Sprachwissenschaft, Musikwissenschaft, strukturelle Analyse, musikalische Grammatik.
Für wen ist diese Seminararbeit gedacht?
Diese Seminararbeit richtet sich an Leser, die sich für die kognitiven Aspekte der Musiktheorie und den Zusammenhang zwischen Musik und Sprache interessieren. Sie eignet sich für Studierende der Musikwissenschaft, Sprachwissenschaft und verwandter Disziplinen.
- Citation du texte
- Wolfgang Just (Auteur), 2005, Die generative Theorie tonaler Musik nach Lehrdal und Jackendoff - Darstellung und Kritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38965