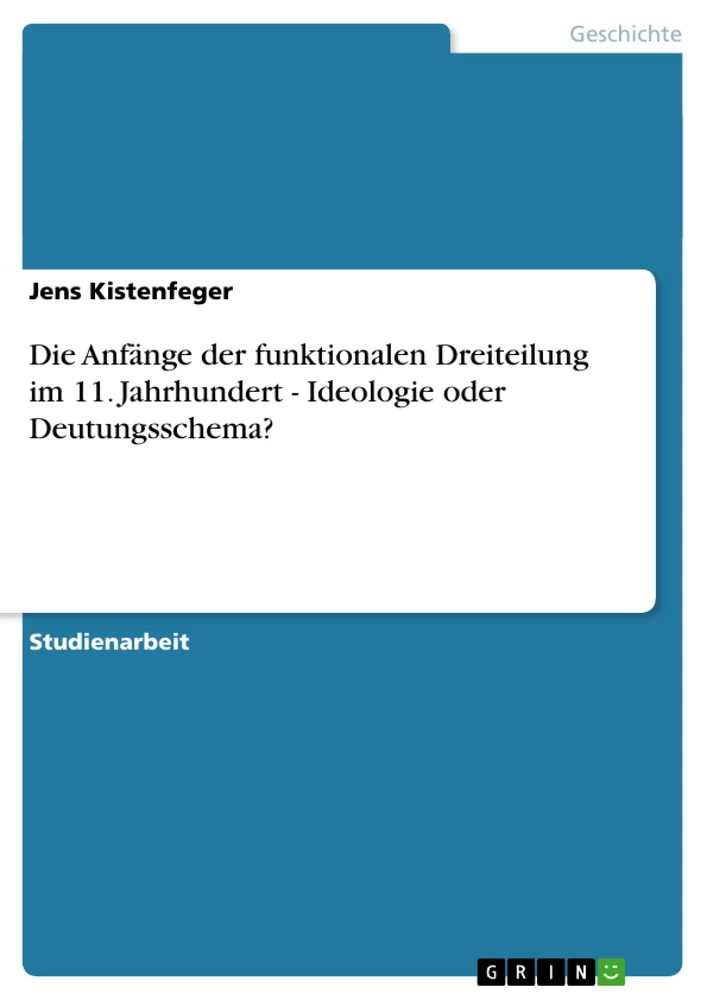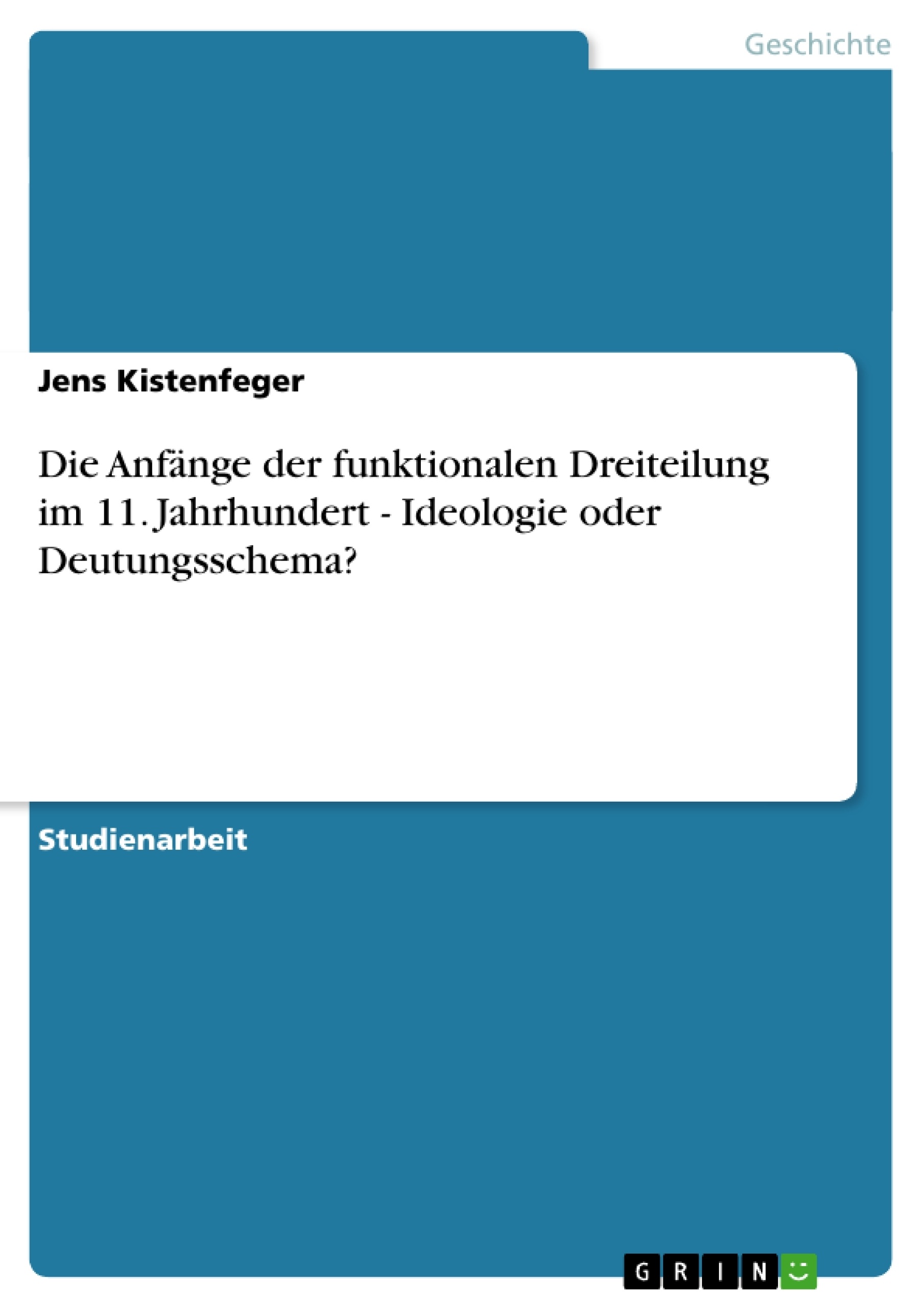[...] Das Ergebnis der vorliegenden Arbeit wird sein, daß keiner der beiden Interpretationen recht
gegeben wird. Aber bevor dieser Schluß gezogen werden kann, sollen zuerst (dies geschieht im
zweiten Hauptteil dieser Arbeit) die Begriffe „Ideologie“ und „Deutungsschema“ aus den
Beiträgen der einzelnen Autoren herausgearbeitet werden, so daß mit diesen Begriffen umgegangen
werden kann – dies zu tun, versäumen gerade die Autoren auf der ‚Ideologieseite‘. Die
jeweiligen Positionen sollen so eindeutig wie möglich klargelegt werden. Der dritte Hauptteil der Arbeit ist den Argumenten gewidmet, die von beiden Seiten vorgebracht werden. Diese Argumente sollen auf ihre Schlüssigkeit und auf ihre Vereinbarkeit mit
den historischen Befunden der jeweiligen Autoren hin untersucht werden. Der darauf folgende Abschnitt (vierter Teil) soll den in dieser Arbeit vertretenen Standpunkt, daß es sich bei der Theorie der funktionalen Dreiteilung um eine Legitimation im Sinne der wissenssoziologischen Theorie von Berger und Luckmann handelt, vorstellen und verdeutlichen. Bevor mit den drei genannten Hauptteilen begonnen wird, erfolgt eine Bestimmung dessen, was das Schema der funktionalen Dreiteilung eigentlich ist und was ihm vorausging, woraus es sich entwickelt hat und was seine ‚Konkurrenz‘ im 11. Jahrhundert war. Dabei ist dieser voranmerkende Teil nicht nur als Bestimmung des Untersuchungsobjektes gedacht, sondern er ist auch ein Stück weit die Basis für die weiteren Darlegungen. Den Abschluß macht eine kurze Vergewisserung der Ergebnisse der gemachten Untersuchungen.
Inhaltsverzeichnis
- Grundriß der Arbeit
- Die funktionale Dreiteilung
- Inhaltsbestimmung
- Historische Abkunft
- Deutungsschema oder Ideologie
- Begriffsbestimmungen
- Wirklichkeitsbezüge
- Die funktionale Dreiteilung als Legitimation
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der funktionalen Dreiteilung im westfränkisch-französischen Königreich zu Beginn des 11. Jahrhunderts. Sie analysiert das „Carmen ad Rotbertum regem“ des Adalbero von Laon als Hauptquelle und untersucht die Frage, ob es sich bei der funktionalen Dreiteilung um eine Ideologie oder ein Deutungsschema handelt.
- Analyse der funktionalen Dreiteilung und ihrer historischen Entwicklung
- Unterscheidung zwischen Ideologie und Deutungsschema im Kontext der funktionalen Dreiteilung
- Bewertung der Argumente von verschiedenen Autoren zur Interpretation der funktionalen Dreiteilung
- Prüfung der Rolle der funktionalen Dreiteilung als Legitimationsinstrument
- Zusammenhang zwischen der lex divina und der lex humana im System der funktionalen Dreiteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit stellt den Untersuchungsgegenstand und die Methodik vor. Er beschreibt die beiden konkurrierenden Lesarten der funktionalen Dreiteilung, die Ideologie und das Deutungsschema, und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der zweite Teil behandelt die Begriffe „Ideologie“ und „Deutungsschema“ aus der Sicht verschiedener Autoren, um eine gemeinsame Basis für die weitere Analyse zu schaffen. Im dritten Teil werden die Argumente der beiden Seiten zur funktionalen Dreiteilung auf ihre Schlüssigkeit und ihre Vereinbarkeit mit den historischen Befunden untersucht.
Schlüsselwörter
Funktionale Dreiteilung, Ideologie, Deutungsschema, „Carmen ad Rotbertum regem“, Adalbero von Laon, Gerhard von Cambrai, Legitimation, lex divina, lex humana, Wissenssoziologie, Berger und Luckmann.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die funktionale Dreiteilung des 11. Jahrhunderts?
Es handelt sich um ein Gesellschaftsmodell, das die Menschen in drei Gruppen unterteilt: die Betenden (oratores), die Kämpfenden (bellatores) und die Arbeitenden (laboratores).
Handelt es sich bei der Dreiteilung um eine Ideologie oder ein Deutungsschema?
Die Arbeit untersucht beide Lesarten und kommt zu dem Schluss, dass es sich eher um ein Legitimationsinstrument im Sinne der Wissenssoziologie handelt.
Welche Rolle spielt Adalbero von Laon?
Sein Werk „Carmen ad Rotbertum regem“ dient als Hauptquelle für die Analyse der funktionalen Dreiteilung im westfränkisch-französischen Königreich.
Was ist der Unterschied zwischen lex divina und lex humana?
Die lex divina (göttliches Gesetz) und lex humana (menschliches Gesetz) bilden den rechtlichen und religiösen Rahmen, innerhalb dessen das System der Dreiteilung legitimiert wurde.
Welche soziologische Theorie wird zur Analyse herangezogen?
Die Arbeit nutzt die wissenssoziologische Theorie von Berger und Luckmann, um die Dreiteilung als soziale Konstruktion der Wirklichkeit zu erklären.
- Citation du texte
- Jens Kistenfeger (Auteur), 2002, Die Anfänge der funktionalen Dreiteilung im 11. Jahrhundert - Ideologie oder Deutungsschema?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38975