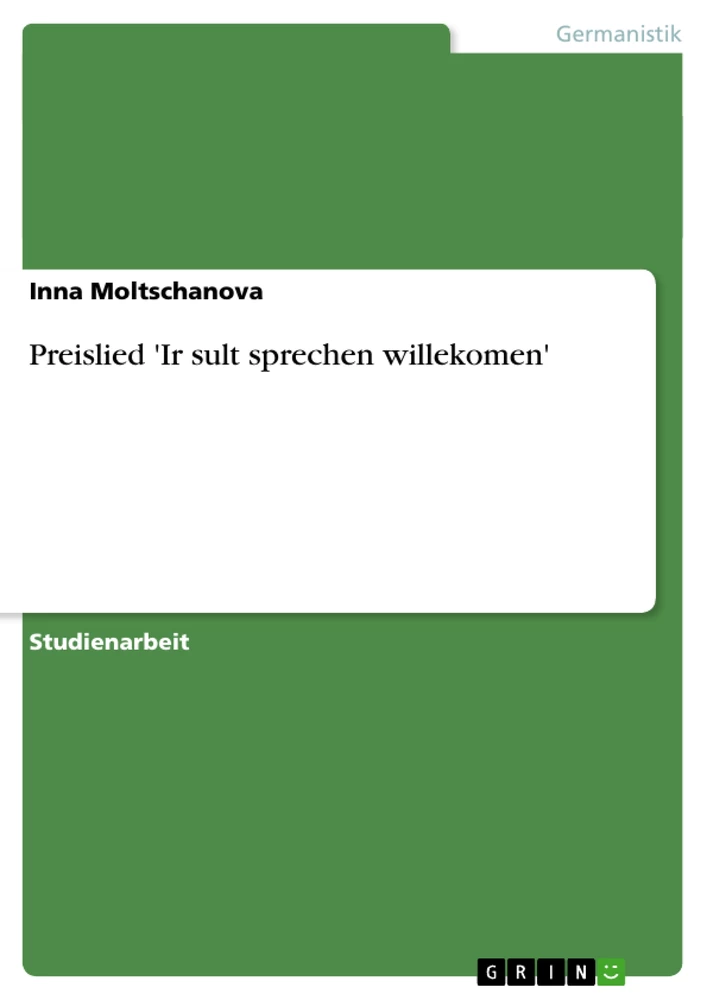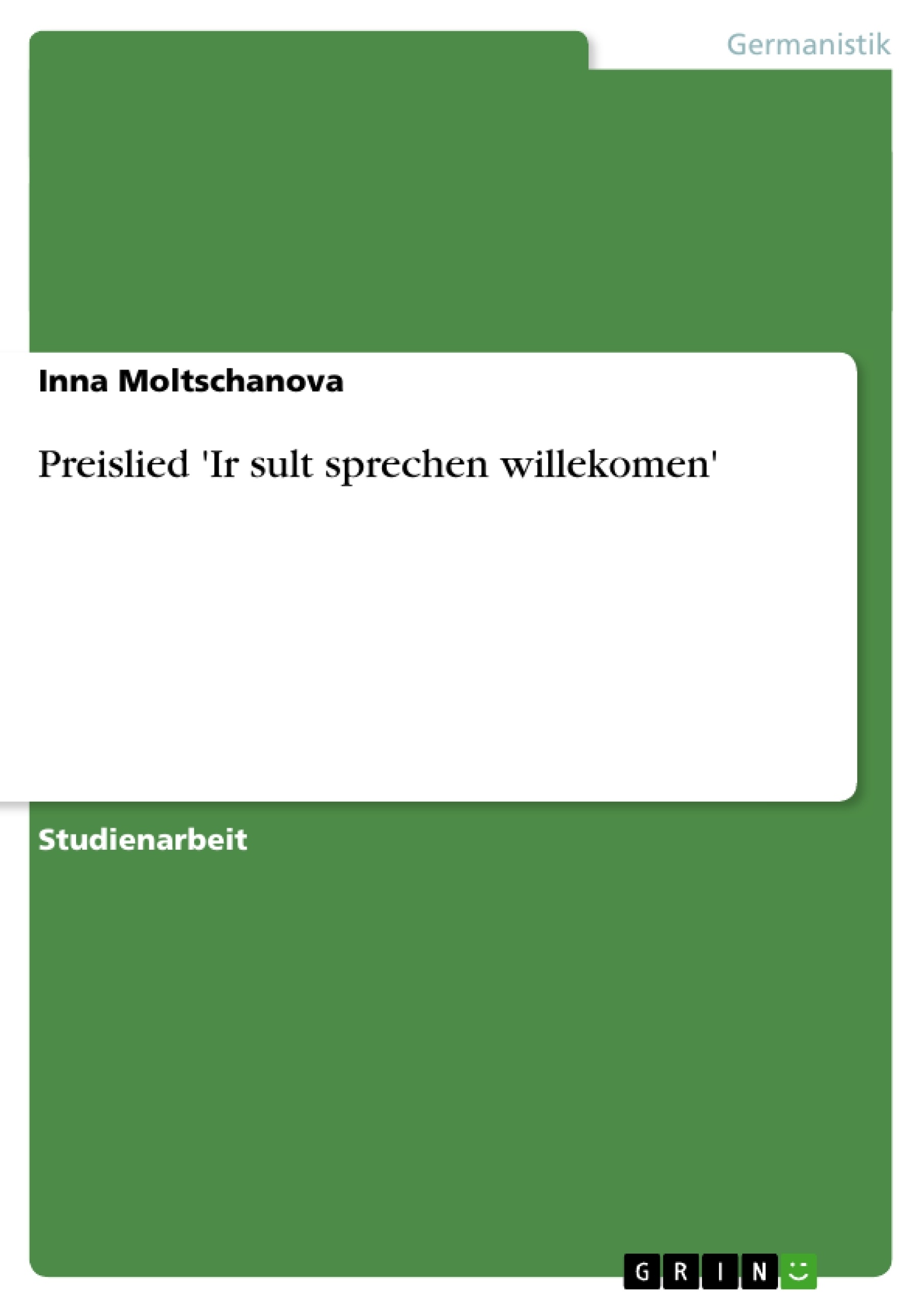[...] In seiner Minnelyrik gibt es keine chronologischen Hinweise. Die Überlieferung seiner Liebeslyrik lässt sich höchstens anhand der Thematik und stilistischer Merkmale feststellen. Daher nimmt die Forschung an, dass es in Walthers Minnesang drei Phasen der Entwicklung gab, die sich unmittelbar mit seiner Biographie verknüpfen lassen. Die erste Phase seines Schaffens nennen wir die Hohe Minne: Dabei handelt es sich um die Zeit, die er am Wiener Hof verbracht hat. Einige Interpreten sehen ihn dabei als Schüler Reinmars. Nach
dem Weggang aus Wien hat er sich von der Hohen Minne kritisch abgewandt und verfasste erotische Lieder, die als Mädchenlieder oder Niedere Minne bekannt sind. Schließlich griff Walther das Konzept der Hohen Minne in modifizierter Form (Neue Hohe Minne) wieder auf. 2 In der Forschung wird das Lied Ir sult sprechen willekomen in eine Phase der Neuen Hohen Minne eingeführt, in der Walther sich dem Wiener Hof wieder angenährt hatte. Als Zeitpunkt der Entstehung nimmt man allgemein das Jahr 1203 an. Die Notiz des Bischofs von Passau beweist, dass Walther sich um diese Zeit in der Nähe Wiens befand. Der Anlass seines Aufenthalts dort war vermutlich die Hochzeit des Herzogs Leopold VI. mit der byzantinischen Prinzessin Theodora Komnena.3 Gegen diese Annahme spricht jedoch der Inhalt des Liedes, in dem nur die deutschen Frauen und Männer gepriesen werden. Ein anderer Zeitpunkt könnte das Jahr 1200 gewesen sein - aus Anlass des Ritterschlags von Herzog Leopold VI. 2 Rupp 3 Kasten, 59
Inhaltsverzeichnis
- Autor und Werk
- Walther von der Vogelweide
- Die ältere Forschung
- Walthers Lebensform
- Walthers Kariere
- Walthers Dienst an verschiedenen Feudalherren
- Walthers Abschied von Wien
- Walthers Spruchdichtung
- Walthers Minnesang
- Preislied,,Ir sult sprechen willekomen“
- Überlegung zur Interpretation
- Verlauf der Argumentation der Hs. C
- Verlauf der Argumentation in Handschrift A
- Verlauf der Argumentation in Handschrift E
- Was ist das für ein Lied?
- Verteidigungslied: gegen das Fremde
- Walther-Reinmar-Kontroverse
- Reaktion auf das Lied von Heinrich von Morungen 122,1 und 127,1.
- Der Forschungsstand/ Rezeptionsgeschichte im 18. und 19. Jh.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Preislied „Ir sult sprechen willekomen“ von Walther von der Vogelweide und untersucht dessen Rezeption im Kontext der mittelalterlichen deutschen Literatur und der späteren Forschung. Dabei werden die verschiedenen Interpretationsansätze des Liedes sowie die historische und kulturelle Bedeutung des Werkes beleuchtet.
- Analyse der verschiedenen Interpretationsansätze von „Ir sult sprechen willekomen“
- Untersuchung der historischen und kulturellen Bedeutung des Liedes
- Rezeption des Werkes in der mittelalterlichen deutschen Literatur
- Spätere Forschungsarbeiten und Interpretationen des Liedes
- Die Rolle von Walther von der Vogelweide in der deutschen Literaturgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit Walther von der Vogelweide und seiner literarischen Tätigkeit. Hier werden seine Biografie, seine literarische Entwicklung und die Besonderheiten seines Werkes beleuchtet. Das zweite Kapitel widmet sich dem Preislied „Ir sult sprechen willekomen“. Es wird die Entstehung des Liedes, die verschiedenen Handschriften und Interpretationsansätze sowie der Forschungsstand beleuchtet. Das dritte Kapitel thematisiert die vielfältigen Bedeutungen des Liedes und analysiert es als Verteidigungslied, als Teil der Walther-Reinmar-Kontroverse und als Reaktion auf andere zeitgenössische Lieder. Das vierte Kapitel gibt einen Überblick über die Rezeption des Liedes im 18. und 19. Jahrhundert und zeigt die Entwicklung der Interpretationen im Kontext der sich verändernden gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse.
Schlüsselwörter
Walther von der Vogelweide, Preislied, „Ir sult sprechen willekomen“, Minnelyrik, Deutsche Literatur des Mittelalters, Interpretation, Handschriften, Forschungsstand, Rezeption, Nationalismus, Walther-Reinmar-Kontroverse, Verteidigungslied.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Walther von der Vogelweide?
Er war einer der bedeutendsten deutschen Lyriker des Mittelalters, bekannt für seinen Minnesang und seine politische Spruchdichtung.
Worum geht es in dem Lied 'Ir sult sprechen willekomen'?
Es ist ein Preislied, in dem Walther die deutschen Frauen, Männer und die deutsche Kultur preist und sich damit als nationalbewusster Dichter positioniert.
In welche Phase von Walthers Schaffen wird das Lied eingeordnet?
Die Forschung ordnet es meist der „Neuen Hohen Minne“ zu, vermutlich entstanden um das Jahr 1203 während eines Aufenthalts in der Nähe von Wien.
Was war die Walther-Reinmar-Kontroverse?
Es handelt sich um eine literarische Auseinandersetzung zwischen Walther und seinem Lehrer Reinmar dem Alten über das Wesen der Liebe und des Minnesangs.
Warum wird das Lied als "Verteidigungslied" bezeichnet?
Walther wendet sich darin gegen fremde Einflüsse und verteidigt die Vorzüge der eigenen Kultur und Erziehung gegenüber anderen Ländern.
- Quote paper
- Inna Moltschanova (Author), 2004, Preislied 'Ir sult sprechen willekomen', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/38985