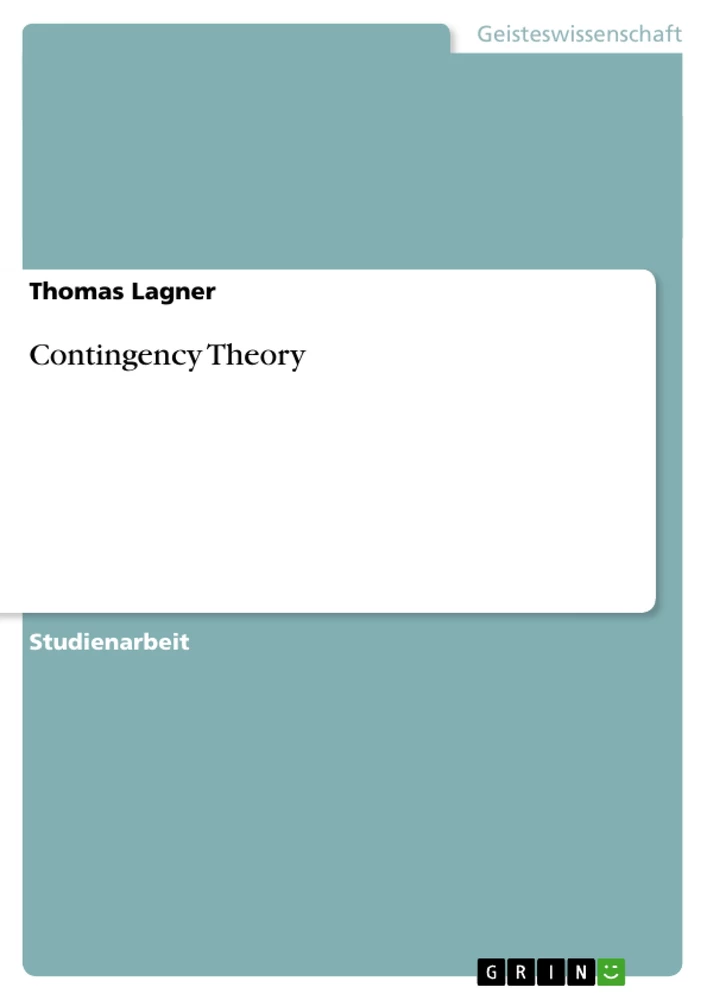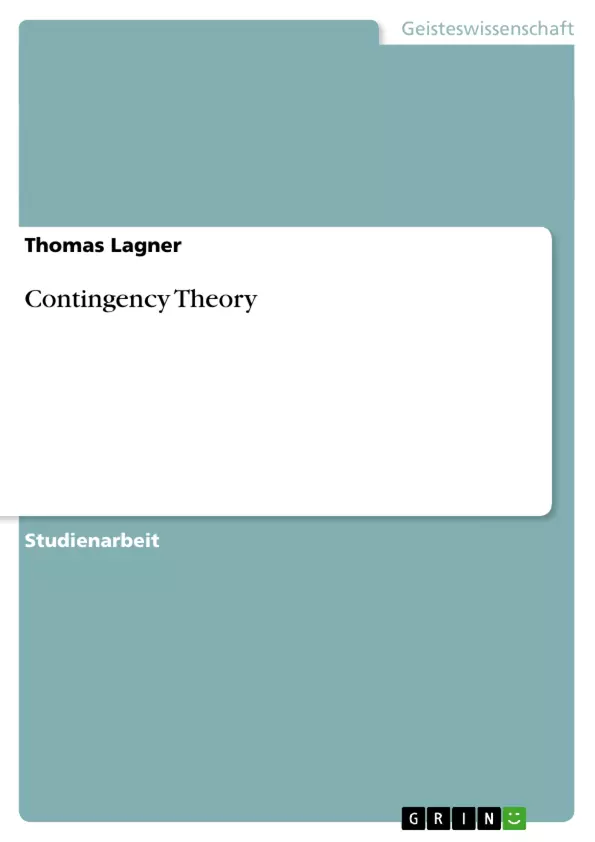Die vorliegende Hausarbeit setzt sich mit dem Thema “Contingency Theory“ auseinander und verfolgt das Ziel einen einführenden Überblick in die Thematik zu liefern. “Contingeny Theory“ beschreibt die Beziehung zwischen den äußeren Bedingungen (Situation) und den inneren Umständen (Struktur) einer Organisation. Von einem pragmatischen Standpunkt aus bedeutet dies, dass die Struktur einer Organisation mittels der Berücksichtigung der kontingenten Faktoren so auszurichten ist, dass sie die höchstmögliche Leistung erzielen kann. Dabei versteht man unter kontingenten Faktoren Einflussgrößen, die die Struktur der Organisation determinieren, aber nicht notwendigerweise vorhanden sein müssen. Das Ausmaß des Einflusses dieser Faktoren ist von der individuellen Situation der Organisation abhängig. Beispiele hierfür sind Einflüsse durch die Umwelt, die Organisationsgröße oder die Fertigungstechnik. Diese Theorie baut daher auf dem Grundsatz auf, dass es keine prinzipiellen Gestaltungsempfehlungen für den Aufbau einer Organisation geben kann (Child 1976, S.1). Zur genaueren Erörterung dieser Thematik gliedert sich die Hausarbeit daher in drei Bereiche: 1.) Entstehung, Methoden und Konzeptionen Die Contingency Theory hat sich aus einer Vielzahl von Forschungsströmungen entwickelt. Sie wurde insbesondere durch Woodward, Blau und Pugh geprägt. In diesem Part werde ich daher die einzelnen Ansätze, sowie die Methoden und Konzeptionen vorstellen, die maßgeblich zur Entstehung der Contingency Theory beigetragen haben. Dabei werde ich mich vorwiegend auf die Literaturquellen „Organisation“ von Kieser und Kubicek (1992) und dem Lehrbuchtext von Kieser zu diesem Seminar “Contingency Theory“ in „Organisationstheorien“ (2002) beziehen. 2.) Analytische Ansätze: Forschungsergebnisse In diesem Teil der Hausarbeit werde ich einen Auszug aus den Analysen einzelner kontingenter Variablen vorstellen. Dabei handelt es sich um die Faktoren Organisationsgröße, Umwelt und Fertigungstechnik. Dazu werde ich mich auf die im Seminar verwendete Literatur beziehen (s.o.), als auch u.a. auf zusätzliche Untersuchungsergebnisse von Child (1976) bzw. auch Lawrence und Lorsch (1967). 3.) Pragmatische Ansätze: Spin-Offs der Contingency Theory [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehung, Methoden und Konzeptionen
- 2.1 Die Entstehung
- 2.1.1 Webers Bürokratiekonzept
- 2.1.2 Managementlehre der 50er
- 2.1.3 Entwicklung von Methoden der vergleichenden empirischen Organisationsforschung
- 2.1.4 Chicago/USA: "Comparative Organizational Analysis" (1970)
- 2.1.5 Birmingham/UK: "Aston Programme" (1976)
- 2.1.6 Das Gesamtkonzept
- 2.2 Konzeptionen und Methoden
- 2.2.1 Der analytische Ansatz
- 2.2.2 Der pragmatische Ansatz
- 2.3 Zusammenfassung
- 2.1 Die Entstehung
- 3. Analytische Ansätze: Forschungsergebnisse
- 3.1 Der Einfluss der Organisationsgröße
- 3.1.1 Modifizierung der Strukturvariablen
- 3.1.2 Untersuchungsergebnisse
- 3.2 Der Einfluss der Umwelt
- 3.2.1 Die interne und externe Dimension
- 3.2.2 Untersuchungsergebnisse
- 3.3 Der Einfluss der Fertigungstechnik
- 3.3.1 Auswirkungen auf die Organisationsstruktur
- 3.3.2 Auswirkungen auf den Spezialisierungsgrad
- 3.3.3 Auswirkungen auf die Koordination
- 3.4 Zusammenfassung
- 3.1 Der Einfluss der Organisationsgröße
- 4. Pragmatische Ansätze: Spin-Offs der Contingency Theory
- 4.1 "Systems Engineering"
- 4.2 "Situational Leadership® II"
- 5. Schlussworte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit bietet einen einführenden Überblick über die Contingency Theory. Sie untersucht die Beziehung zwischen den äußeren Bedingungen (Situation) und der inneren Struktur einer Organisation und beleuchtet, wie die Struktur durch Berücksichtigung kontingenter Faktoren optimiert werden kann. Die Arbeit analysiert die Entstehung der Theorie, verschiedene Forschungsansätze und deren Ergebnisse.
- Entstehung der Contingency Theory aus verschiedenen Forschungsströmungen
- Analyse analytischer Ansätze und deren Forschungsergebnisse zu Einflussfaktoren wie Organisationsgröße, Umwelt und Fertigungstechnik
- Vorstellung pragmatischer Ansätze als Spin-offs der Contingency Theory
- Methodische Entwicklungen in der vergleichenden empirischen Organisationsforschung
- Konzeptionelle Unterschiede zwischen analytischen und pragmatischen Ansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema "Contingency Theory" ein und beschreibt deren Kernprinzip: die Beziehung zwischen den äußeren Bedingungen und der inneren Struktur einer Organisation. Es wird erläutert, dass die optimale Organisationstruktur von kontingenten Faktoren abhängt, die nicht immer vorhanden sein müssen, wie beispielsweise die Umwelt, die Organisationsgröße oder die Fertigungstechnik. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Entstehung, Methoden und Konzeptionen; analytische Ansätze; und pragmatische Ansätze.
2. Entstehung, Methoden und Konzeptionen: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Contingency Theory, die nicht aus einer einzelnen Idee hervorging, sondern aus der Verschmelzung unterschiedlicher Konzepte und methodischer Verbesserungen in den Sozialwissenschaften. Es werden die Beiträge von Weber (Bürokratiekonzept), der Managementlehre der 50er Jahre (kritisiert für zu spezielle oder zu rudimentäre Leitfäden), Woodward (Einfluss der Fertigungstechnik auf Organisationsmerkmale), sowie die Entwicklungen in der vergleichenden empirischen Organisationsforschung (mittels Variablenanalyse und quantitativer Methoden) detailliert dargestellt. Die Kapitel beleuchtet die "Comparative Organizational Analysis" (Chicago) und das "Aston Programme" (Birmingham) als wichtige Meilensteine in der Entwicklung der Theorie. Der Fokus liegt auf dem Beitrag jeder Forschungsrichtung zur Entwicklung des kontingenten Ansatzes.
3. Analytische Ansätze: Forschungsergebnisse: Dieser Abschnitt präsentiert Forschungsergebnisse zu ausgewählten kontingenten Variablen: Organisationsgröße, Umwelt und Fertigungstechnik. Es werden die Modifizierung von Strukturvariablen und die Untersuchungsergebnisse in Bezug auf den Einfluss der Organisationsgröße, die interne und externe Dimension des Umwelteinflusses und die Auswirkungen der Fertigungstechnik auf Organisationsstruktur, Spezialisierungsgrad und Koordination detailliert diskutiert. Die Analyse stützt sich auf die im Seminar verwendete Literatur, sowie zusätzliche Untersuchungsergebnisse von Child (1976) und Lawrence und Lorsch (1967).
Schlüsselwörter
Contingency Theory, Organisationsstruktur, kontingente Faktoren, Organisationsgröße, Umwelt, Fertigungstechnik, analytische Ansätze, pragmatische Ansätze, vergleichende empirische Organisationsforschung, Variablenanalyse, Bürokratie, Managementlehre, Systems Engineering, Situational Leadership.
Häufig gestellte Fragen zur Contingency Theory
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Contingency Theory. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen den äußeren Bedingungen (Situation) und der inneren Struktur einer Organisation und beleuchtet, wie die Struktur durch Berücksichtigung kontingenter Faktoren optimiert werden kann. Die Arbeit analysiert die Entstehung der Theorie, verschiedene Forschungsansätze und deren Ergebnisse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung der Contingency Theory aus verschiedenen Forschungsströmungen, analysiert analytische Ansätze und deren Forschungsergebnisse zu Einflussfaktoren wie Organisationsgröße, Umwelt und Fertigungstechnik, stellt pragmatische Ansätze als Spin-offs der Contingency Theory vor, untersucht methodische Entwicklungen in der vergleichenden empirischen Organisationsforschung und beleuchtet konzeptionelle Unterschiede zwischen analytischen und pragmatischen Ansätzen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Entstehung, Methoden und Konzeptionen der Contingency Theory, ein Kapitel zu analytischen Ansätzen und deren Forschungsergebnissen, ein Kapitel zu pragmatischen Ansätzen als Spin-offs und abschließende Schlussworte. Jedes Kapitel beinhaltet detaillierte Unterpunkte, die die einzelnen Aspekte der Contingency Theory systematisch behandeln.
Welche Forschungsansätze werden untersucht?
Die Arbeit untersucht sowohl analytische als auch pragmatische Ansätze. Die analytischen Ansätze fokussieren auf den Einfluss von Organisationsgröße, Umwelt und Fertigungstechnik auf die Organisationsstruktur. Die pragmatischen Ansätze werden als Ableitungen der Contingency Theory vorgestellt, beispielsweise "Systems Engineering" und "Situational Leadership® II".
Welche methodischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet methodische Entwicklungen in der vergleichenden empirischen Organisationsforschung, inklusive der Variablenanalyse und quantitativer Methoden. Sie beschreibt den analytischen und pragmatischen Ansatz und deren konzeptionelle Unterschiede.
Welche historischen Einflüsse werden berücksichtigt?
Die Arbeit verfolgt die Entwicklung der Contingency Theory von Webers Bürokratiekonzept und der Managementlehre der 50er Jahre bis hin zur "Comparative Organizational Analysis" (Chicago) und dem "Aston Programme" (Birmingham). Sie analysiert den Beitrag jeder Forschungsrichtung zur Entwicklung des kontingenten Ansatzes.
Welche Schlüsselkonzepte werden erklärt?
Schlüsselkonzepte umfassen die Contingency Theory selbst, Organisationsstruktur, kontingente Faktoren, Organisationsgröße, Umwelt, Fertigungstechnik, analytische und pragmatische Ansätze, vergleichende empirische Organisationsforschung, Variablenanalyse, Bürokratie, Managementlehre, Systems Engineering und Situational Leadership.
Welche Forschungsergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Forschungsergebnisse zum Einfluss der Organisationsgröße (inkl. Modifizierung von Strukturvariablen), des Umwelteinflusses (interne und externe Dimension) und der Auswirkungen der Fertigungstechnik auf Organisationsstruktur, Spezialisierungsgrad und Koordination. Die Analyse stützt sich auf im Seminar verwendete Literatur und zusätzliche Untersuchungsergebnisse von Child (1976) und Lawrence und Lorsch (1967).
- Quote paper
- Thomas Lagner (Author), 2004, Contingency Theory, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39045