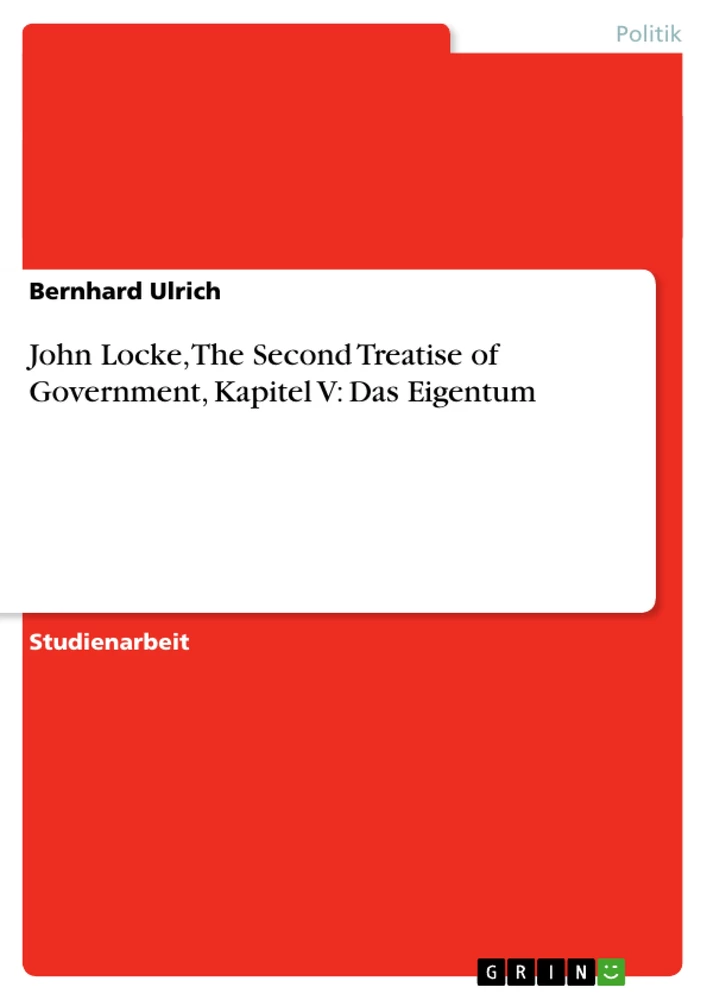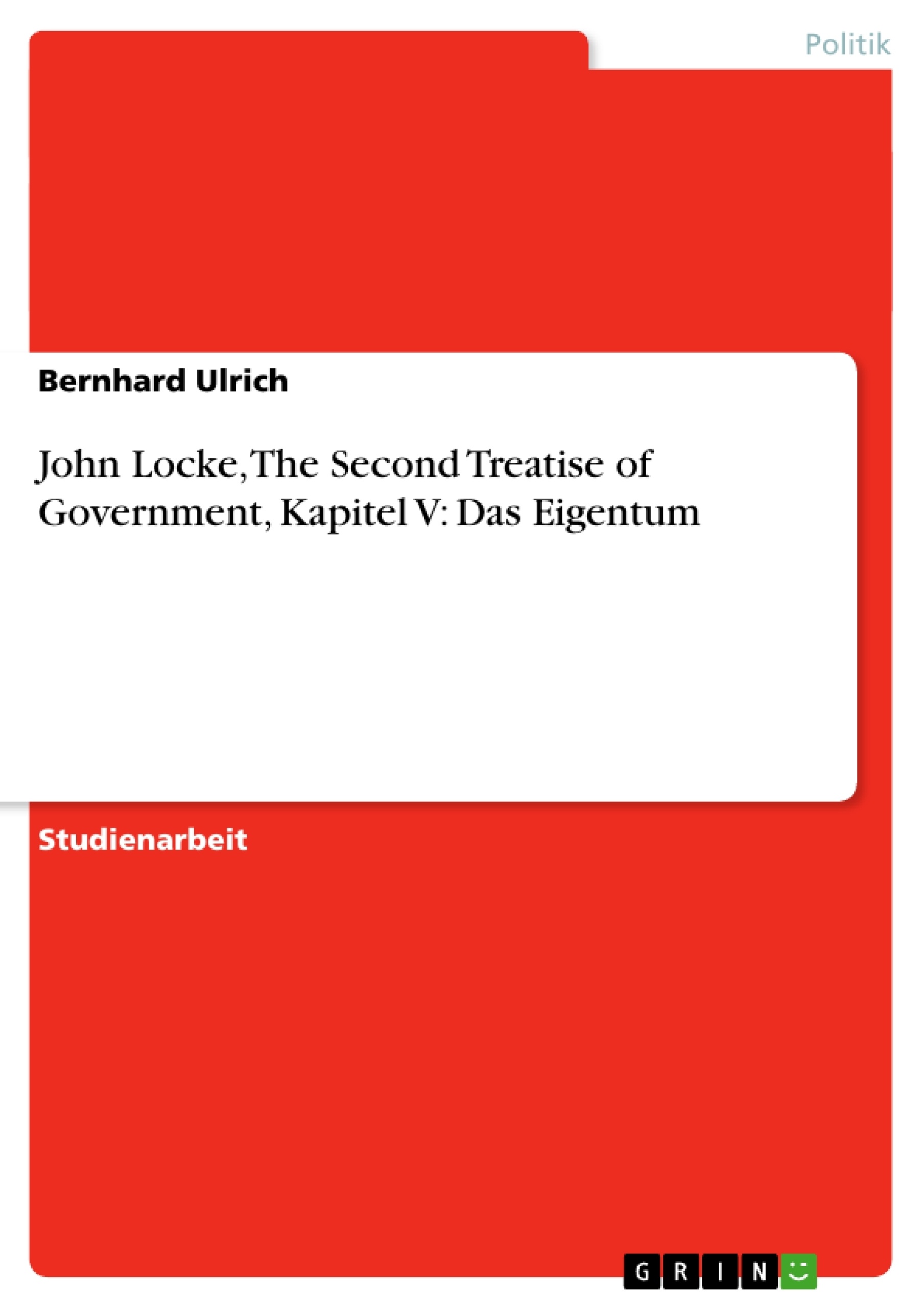In unserer heutigen Konsumgesellschaft spielen materielle Dinge eine wichtige, für manche Menschen sogar die wichtigste Rolle in ihrem Leben. Viele Menschen definieren sich über ihre Besitztümer, wie das eigene Haus, ein Auto oder ihre Kleidung. Die Wirtschaft in den modernen Staaten unserer Erde profitiert von dem gestärkten Konsumverhalten unserer Gesellschaft und wirkt mit Hilfe der Werbung auch direkt auf dieses ein. Auch schon im Kindesalter kommt unser Nachwuchs in den Grundschulen oder im Kindergarten mit der Bedeutung von Markenkleidung oder geldintensiven Hobbys in Berührung. So auc h in der Jugend hat das Privateigentum unserer Eltern und deren Kapital eine mitentscheidende Auswirkung auf unser späteres Leben, sei es durch die Finanzierung unserer weiterführenden Bildung oder durch die Knüpfung wichtiger Kontakte im Bezug auf das Berufsleben. Nun ist die Frage wie nur bestimmte Menschen in den Genuss dieser Vorteile kommen und andere nicht und wie dies seinen Anfang nahm? In der heutigen Zeit kann man Güter mit Hilfe des Geldes erwerben, das man durch geleistete Arbeit erhält und auch vermehren kann. Jedoch wurde der Austausch oder die Aneignung von Gütern nicht schon immer über das Zahlungsmittel Geld abgewickelt. Vor der Einführung des Geldes bemaß man die Güter nach ihrem tatsächlichen Eigenwert, wodurch z.B. Feuerholz im Winter einen höheren Tauschwert hatte als im Sommer. Wenn man nun zurück geht zur Wiege der Menschheit stellt sich die Frage: Wie damals die Aneignung von Gütern gerechtfertigt wurde und vor sich ging? Durch schlichte Okkupation oder durch vertragsförmliche Absprache mit den übrigen Menschen, was sehr unwahrscheinlich ist. Oder war eine Rechtfertigung gegenüber der restlichen Menschheit, z.B. beim Pflücken eines Apfels, überhaupt nötig? Nach der Bibel hat Gott den Menschen die Welt gegeben und zwar hat er sie ihnen gemeinsam gegeben, was bedeutet, dass keiner ein Vorrecht auf bestimmte Dinge hatte. Wenn die Menschen nach diesem Glauben ihre Handlungen ausgerichtet haben, besteht das oben angesprochene Problem der Rechtfertigung und Billigung, bei der Aneignung eines Guts, durch die restliche Menschheit. Wie ist nun dieses Problem zu lösen? [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergrund und Intention der Eigentumstheorie
- Eigentum und Arbeit
- Der Naturzustand
- Die Arbeitstheorie
- Wertung der Arbeit
- Erwerbsschranken
- Die sufficiency Klausel
- Eine versteckte Erwerbsschranke?
- Die spoilation Klausel
- Die Bedeutung und Funktion des Geldes
- Kritik der Eigentumsbegründung John Lockes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert John Lockes Eigentumstheorie, die einen zentralen Bestandteil seines Werkes "The Second Treatise of Government" darstellt. Die Arbeit beleuchtet den historischen Hintergrund und die Intentionen, die Locke zu seiner Abfassung der Theorie motivierten. Darüber hinaus wird die Argumentation der Theorie selbst untersucht und auf Konsistenz überprüft, um einen Einblick in die Eigentumsbegründung zu liefern, die zu Lockes Zeit einen revolutionären Schritt in Bezug auf die damalige Okkupationstheorie bedeutete.
- Die Begründung des natürlichen Rechts auf Privateigentum im Kontext des Naturzustands
- Die Rolle von Arbeit und Wertschöpfung in der Entstehung von Eigentum
- Die Bedeutung von Erwerbsschranken, wie z.B. der sufficiency Klausel, für die Locke'sche Eigentumsordnung
- Die Funktion und der Einfluss von Geld im Kontext der Eigentumstheorie
- Kritik an Lockes Eigentumstheorie und deren historische Relevanz
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Privateigentums ein und stellt den historischen und gesellschaftlichen Kontext der Arbeit dar. Dabei wird die Relevanz des Themas für unsere heutige Zeit hervorgehoben und die Frage nach der Rechtfertigung der Eigentumsaneignung in der Vergangenheit aufgeworfen. Grotius, Pufendorf und John Locke werden als zentrale Denker vorgestellt, die sich mit diesem Problem auseinandersetzten.
- Hintergrund und Intention der Eigentumstheorie: Dieses Kapitel beleuchtet Lockes Biografie und die politischen Ereignisse, die zur Abfassung von "The Two Treatises of Government" führten. Dabei wird der Fokus auf die Auseinandersetzung mit Sir Robert Filmers Theorien gelegt, die die Rechte des Monarchen gegenüber seinen Untertanen rechtfertigten. Lockes Abhandlung soll als Widerlegung von Filmers Argumentation verstanden werden und die Rechte der Bürger auf Eigentum und Widerstand gegen den Monarchen hervorheben.
- Eigentum und Arbeit: Dieses Kapitel analysiert Lockes Darstellung des Rechts auf Privateigentum, das er als zentrale Grundlage für die bürgerliche Gesellschaft betrachtet. Die Theorie basiert auf der Vorstellung des Naturzustands, in dem jeder Mensch ein natürliches Recht auf Besitz besitzt. Die Arbeitstheorie erklärt, wie durch die Hinzufügung von Arbeit an natürliche Ressourcen, Eigentum entsteht.
- Erwerbsschranken: Dieses Kapitel widmet sich den Erwerbsschranken, die Locke in seiner Theorie definiert. Die sufficiency Klausel besagt, dass jeder Mensch genug Eigentum besitzen sollte, um seinen Bedarf zu decken. Die spoilation Klausel begrenzt den Erwerb von Eigentum durch die Vermeidung von Verschwendung und Verfall.
Schlüsselwörter
Diese Hausarbeit konzentriert sich auf die Eigentumsbegründung John Lockes, die zentrale Themen wie den Naturzustand, die Arbeitstheorie, Erwerbsschranken, die Rolle von Geld sowie Kritik an der Theorie selbst umfasst. Die Arbeit analysiert die historische Relevanz von Lockes Ideen für die Entwicklung der modernen Eigentumsordnung.
- Citar trabajo
- Bernhard Ulrich (Autor), 2005, John Locke, The Second Treatise of Government, Kapitel V: Das Eigentum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39148