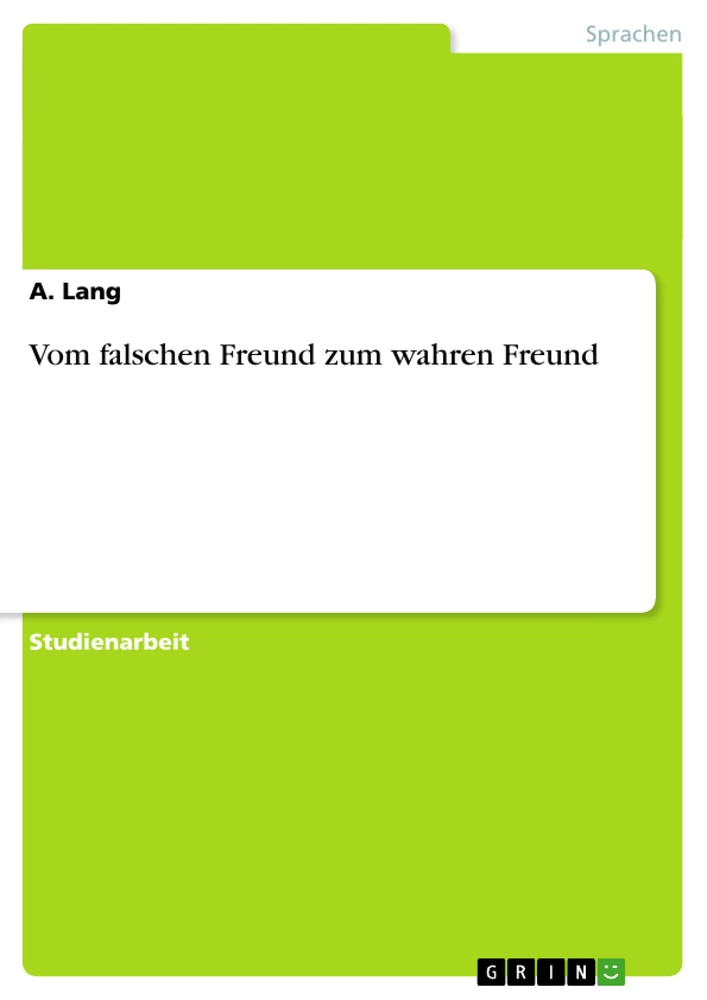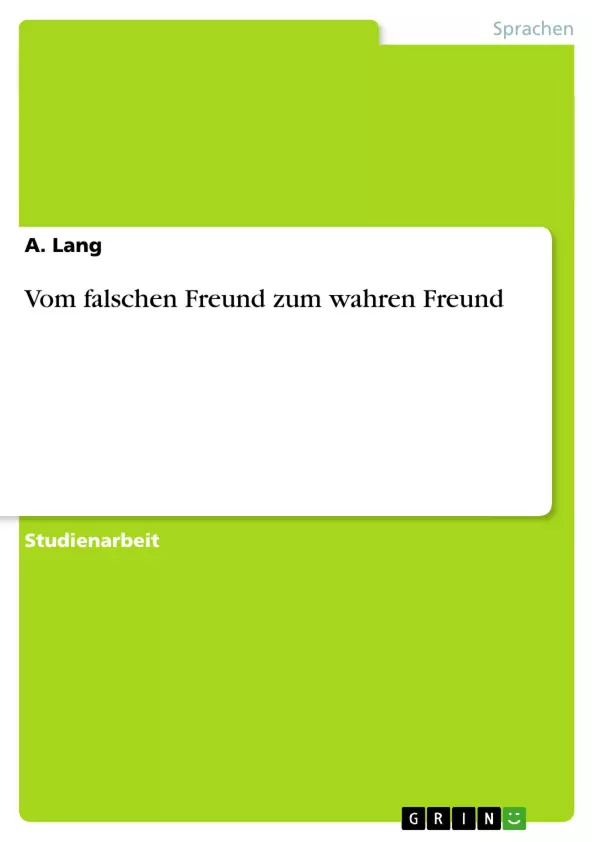Bei der Übersetzung eines Textes übersetzte ich mit grösster Selbstverständlichkeit den niederländischen Ausdruck ‚dat kan je schudden‘
wortwörtlich ins Deutsche als ‚das kannst du schütteln‘. Ich hatte dies von einem niederländischen Muttersprachler, mit dem ich mich sehr viel auf Deutsch unterhielt, wohl wiederholt gehört, bis sich mein Ohr daran gewöhnte, und ich den Ausdruck unbewusst als korrekt in die deutsche Sprache integrierte. Das Problem der „falschen Freunde“, der Täuschung aufgrund ähnlicher oder auch identischer Wörter bei unterschiedlicher Bedeutung in Quell- und Zielsprache ist wahrscheinlich jedem bekannt, der sich jemals bemühte, eine fremde Sprache zu erlernen. Das folgende schriftliche Referat wird sich mit diesem Problem befassen, und sich dabei ganz besonders dem Sprachenpaar Deutsch – Niederländisch widmen. Besonders eng verwandte Sprachen wie das Deutsche und das Niederländische bieten zahlreiche Fallen und Fehlerquellen, in die sowohl Lernende einer Fremdsprache, aber auch professionelle Übersetzer immer wieder hineintappen. Vielfach werden die Differenzen der Sprachen vom Lernenden unterschätzt. Im Gegensatz dazu sind professionelle Übersetzer oft bereits so stark auf dieses Problem konditioniert, dass sie in übereifriger Wachsamkeit manchmal auch bei korrekten identischen Übereinstimmung Misstrauen hegen. Im Folgenden werden Unterschiedliche Arten von falschen Freunden und einige Beschreibungsmöglichkeiten der Irrtumquellen vorgestellt. Zur Veranschaulichung der Probleme sollen Beispiele dienen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Terminologie
- Definition
- Arten der falschen Freunde
- Falsche Freunde auf der lexikalisch-semantischen Ebene
- Zufällige Interferenz des Schrift- oder Lautbildes
- Partiell wahre Freunde mit mindestens einer starken semantischen Abweichung
- Partiell wahre Freunde mit leicht abweichender semantischen Markierung der Lexeme
- Wortkreationen durch identische Übertragung der Morpheme
- Falsche Freunde auf der Phrasenebene
- Falsche Freunde auf der syntaktisch-semantischen Ebene
- Falsche Freunde auf der lexikalisch-semantischen Ebene
- Schlusswort
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat befasst sich mit dem Phänomen der "falschen Freunde", einer Herausforderung, die sich beim Erlernen und Übersetzen von Sprachen stellt. Im Fokus stehen dabei die Sprachen Deutsch und Niederländisch, deren enge Verwandtschaft zu zahlreichen Fallen und Fehlerquellen führt. Das Ziel des Referats ist es, verschiedene Arten von falschen Freunden zu analysieren und die Ursachen für die Verwechslungen aufzuzeigen.
- Analyse verschiedener Arten von falschen Freunden
- Untersuchung der Ursachen für Verwechslungen zwischen Wörtern in Deutsch und Niederländisch
- Beispiele für falsche Freunde auf lexikalisch-semantischer und syntaktisch-semantischer Ebene
- Betrachtung der Rolle von Schriftbild, Lautform und Bedeutung bei der Entstehung von falschen Freunden
- Herausarbeitung der Schwierigkeiten, die durch falsche Freunde für Lernende und Übersetzer entstehen
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Das Vorwort schildert eine persönliche Erfahrung mit falschen Freunden im Kontext der Übersetzung. Der Autor beschreibt, wie er den Ausdruck "dat kan je schudden" im Niederländischen wörtlich ins Deutsche übersetzte, obwohl er eine andere Bedeutung hat. Dieser Fehler wurde durch den Einfluss eines niederländischen Muttersprachlers verursacht, der den Ausdruck oft im Gespräch verwendete.
- Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der "falschen Freunde" ein. Es wird hervorgehoben, dass das Problem der Täuschung aufgrund ähnlicher Wörter in verschiedenen Sprachen jedem bekannt ist, der sich mit dem Erlernen einer Fremdsprache auseinandersetzt. Das Referat konzentriert sich dabei auf das Sprachenpaar Deutsch und Niederländisch, da sie besonders viele Fallen und Fehlerquellen bieten.
- Terminologie: Dieses Kapitel behandelt die Begrifflichkeit der "falschen Freunde". Der Begriff wurde von der französischen Sprachwissenschaftlerin M. Kœssler im Jahr 1928 geprägt. Trotz seiner Abgrenzung von üblichen linguistischen Fachbegriffen hat er sich bis heute durchgesetzt. Die "falschen Freunde" werden manchmal auch als (zwischensprachliche) Paronyme bezeichnet.
- Definition: Dieses Kapitel liefert eine Definition der "falschen Freunde". Es wird erklärt, dass es sich dabei um Wörter in einer Fremdsprache handelt, die in Schriftbild oder Lautform einem Wort der eigenen Sprache ähneln, aber eine andere oder sogar völlig verschiedene Bedeutung haben. Beispiele wie "gift" im Englischen und "Gift" im Deutschen werden genannt.
- Arten der falschen Freunde: Dieses Kapitel behandelt verschiedene Arten von falschen Freunden. Es werden verschiedene Ursachen und Kategorien von Verwechslungen beschrieben, die zu falschen Lexemwahlen führen können. Von einfachen Wortverwechslungen aufgrund ähnlicher Schriftbilder bis hin zu kulturell bedingten semantischen Abweichungen werden unterschiedliche Aspekte beleuchtet.
- Falsche Freunde auf der lexikalisch-semantischen Ebene: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Formen von falschen Freunden auf der Ebene der Wortbedeutung. Es wird beispielsweise die Kategorie der "zufälligen Interferenz des Schrift- oder Lautbildes" behandelt, die auf einer rein zufälligen Ähnlichkeit von Wörtern beruht.
Schlüsselwörter
Falsche Freunde, Paronyme, Deutsch, Niederländisch, Interferenz, Lexem, Bedeutung, Schriftbild, Lautform, Übersetzung, Sprachenpaar, Fehlerquelle, Verwechslung, Sprachvergleich, kulturelle Unterschiede, Sprachwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind "falsche Freunde" in der Sprachwissenschaft?
Es handelt sich um Wörter in verschiedenen Sprachen, die sich in Schriftbild oder Lautform ähneln, aber unterschiedliche oder völlig gegensätzliche Bedeutungen haben.
Warum sind Deutsch und Niederländisch besonders anfällig für dieses Phänomen?
Aufgrund der engen Verwandtschaft beider Sprachen unterschätzen Lernende oft die Unterschiede, was zu häufigen Verwechslungen führt.
Was ist der Unterschied zwischen lexikalisch-semantischen und syntaktischen falschen Freunden?
Lexikalisch-semantische Fehler beziehen sich auf die Wortbedeutung, während syntaktisch-semantische Fehler die Satzstruktur und deren Bedeutung betreffen.
Wer prägte den Begriff "falsche Freunde"?
Der Begriff wurde 1928 von der französischen Sprachwissenschaftlerin M. Kœssler eingeführt.
Gibt es auch "partiell wahre Freunde"?
Ja, das sind Wörter, die in einigen Kontexten die gleiche Bedeutung haben, aber in anderen semantisch stark abweichen.
- Quote paper
- A. Lang (Author), 2001, Vom falschen Freund zum wahren Freund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39178