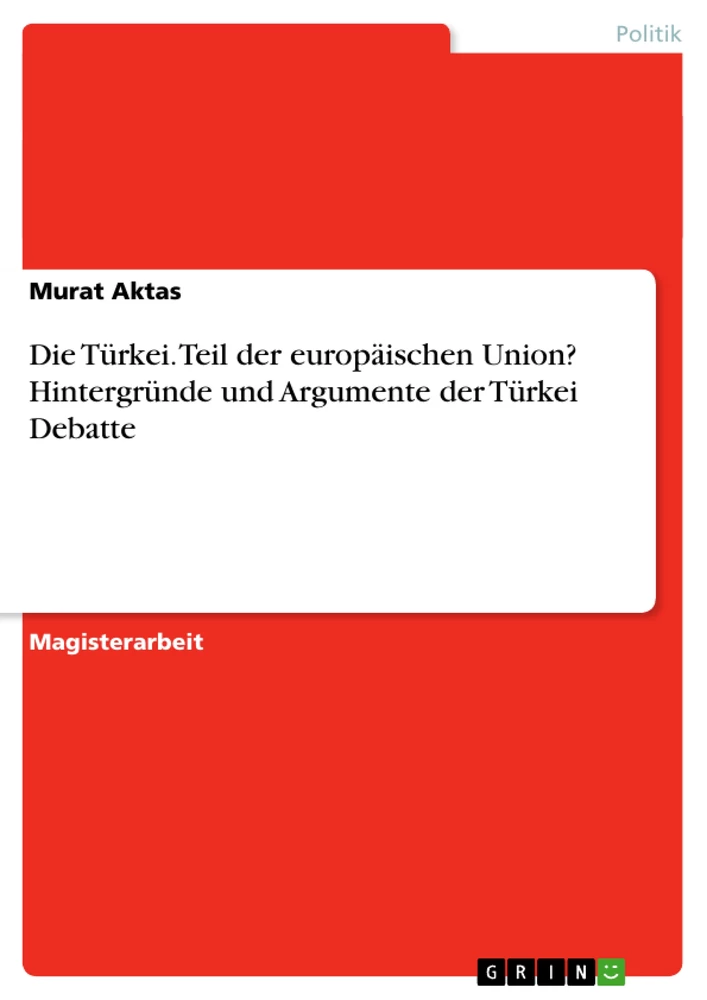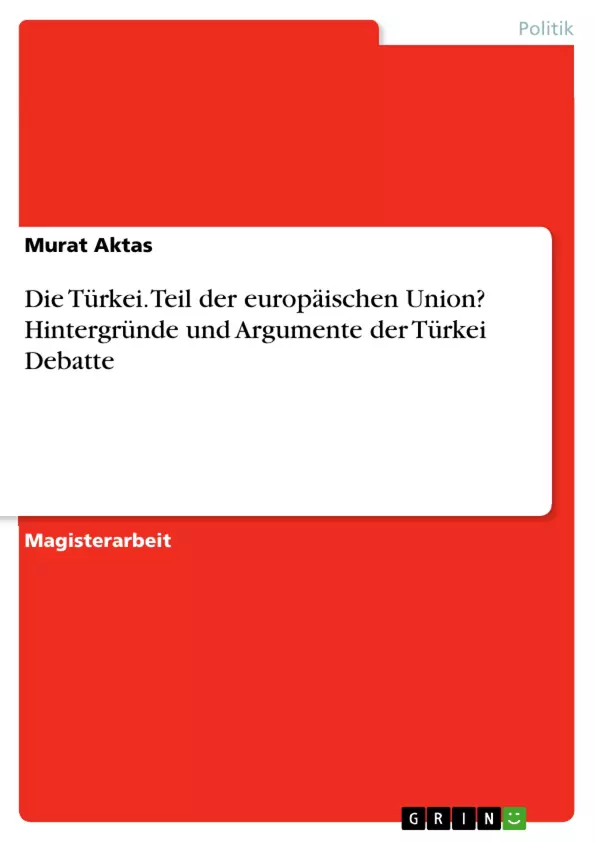Als Grenzland zwischen Europa und Asien, zwischen Christentum und Islam und zwischen östlichem und westlichem Kulturkreis, lässt die Türkei in ihrer Geschichte bereits seit Ende des 15. Jhr. ein großes Interesse an Europa erkennen. Kontinuierlich bewegte sich die Türkei seit dem ausgehenden 19. Jhr. auf Europa zu, indem sie westliche Gesellschaftsentwürfe zum Leitbild der Modernisierung von Staat und Wirtschaft machte. Dieser Entwicklung wird jedoch keine angemessene Achtung geschenkt. Vielmehr wird die osmanisch-europäische Beziehungsgeschichte als Verlauf einer Konfrontation aufgefasst, und zwar einer zwischen dem Islam und dem Christentum. Zugleich wird der Aufstieg des Osmanenreiches dann gern als ein Werk des Dschihad, des islamischen heiligen Krieges, interpretiert. So entstand das Bild eines Imperiums, welches den Europäern Jahrhunderte lang als die Bedrohung schlechthin erschien – ein Weltreich, welches durch Krieg entstanden war, sich durch Krieg reproduzierte, und eines Tages selbstverständlich durch Krieg zerstört werden sollte. Dabei wird der Einfluss europäischen Denkens auf die Türkei von den Europäern vielfach unterschätzt. Tatsächlich befand sich die Türkei vor allem im 19. und 20. Jhr. auf dem Weg nach Europa. Die staatlichen Strukturen des Landes – parlamentarisch-repräsentative Demokratie, Rechtssystem, Verwaltung – sind im Gegensatz zu allen anderen muslimisch geprägten Staaten weitgehend von europäischen Vorbildern durchdrungen. Damit stellte und stellt sich für das Land zwangsläufig die Frage nach einem Beitritt zur Europäischen Union als krönendes Ereignis dieser Entwicklung - und dies nicht erst seit wenigen Jahren, sondern seit Jahrzehnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historische Beziehungen zwischen Europa und der Türkei
- 2.1 Das Türkentum in Europa (14.-17. Jhr.)
- 2.2 Die Wurzeln der Westorientierung
- 2.2.1 Die Tanzimat-Periode (1839-1880)
- 2.2.2 Die Jungtürken (1908-1918)
- 2.3 Der Zerfall des Osmanischen Reiches und die Neue Republik “Türkei“
- 2.3.1 Die Ziele der Reformen von Atatürk
- 2.3.2 Der Kemalismus und die \"Sechs Pfeiler\"
- 3. Der institutionelle Anschluss an den Westen
- 3.1 Das Assoziierungsabkommen (1963)
- 3.2 Der Antrag auf EG-Vollmitgliedschaft (1987)
- 3.3 Die Zollunion (1996)
- 3.4 Die Beitrittsgesuche der Türkei (1997)
- 3.5 Der Beschluss von Helsinki (1999)
- 3.6 Das Dokument über die Beitrittspartnerschaft (2001)
- 4. Die politischen Reformen in der Türkei
- 4.1 Stabile Institutionen
- 4.1.1 Regierung
- 4.1.2 Parlament - Wahlen - Parteien
- 4.2 Das Militär
- 4.3 Die Rechtsstaatlichkeit
- 4.4 Die Menschenrechtslage
- 4.4.1 Die Todesstrafe
- 4.4.2 Die Folter
- 4.4.3 Der Strafvollzug
- 4.4.4 Die Meinungs- und Vereinigungsfreiheit
- 4.4.5 Die Minderheitenrechte
- 4.4.5.1 Das Kurdenproblem
- 4.4.5.2 Die nichtmuslimischen Minderheiten
- 5. EU-Positionen
- 6. Türkische Perspektiven - Chancen und Risiken aus einer Vollmitgliedschaft für die Türkei
- 6.1 Politik
- 6.2 Gesellschaft
- 6.3 Wirtschaft
- 7. Europäische Perspektiven - Chancen und Risiken aus einer Vollmitgliedschaft für Europa (Hintergründe und Argumente)
- 7.1 Ist die Türkei ein europäisches Land?
- 7.2 Kulturelle Dimensionen
- 7.2.1 Die Türkei als “das Andere”
- 7.2.2 Die politische Kultur
- 7.2.3 Zur Identität
- 7.2.3.1 Die europäische Identität
- 7.2.3.2 Die türkische Identität
- 7.2.4 Zur Religion
- 7.2.5 Die kulturelle Vereinbarkeit
- 7.3 Geopolitische Dimensionen
- 7.3.1 Geopolitische und geostrategische Bedeutung der Türkei
- 7.3.1.1 Geopolitische Bedeutung
- 7.3.1.2 Geostrategische Bedeutung
- 7.3.2 Energie- und Sicherheitspolitik
- 7.3.2.1 Die Türkei als Energieversorger
- 7.3.2.2 Die Türkei als sicherheitspolitischer Stabilitätsakteur
- 7.4 Wirtschaftliche und institutionelle Dimensionen
- 7.4.1 Wirtschaftliche und soziale Aspekte
- 7.4.2 Politische und institutionelle Aspekte
- 8. EU-Beitritt der Türkei als Zeichen für den Dialog der Kulturen?
- 9. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Debatte um einen möglichen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union. Ziel ist es, die historischen Hintergründe, politischen Reformen in der Türkei, die Positionen der EU und die jeweiligen Chancen und Risiken für beide Seiten zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die vielschichtigen Aspekte dieser komplexen Frage.
- Historische Beziehungen zwischen Europa und der Türkei
- Politische und institutionelle Reformen in der Türkei
- Positionen der EU zum türkischen Beitritt
- Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen eines Beitritts
- Kulturelle und geopolitische Dimensionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit untersucht die Debatte um einen türkischen EU-Beitritt, seine historischen Wurzeln und die damit verbundenen Chancen und Risiken. Der Fokus liegt auf der Aktualität des Themas und der Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Argumente von Befürwortern und Gegnern.
2. Historische Beziehungen zwischen Europa und der Türkei: Dieses Kapitel beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen Europa und der Türkei von der osmanischen Herrschaft bis zur Gründung der Republik. Es analysiert den Einfluss europäischer Ideen auf die Modernisierung der Türkei und die wechselseitige Wahrnehmung von Konfrontation und Zusammenarbeit.
3. Der institutionelle Anschluss an den Westen: Hier wird der Prozess der zunehmenden Annäherung der Türkei an den Westen durch Assoziierungsabkommen, Beitrittsgesuche und die Zollunion detailliert dargestellt. Es wird die schrittweise Entwicklung der Beziehungen und die Bedeutung der einzelnen Meilensteine untersucht.
4. Die politischen Reformen in der Türkei: Dieses Kapitel analysiert die politischen und institutionellen Reformen in der Türkei im Hinblick auf die EU-Beitrittskriterien. Es beleuchtet die Entwicklung stabiler Institutionen, die Rolle des Militärs, die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechtslage, einschließlich des Kurdenproblems und der Behandlung nichtmuslimischer Minderheiten.
5. EU-Positionen: Dieser Abschnitt präsentiert die verschiedenen Positionen innerhalb der EU zum Thema Türkei-Beitritt, einschließlich der Argumente der Befürworter und Gegner. Die politischen und strategischen Überlegungen der EU-Mitgliedsstaaten werden analysiert.
6. Türkische Perspektiven - Chancen und Risiken aus einer Vollmitgliedschaft für die Türkei: Dieses Kapitel beleuchtet die potenziellen Chancen und Risiken eines EU-Beitritts aus türkischer Perspektive in den Bereichen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Es werden die möglichen Auswirkungen auf die nationale Identität und die innenpolitische Entwicklung untersucht.
7. Europäische Perspektiven - Chancen und Risiken aus einer Vollmitgliedschaft für Europa (Hintergründe und Argumente): Ähnlich wie Kapitel 6, aber aus europäischer Sicht. Die kulturellen, geopolitischen, wirtschaftlichen und institutionellen Dimensionen eines türkischen Beitritts werden hier aus der Perspektive der EU-Mitgliedsstaaten analysiert.
8. EU-Beitritt der Türkei als Zeichen für den Dialog der Kulturen?: Das Kapitel diskutiert die symbolische Bedeutung eines möglichen Beitritts als Zeichen für einen interkulturellen Dialog zwischen Europa und der islamischen Welt.
Schlüsselwörter
Türkei, Europäische Union, EU-Beitritt, Beitrittsverhandlungen, historische Beziehungen, politische Reformen, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Kultur, Geopolitik, Wirtschaft, Identität, Kemalismus, Kurdenproblem, Assoziierungsabkommen, Zollunion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: "Die Türkei und die Europäische Union - Chancen und Risiken eines Beitritts"
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Debatte um einen möglichen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union. Sie analysiert die historischen Hintergründe, politischen Reformen in der Türkei, die Positionen der EU und die jeweiligen Chancen und Risiken für beide Seiten. Die Arbeit beleuchtet die vielschichtigen Aspekte dieser komplexen Frage.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themenschwerpunkte: historische Beziehungen zwischen Europa und der Türkei, politische und institutionelle Reformen in der Türkei, Positionen der EU zum türkischen Beitritt, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen eines Beitritts, kulturelle und geopolitische Dimensionen, sowie die jeweiligen Chancen und Risiken für die Türkei und die EU.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in neun Kapitel gegliedert. Sie beginnt mit einer Einleitung und einem Überblick über die Zielsetzung und Themenschwerpunkte. Es folgen Kapitel zur historischen Beziehung zwischen Europa und der Türkei, dem institutionellen Anschluss an den Westen, den politischen Reformen in der Türkei und den EU-Positionen. Die Kapitel 6 und 7 befassen sich mit den Chancen und Risiken eines Beitritts aus türkischer und europäischer Perspektive. Kapitel 8 diskutiert den EU-Beitritt als Zeichen für den Dialog der Kulturen, und Kapitel 9 bietet eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche historischen Beziehungen zwischen Europa und der Türkei werden untersucht?
Die Arbeit beleuchtet die komplexen Beziehungen zwischen Europa und der Türkei von der osmanischen Herrschaft bis zur Gründung der Republik. Sie analysiert den Einfluss europäischer Ideen auf die Modernisierung der Türkei und die wechselseitige Wahrnehmung von Konfrontation und Zusammenarbeit, inklusive der Tanzimat-Periode, der Jungtürken und der Reformen Atatürks.
Welche politischen Reformen in der Türkei werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die politischen und institutionellen Reformen in der Türkei im Hinblick auf die EU-Beitrittskriterien. Es werden die Entwicklung stabiler Institutionen, die Rolle des Militärs, die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechtslage, einschließlich des Kurdenproblems und der Behandlung nichtmuslimischer Minderheiten untersucht. Spezifische Themen sind die Todesstrafe, Folter, Strafvollzug, Meinungs- und Vereinigungsfreiheit sowie Minderheitenrechte.
Welche Positionen vertritt die EU zum Thema Türkei-Beitritt?
Die Arbeit präsentiert die verschiedenen Positionen innerhalb der EU zum Thema Türkei-Beitritt, einschließlich der Argumente der Befürworter und Gegner. Die politischen und strategischen Überlegungen der EU-Mitgliedsstaaten werden analysiert.
Welche Chancen und Risiken eines EU-Beitritts werden für die Türkei betrachtet?
Aus türkischer Perspektive werden die potenziellen Chancen und Risiken eines EU-Beitritts in den Bereichen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft untersucht. Es werden die möglichen Auswirkungen auf die nationale Identität und die innenpolitische Entwicklung analysiert.
Welche Chancen und Risiken eines EU-Beitritts werden für die EU betrachtet?
Aus europäischer Sicht werden die kulturellen, geopolitischen, wirtschaftlichen und institutionellen Dimensionen eines türkischen Beitritts analysiert. Die Arbeit untersucht Fragen wie die kulturelle Vereinbarkeit, die geopolitische und geostrategische Bedeutung der Türkei, die Energie- und Sicherheitspolitik sowie wirtschaftliche und soziale Aspekte.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit zum Thema "EU-Beitritt als Zeichen für den Dialog der Kulturen"?
Das Kapitel 8 diskutiert die symbolische Bedeutung eines möglichen Beitritts als Zeichen für einen interkulturellen Dialog zwischen Europa und der islamischen Welt. Die Arbeit liefert jedoch keine explizite Schlussfolgerung in diesem Kapitel, sondern eröffnet die Diskussion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Türkei, Europäische Union, EU-Beitritt, Beitrittsverhandlungen, historische Beziehungen, politische Reformen, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Kultur, Geopolitik, Wirtschaft, Identität, Kemalismus, Kurdenproblem, Assoziierungsabkommen, Zollunion.
- Citar trabajo
- Murat Aktas (Autor), 2005, Die Türkei. Teil der europäischen Union? Hintergründe und Argumente der Türkei Debatte, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39480