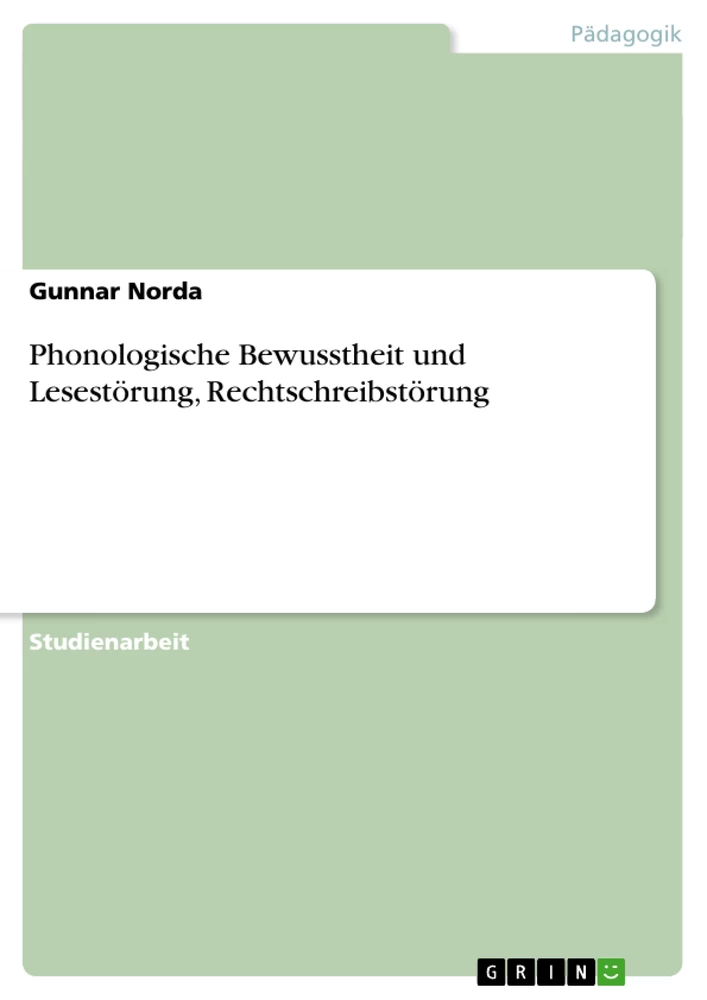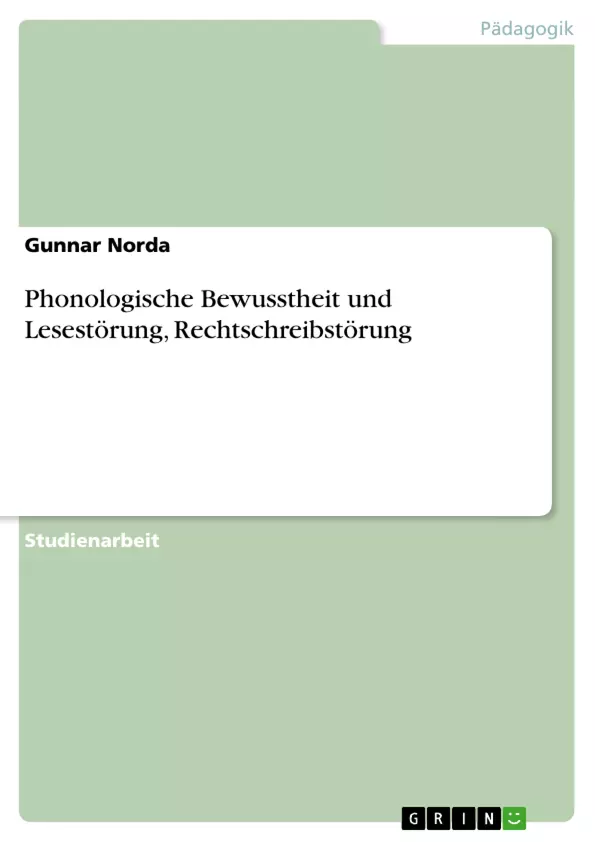Im Folgenden beschäftige ich mich mit dem Zusammenhang der Lese- und Rechtschreibstörung mit der phonologischen Bewusstheit. Bei Durchsicht der relevanten Literatur zum Thema LRS wird recht schnell vor Augen geführt, dass die Legasthenie noch längst nicht vollkommen erforscht ist. Im Gegenteil, häufig gibt es auch widersprüchliche Meinungen und Befunde zu bestimmten Aspekten dieser Entwicklungsstörung. So ist z.B. immer noch nicht geklärt, ob sprachspezifische und/oder nicht-sprachspezifische Defizite der LRS zugrunde liegen.
Der Zusammenhang von phonologischer Bewusstheit und LRS bzw. Lese-, Rechtschreibfähigkeit/Schriftspracherwerb ist dagegen unstrittig. Meine Arbeit wird daher die phonologische Bewusstheit näher erläutern und diesen Zusammenhang deutlich zu machen versuchen. Die Bedeutung von Förderung der phonologischen Bewusstheit soll ebenfalls thematisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was bedeutet „phonologische Bewusstheit“?
- Definition
- Erfassung
- Neurobiologische Aspekte
- Die Bedeutung phonologischer Bewusstheit für den Schriftspracherwerb
- Die „normalen“ Stufen des Schriftspracherwerbs
- Das Lesenlernen
- Das (Recht-) Schreibenlernen
- Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb
- Die Würzburger Studien zur Förderung phonologischer Bewusstheit
- Die erste Würzburger Studie
- Das Trainingsprogramm der Würzburger Studien
- Wichtigste Befunde
- Die zweite Würzburger Studie
- Ablauf und Trainingspogramm
- Wichtigste Befunde
- Effekte des Trainings für schriftsprachliche Kompetenzen
- Training mit „Risikokindern“ (die dritte Würzburger Studie)
- Ablauf und Trainingspogramm der dritten Würzburger Studie
- Wichtigste Befunde
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und Lese-Rechtschreibstörungen (LRS). Ziel ist es, die phonologische Bewusstheit zu definieren, ihre Bedeutung für den Schriftspracherwerb zu erläutern und die Ergebnisse von Förderstudien, insbesondere der Würzburger Studien, darzustellen. Die Arbeit beleuchtet den aktuellen Forschungsstand und zeigt die Komplexität des Themas auf.
- Definition und Erfassung phonologischer Bewusstheit
- Entwicklung des Schriftspracherwerbs (Lesen und Schreiben)
- Einfluss der phonologischen Bewusstheit auf den Schriftspracherwerb
- Ergebnisse der Würzburger Studien zur Förderung phonologischer Bewusstheit
- Neurobiologische Aspekte der phonologischen Bewusstheit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Lese-Rechtschreibstörung (LRS) und deren Zusammenhang mit phonologischer Bewusstheit ein. Sie betont den noch nicht vollständig erforschten Charakter der LRS und die kontroversen Meinungen zu den zugrundeliegenden Defiziten. Die Arbeit fokussiert auf den unstrittigen Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und LRS und plant, diesen Zusammenhang detailliert zu erläutern und die Bedeutung der Förderung phonologischer Bewusstheit zu thematisieren.
Was bedeutet „phonologische Bewusstheit“?: Dieses Kapitel beschreibt die phonologische Bewusstheit als eine Komponente der Lautverarbeitung, die die Fähigkeit bezeichnet, lautliche Strukturen von Sprache und Schrift zu erkennen und zu bearbeiten. Es differenziert zwischen der Erfassung der phonologischen Bewusstheit im weiteren und engeren Sinne, wobei verschiedene Methoden und linguistische Einheiten (Phoneme, Silben, Wörter) betrachtet werden. Zudem werden neurobiologische Aspekte beleuchtet, inklusive kortikaler Aktivierungsmuster im Gehirn und genetischer Einflüsse.
Die Bedeutung phonologischer Bewusstheit für den Schriftspracherwerb: Dieses Kapitel beschreibt zunächst die „normalen“ Stufen des Schriftspracherwerbs, sowohl beim Lesenlernen (logographisches, alphabetisches und orthographisches Stadium nach Frith) als auch beim Schreibenlernen (von willkürlichen Buchstabenfolgen bis zur Anwendung orthographischer Regeln). Anschließend wird der Einfluss der phonologischen Bewusstheit auf diese Prozesse detailliert untersucht und herausgearbeitet, wie die Fähigkeit, lautliche Strukturen zu analysieren und zu manipulieren, das Lesen und Schreibenlernen maßgeblich unterstützt.
Die Würzburger Studien zur Förderung phonologischer Bewusstheit: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der drei Würzburger Studien zusammen, die sich mit der gezielten Förderung phonologischer Bewusstheit bei Kindern befassten. Es beschreibt die jeweiligen Trainingsprogramme und die wichtigsten Befunde, wobei der Fokus auf den Effekten des Trainings auf die schriftsprachlichen Kompetenzen liegt. Die Studien beleuchten unterschiedliche Altersgruppen und Risikofaktoren, um den Effekt gezielter Interventionen auf die Entwicklung phonologischer Bewusstheit und deren Auswirkungen auf das Lesen und Schreiben zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Phonologische Bewusstheit, Lese-Rechtschreibstörung (LRS), Schriftspracherwerb, Lesenlernen, Schreibenlernen, Lautverarbeitung, Förderprogramme, Würzburger Studien, Neurobiologie, Genetik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Phonologische Bewusstheit und Schriftspracherwerb
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und dem Schriftspracherwerb, insbesondere im Hinblick auf Lese-Rechtschreibstörungen (LRS). Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf den Würzburger Studien, die sich mit der Förderung phonologischer Bewusstheit befassen.
Was versteht man unter „phonologischer Bewusstheit“?
Phonologische Bewusstheit bezeichnet die Fähigkeit, die lautliche Struktur von Sprache zu erkennen und zu manipulieren. Das beinhaltet das Bewusstsein für Reime, Silben, und Phoneme (die kleinsten lautlichen Einheiten). Das Dokument beschreibt verschiedene Methoden zur Erfassung phonologischer Bewusstheit und beleuchtet auch die neurobiologischen Aspekte, wie kortikale Aktivierungsmuster und genetische Einflüsse.
Welche Bedeutung hat phonologische Bewusstheit für den Schriftspracherwerb?
Phonologische Bewusstheit ist essentiell für den Schriftspracherwerb. Die Fähigkeit, lautliche Strukturen zu analysieren und zu manipulieren, unterstützt das Lesenlernen (von der logographischen, über die alphabetische bis zur orthographischen Phase) und das Schreibenlernen (vom willkürlichen Schreiben bis zur Anwendung orthographischer Regeln). Das Dokument erläutert detailliert diesen Zusammenhang.
Was sind die Würzburger Studien und was sind ihre wichtigsten Ergebnisse?
Die Würzburger Studien sind drei Forschungsarbeiten, die sich mit der gezielten Förderung phonologischer Bewusstheit bei Kindern befassen. Das Dokument beschreibt die jeweiligen Trainingsprogramme und die wichtigsten Befunde der drei Studien, inklusive ihrer Auswirkungen auf die schriftsprachlichen Kompetenzen von Kindern unterschiedlicher Altersgruppen und mit verschiedenen Risikofaktoren für LRS.
Welche Zielsetzung verfolgt dieses Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen phonologischer Bewusstheit und Lese-Rechtschreibstörungen (LRS) zu untersuchen. Es definiert die phonologische Bewusstheit, erläutert ihre Bedeutung für den Schriftspracherwerb und präsentiert die Ergebnisse der Würzburger Studien. Die Komplexität des Themas und der aktuelle Forschungsstand werden beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Phonologische Bewusstheit, Lese-Rechtschreibstörung (LRS), Schriftspracherwerb, Lesenlernen, Schreibenlernen, Lautverarbeitung, Förderprogramme, Würzburger Studien, Neurobiologie, Genetik.
Wie sind die „normalen“ Stufen des Schriftspracherwerbs definiert?
Das Dokument beschreibt die "normalen" Stufen des Schriftspracherwerbs beim Lesenlernen (logographisch, alphabetisch, orthographisch nach Frith) und beim Schreibenlernen (von willkürlichen Buchstabenfolgen bis zur Anwendung orthographischer Regeln).
Wie werden neurobiologische Aspekte der phonologischen Bewusstheit betrachtet?
Der Text beleuchtet neurobiologische Aspekte, darunter kortikale Aktivierungsmuster im Gehirn und den Einfluss genetischer Faktoren auf die phonologische Bewusstheit.
- Citar trabajo
- Gunnar Norda (Autor), 2005, Phonologische Bewusstheit und Lesestörung, Rechtschreibstörung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39542