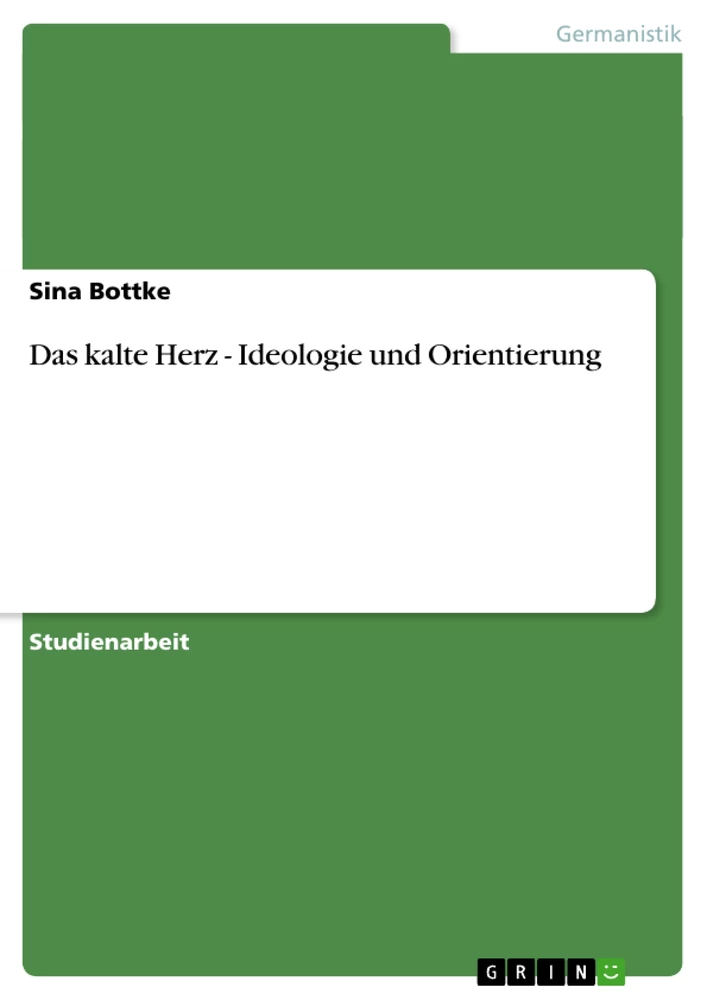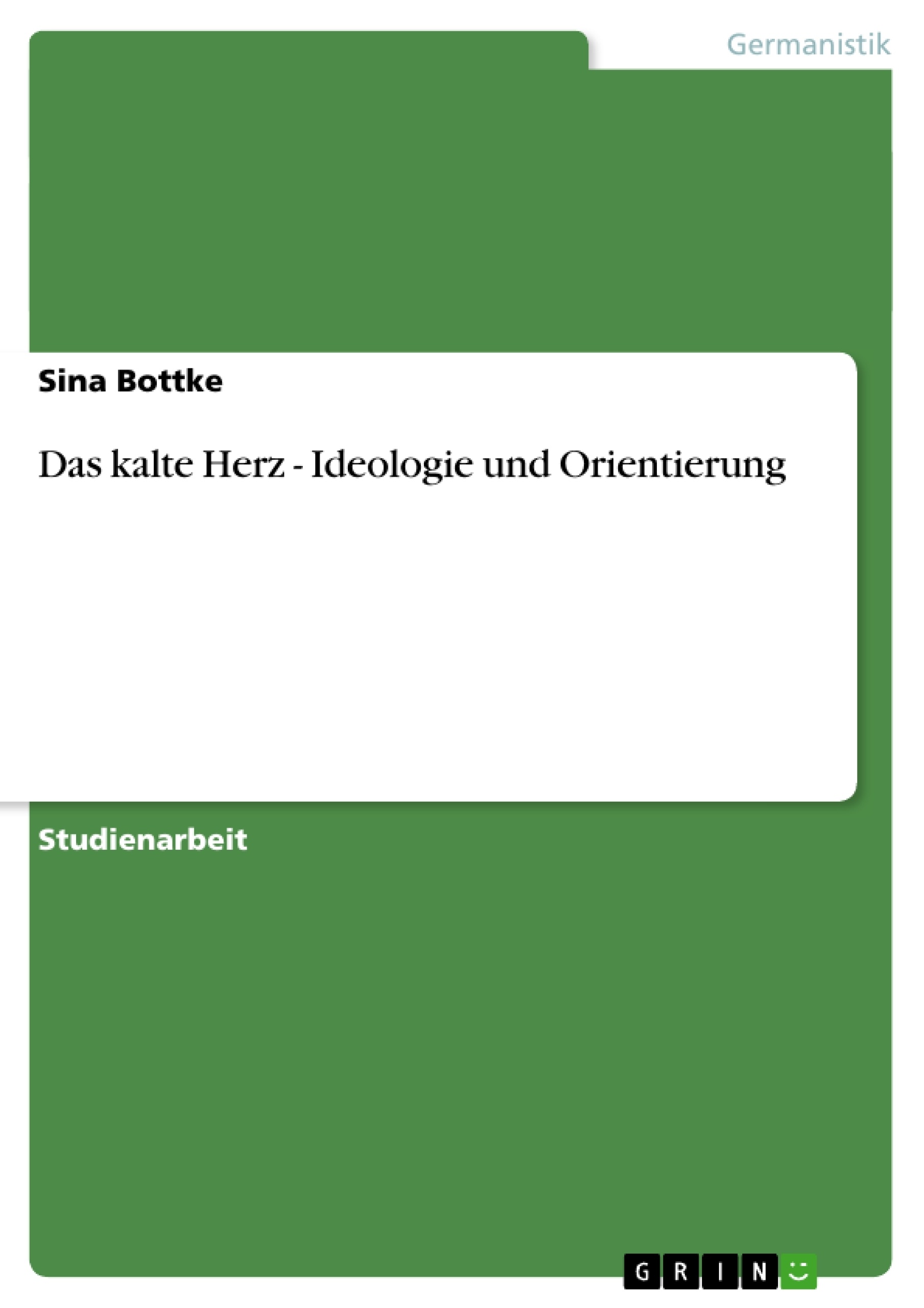Seit jeher sind Filme ein geeignetes Medium, um Botschaften zu vermitteln, an denen sich Menschen orientieren können. Dabei sind sie immer abhängig von den äußeren gesellschaftlichen Umständen. Entscheidend für den Erfolg der Vermittlung ist jedoch die geschickte Einbindung der Botschaft in die Filmhandlung. Zu einem Klassiker werden solche Filme dann, wenn sie dem Publikum vertraute und bekannte Situationen darbieten. Dies ermöglicht eine optimale Identifikation mit bestimmten Haltungen, Stimmungen und Personen.
Im Bezug auf den DEFA-Spielfilm „Das Kalte Herz“ von 1950 zeigen sich diese Handlungsmuster zum Beispiel in der Verwendung von zeitgenössischer Musik, Volksdichtung und der Komponente des sog. Heimatfilms. Der Film sollte dem deutschen Publikum trotz der Trümmerlandschaften der Nachkriegszeit Hoffnung auf einen Neuanfang bieten.
Unabhängig von jeglichem gesellschaftlichen System lautet die Botschaft dieses Filmes, dass es besser ist, arm und glücklich zu sein als reich und unglücklich. Betrachtet man jedoch den politischen Hintergrund, könnte man zu der Annahme kommen, dass durch den Film versucht wird, eine gewisse Ideologie zu vermitteln. Resultierend aus den Erfahrungen des durch Kapitalismus und Machtbestrebungen entstandenen Krieges, war es den Filmemachern aus eigener Überzeugung ein Anliegen, den orientierungslosen Menschen den Sozialismus als einen neuen, besseren Lebensweg nahe zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Situativer Kontext des Films
- Historisch-sozialer Kontext
- DEFA-Märchenfilme
- Ideologie im Fernsehen
- Die Sendung als Ganzheit
- Inhalt des Märchenfilms „Das Kalte Herz“ (DDR 1950)
- Historische Hintergründe
- Bezug zur Nachkriegszeit (1950)
- Abweichungen von der Vorlage und ihre Gründe
- Klischees und Stereotypen
- Themenstruktur
- Gattungsmerkmale
- Definition von Märchen
- Makrostrukturen
- Sequenzprotokoll
- Narratives Programm
- Titelbetrachtung: „Das Kalte Herz“
- Präsentation der Personen/Analyse
- Rhetorische Figuren und ihre visuellen Entsprechungen
- Symbole
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den DEFA-Film „Das Kalte Herz“ von 1950 im Kontext seiner Entstehungszeit und beleuchtet dessen Funktion als Medium der Orientierung und Ideologievermittlung in der frühen DDR. Es wird analysiert, wie der Film gesellschaftliche Botschaften vermittelt und welche Rolle dabei die Einbindung in die Filmhandlung spielt.
- Die Funktion von Film als Medium der Orientierung in gesellschaftlichen Umbrüchen
- Die Vermittlung von Ideologie im DEFA-Film "Das Kalte Herz"
- Die Anpassung der Märchenvorlage an die politische Situation der Nachkriegszeit
- Die Verwendung von Klischees und Stereotypen im Film
- Die Analyse der narrativen Struktur und der symbolischen Elemente
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale These auf, dass der Film „Das Kalte Herz“ nicht nur eine einfache Märchenadaption ist, sondern auch eine Botschaft der Hoffnung und der Orientierung in der unmittelbaren Nachkriegszeit vermittelt, die jedoch auch ideologische Aspekte beinhaltet. Der Film nutzt vertraute Elemente wie Volksdichtung und Heimatfilm-Elemente um beim Publikum eine optimale Identifikation zu ermöglichen.
Situativer Kontext des Films: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen und sozialen Kontext der Entstehung des Films im Jahr 1950 in der DDR. Es beschreibt die Ziele der DEFA (Deutsche Film AG) in der unmittelbaren Nachkriegszeit, die auf der Ausrottung der Reste des Nazismus und Militarismus basierten und die sich mit der Zeit auf den Aufbau der DDR nach ideologischen Vorgaben verlagerten. Die Rolle der DEFA als staatliches Filmstudio und deren Einfluss auf die Produktion von Kinderfilmen, insbesondere Märchenverfilmungen wird hier diskutiert. Die politische und pädagogische Reglementierung der DEFA-Produktionen wird ebenfalls thematisiert und anhand von Richtlinien und Kritik an "Das Kalte Herz" veranschaulicht.
Die Sendung als Ganzheit: Der Film wird als Gesamtkunstwerk betrachtet. Dieser Abschnitt untersucht den Inhalt des Films, seine historischen Hintergründe und seinen Bezug zur Nachkriegszeit. Es wird analysiert, inwiefern der Film von der Hauffschen Vorlage abweicht und die Gründe für diese Abweichungen erläutert. Die Verwendung von Klischees und Stereotypen sowie die Themenstruktur und die gattungsspezifischen Merkmale werden ebenso untersucht, um den Film in seinen verschiedenen Facetten zu beleuchten. Die Kapitel untersuchen ebenfalls wie die Märchenvorlage an die staatseigene ökonomische Situation angepasst wurde, sowie die gesellschaftskritischen Momente die berücksichtigt wurden.
Makrostrukturen: Dieser Abschnitt befasst sich mit der narrativen Struktur des Films. Es wird ein Sequenzprotokoll erstellt und das narrative Programm des Films analysiert, inklusive der Ausgangsopposition, der Mangelsituation, lösungsfördernder und -hemmender Elemente sowie der Behebung der Mangelsituation. Die Titelbetrachtung „Das Kalte Herz“ wird ebenso behandelt wie die Präsentation und Analyse der Personen und die Verwendung rhetorischer Figuren und ihrer visuellen Entsprechungen. Der Abschnitt schließt mit einer Analyse der symbolischen Elemente im Film ab.
Schlüsselwörter
DEFA, Märchenfilm, „Das Kalte Herz“, DDR, Nachkriegszeit, Ideologie, Orientierung, Sozialismus, Propaganda, Märchenadaption, Volksdichtung, Heimatfilm, Klischees, Stereotypen, Narrative Struktur, Symbolanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu "Das Kalte Herz" (DEFA-Film, 1950)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den DEFA-Film „Das Kalte Herz“ von 1950. Sie untersucht den Film im Kontext seiner Entstehungszeit in der frühen DDR und beleuchtet seine Funktion als Medium der Orientierung und Ideologievermittlung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse, wie der Film gesellschaftliche Botschaften vermittelt und welche Rolle die Einbindung in die Filmhandlung dabei spielt.
Welche Aspekte des Films werden untersucht?
Die Analyse umfasst den historischen und sozialen Kontext der Entstehung des Films, die Ziele der DEFA in der Nachkriegszeit, die Anpassung der Märchenvorlage an die politische Situation, die Verwendung von Klischees und Stereotypen, die narrative Struktur, die symbolischen Elemente und die Funktion des Films als Medium der Orientierung und Ideologievermittlung im gesellschaftlichen Umbruch.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zum situativen Kontext des Films (historisch-sozialer Kontext, DEFA-Märchenfilme, Ideologie im Fernsehen), ein Kapitel zur Analyse des Films als Ganzes (Inhalt, historische Hintergründe, Abweichungen von der Vorlage, Klischees, Stereotypen, Themenstruktur, Gattungsmerkmale), ein Kapitel zu den Makrostrukturen (Sequenzprotokoll, narratives Programm, Titelbetrachtung, Personenanalyse, Rhetorische Figuren, Symbole) und einen Schluss. Zusätzlich werden die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter aufgeführt.
Welche Ziele verfolgt die Analyse des Films?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Funktion des Films als Medium der Orientierung in gesellschaftlichen Umbrüchen zu verstehen, die Vermittlung von Ideologie im Film zu analysieren und die Anpassung der Märchenvorlage an die politische Situation der Nachkriegszeit zu untersuchen. Die Verwendung von Klischees und Stereotypen sowie die narrative und symbolische Struktur werden ebenfalls analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: DEFA, Märchenfilm, „Das Kalte Herz“, DDR, Nachkriegszeit, Ideologie, Orientierung, Sozialismus, Propaganda, Märchenadaption, Volksdichtung, Heimatfilm, Klischees, Stereotypen, Narrative Struktur, Symbolanalyse.
Wie wird der Film "Das Kalte Herz" im Kontext der DEFA eingeordnet?
Die Arbeit untersucht die Rolle der DEFA als staatliches Filmstudio und deren Einfluss auf die Produktion von Kinderfilmen, insbesondere Märchenverfilmungen. Die politische und pädagogische Reglementierung der DEFA-Produktionen wird thematisiert und anhand von Richtlinien und Kritik an "Das Kalte Herz" veranschaulicht.
Welche Bedeutung hat die Märchenvorlage für den Film?
Die Arbeit analysiert, inwiefern der Film von der Hauffschen Vorlage abweicht und die Gründe für diese Abweichungen erläutert. Sie untersucht auch, wie die Märchenvorlage an die staatseigene ökonomische Situation angepasst wurde und welche gesellschaftskritischen Momente berücksichtigt wurden.
Wie wird die narrative Struktur des Films analysiert?
Die narrative Struktur wird durch ein Sequenzprotokoll und die Analyse des narrativen Programms (Ausgangsopposition, Mangelsituation, lösungsfördernde und -hemmende Elemente, Behebung der Mangelsituation) untersucht. Die Titelbetrachtung, die Personenanalyse, die Verwendung rhetorischer Figuren und die Symbolanalyse sind weitere Bestandteile dieser Analyse.
Welche zentrale These vertritt die Arbeit?
Die zentrale These ist, dass der Film „Das Kalte Herz“ nicht nur eine einfache Märchenadaption ist, sondern auch eine Botschaft der Hoffnung und der Orientierung in der unmittelbaren Nachkriegszeit vermittelt, die jedoch auch ideologische Aspekte beinhaltet. Der Film nutzt vertraute Elemente wie Volksdichtung und Heimatfilm-Elemente um beim Publikum eine optimale Identifikation zu ermöglichen.
- Citation du texte
- Sina Bottke (Auteur), 2003, Das kalte Herz - Ideologie und Orientierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39721