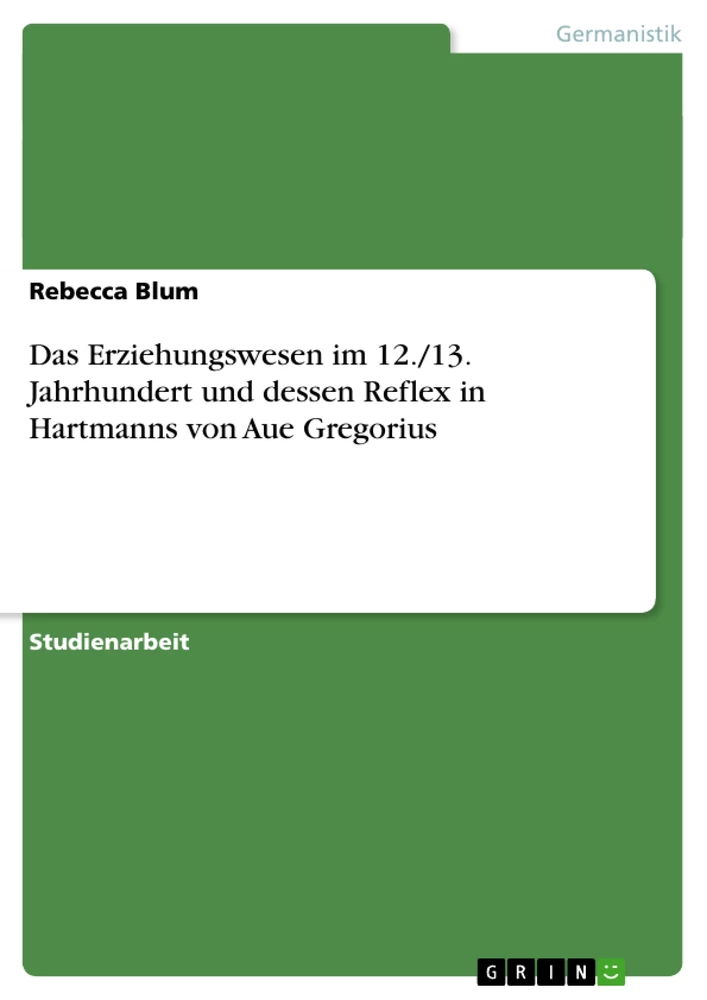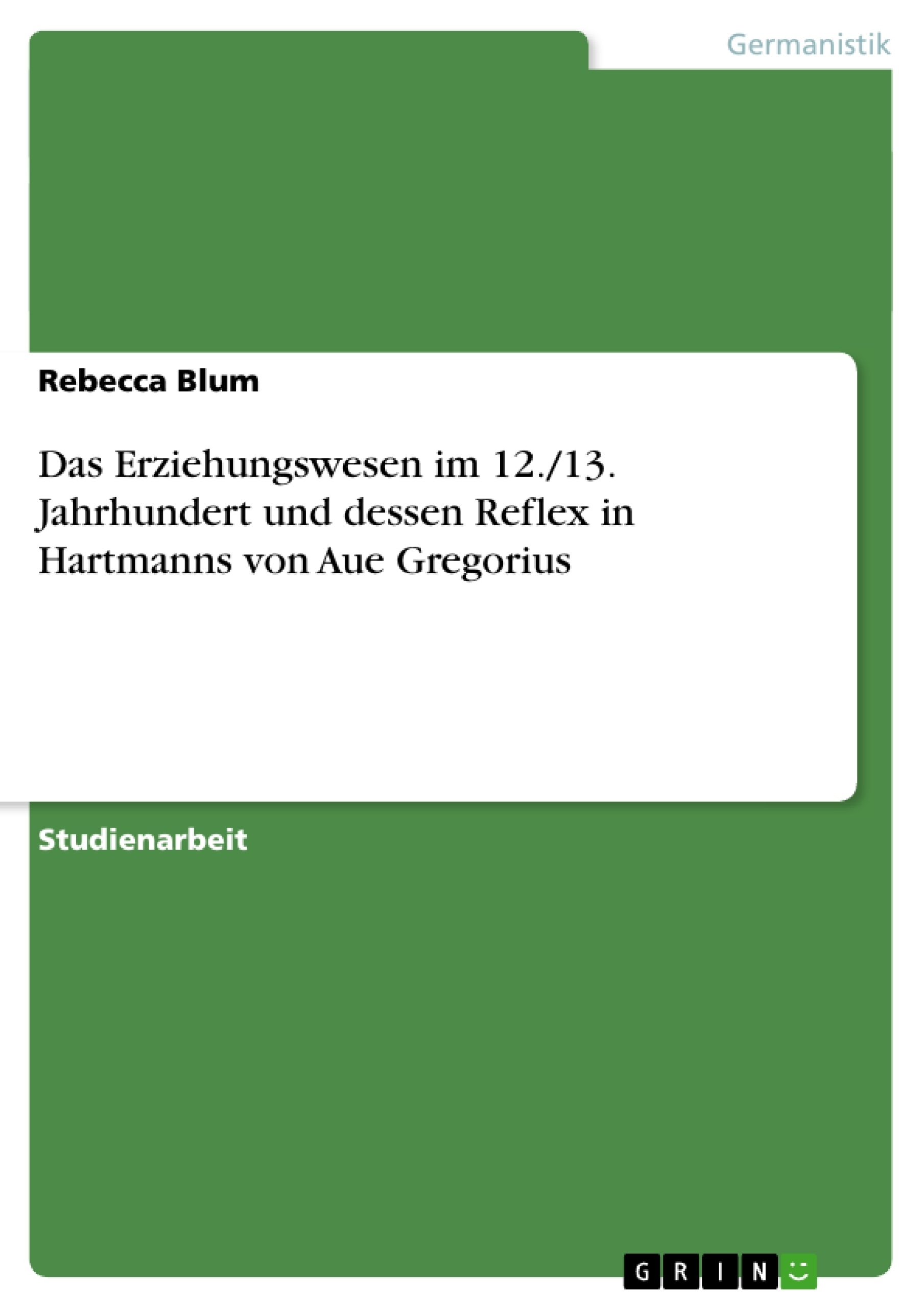Im Rahmen der vorliegenden Arbeit mit dem Titel „Das Erziehungswesen im 12./13. Jahrhundert und dessen Reflex im Gregorius“ sollen zunächst die Grundzüge von Kindheit, Erziehung und Bildung im Hochmittelalter dargestellt und erläutert werden; hierbei sei angemerkt, dass sich die verwendete Forschungsliteratur und somit auch die erarbeiteten Ausführungen auf didaktische und pädagogische Werke des 12./13. Jahrhunderts stützen, die vorrangig theoretischer Natur waren, und sich in ihrer idealistischen Darstellung der damaligen familiären Verhältnisse und der pädagogischadäquaten Erziehungsmethoden oftmals von der Realität unterschieden. Ziel dieses historischen Teils kann und soll daher nicht sein, die tatsächlich praktizierten Erziehungsmaßnahmen zu schildern, sondern zu beschreiben, wie sie im Idealfall aussehen sollten. Im Hinblick auf den vorgegebenen Umfang einer Hausarbeit liegt der Fokus der Darstellung vornehmlich auf der höfischlaikalen und klerikalen Erziehung der Jungen; städtische und ländliche Erziehung sowie die spezifische Behandlung der Mädchen werden nicht näher in Betracht gezogen.
Ziel des zweiten Teils der Ausführungen stellt der Vergleich des zuvor Erarbeiteten mit der Erziehung des jungen Gregorius dar, beginnend mit dem Fund des Säuglings durch die Fischer, endend mit dem Verlassen des Klosters und dem Auszug des Jungen in die Ritterschaft. Neben dem Ablauf seiner Erziehung werden auch die bei Gregorius während seines Aufwachsens zutage tretenden Besonderheiten seiner Persönlichkeit erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erziehung im 12./13. Jahrhundert
- Entwicklungsphasen der Kindheit
- Bedeutung der Erziehung und ihre Ziele
- Das Bildungswesen
- Höfisch-laikale Erziehung
- Klerikale Erziehung
- Reflex des mittelalterlichen Erziehungswesens im Gregorius
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Erziehungswesen im 12./13. Jahrhundert und analysiert dessen Reflexion in Hartmanns von Aues Werk „Gregorius“. Der Fokus liegt dabei auf der idealtypischen Darstellung von Kindheit, Erziehung und Bildung im Hochmittelalter, wobei die verwendeten Forschungsquellen sich hauptsächlich auf didaktische und pädagogische Werke des 12./13. Jahrhunderts stützen. Die Arbeit beleuchtet sowohl die höfisch-laikale als auch die klerikale Erziehung von Jungen im Hochmittelalter, wobei städtische, ländliche Erziehung sowie die spezifische Behandlung von Mädchen nicht im Detail betrachtet werden. Im zweiten Teil der Arbeit wird der zuvor erarbeitete Idealzustand mit der Erziehung des jungen Gregorius im Werk Hartmanns von Aue verglichen.
- Entwicklungsphasen der Kindheit im Mittelalter
- Ziele und Methoden der Erziehung im Hochmittelalter
- Der Einfluss der sozialen Stellung auf den Bildungsprozess
- Der Reflex der mittelalterlichen Erziehung im Werk „Gregorius“
- Die Rolle der Persönlichkeit des jungen Gregorius in seiner Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Zielsetzung und den Umfang der Arbeit vor. Sie erläutert, dass die Arbeit sich auf die theoretische Darstellung von Kindheit, Erziehung und Bildung im Hochmittelalter konzentriert und die tatsächlich praktizierten Erziehungsmaßnahmen nicht im Detail schildert. Der Fokus liegt dabei auf der höfisch-laikalen und klerikalen Erziehung von Jungen, wobei städtische, ländliche Erziehung sowie die spezifische Behandlung von Mädchen nicht näher betrachtet werden.
Das erste Kapitel beleuchtet die Entwicklungsphasen der Kindheit im 12./13. Jahrhundert. Anhand der antiken Tradition werden drei Phasen unterschieden: die Infantia, die Pueritia und die Adolescentia. Die Erziehung des Kindes wurde auf die jeweilige Entwicklungsphase abgestimmt. Im Mittelpunkt der Ausführungen stehen die unterschiedlichen Erwartungen an das Verhalten und die Leistungen der Kinder in jeder Phase.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Bedeutung der Erziehung und ihren Zielen im Mittelalter. Die mittelalterlichen Gelehrten sahen den Menschen nicht als von Geburt an „vollendet“ an, sondern glaubten, dass er erst durch Erziehung zum Menschen „wird“. Dabei wurde das Bild der „tabula rasa“, der „glatten Tafel“, als Ausgangspunkt für den idealen Erziehungsprozess herangezogen. Es wurde betont, dass die Jugend nicht von allein zum Guten hin entwickelt, sondern einer ständigen Kontrolle und Steuerung bedarf, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die Erziehung sollte den Menschen zu Demut, Glauben und christlicher Vollkommenheit führen, ihn zum funktionierenden Teil der religiös-kirchlichen Ständegesellschaft machen und Gehorsam gegenüber den Eltern und anderen hierarchisch höhergestellten Personen vermitteln.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Bildungswesen im 12./13. Jahrhundert. Bildung diente nicht der Vermittlung von allgemeinem und beruflichem Wissen, sondern einer Einführung in das christliche Leben. Das Kapitel beschreibt die verschiedenen Formen der Bildung, die im Hochmittelalter existierten, und beleuchtet die Rolle der Kirche und des Adels in der Erziehung.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der höfisch-laikalen Erziehung im 12./13. Jahrhundert. Es behandelt die Erziehung von Jungen an den höfischen Fürstenhöfen und die besonderen Anforderungen, die an die zukünftigen Ritter gestellt wurden. Die Erziehung sollte die Jungen zu Tapferkeit, Ehre, Treue und Ritterlichkeit führen. Der Schwerpunkt lag auf körperlicher Ausbildung und militärischer Fertigkeit, aber auch höfische Umgangsformen, Musik und Literatur spielten eine Rolle.
Das fünfte Kapitel widmet sich der klerikalen Erziehung im 12./13. Jahrhundert. Es beleuchtet die Erziehung von Jungen in Klöstern und die Bedeutung der religiösen Bildung. Ziel der klerikalen Erziehung war es, den Jungen den christlichen Glauben und die kirchlichen Regeln zu vermitteln und sie auf ein Leben als Geistlicher vorzubereiten. Das Kapitel betrachtet die verschiedenen Bildungseinrichtungen und die Lernmethoden, die in den Klöstern angewendet wurden.
Das sechste Kapitel analysiert den Reflex des mittelalterlichen Erziehungswesens im Werk „Gregorius“ von Hartmann von Aue. Es verfolgt den Weg des jungen Gregorius von seiner Findung als Säugling bis zu seinem Abschied vom Kloster und dem Eintritt in die Rittergesellschaft. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Erziehung des Gregorius, den bei ihm während des Aufwachsens zutage tretenden Besonderheiten seiner Persönlichkeit und der Frage, inwieweit die Ideale der mittelalterlichen Erziehung in seinem Leben verwirklicht wurden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Erziehungswesen im 12./13. Jahrhundert, der Entwicklungsphasen der Kindheit im Mittelalter, den Zielen der Erziehung, der Bedeutung von Bildung, der höfisch-laikalen und der klerikalen Erziehung, der Analyse des Werkes „Gregorius“ von Hartmann von Aue und der Rolle der Persönlichkeit des jungen Gregorius in seiner Erziehung.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde Kindheit im 12. und 13. Jahrhundert eingeteilt?
Man unterschied traditionell drei Phasen: Infantia (Frühe Kindheit), Pueritia (Knabenalter) und Adolescentia (Jugend).
Was bedeutete das Bild der „tabula rasa“ für die mittelalterliche Erziehung?
Das Kind wurde als „glatte Tafel“ gesehen, die erst durch Erziehung geformt werden muss, um ein funktionierender Teil der christlichen Ständegesellschaft zu werden.
Was waren die Ziele der höfisch-laikalen Erziehung?
Sie zielte auf die Ausbildung zukünftiger Ritter ab, mit Schwerpunkten auf Tapferkeit, Ehre, körperlicher Ertüchtigung und höfischen Umgangsformen.
Wie unterscheidet sich die klerikale Erziehung davon?
Die klerikale Erziehung in Klöstern fokussierte auf religiöse Bildung, den christlichen Glauben und die Vorbereitung auf ein Leben als Geistlicher.
Wie spiegelt sich dieses Erziehungswesen in Hartmanns „Gregorius“ wider?
Das Werk zeigt den Weg des Findelkindes Gregorius, der eine klösterliche Ausbildung erhält, aber schließlich aus eigenem Antrieb in die Ritterwelt zieht.
- Arbeit zitieren
- Rebecca Blum (Autor:in), 2002, Das Erziehungswesen im 12./13. Jahrhundert und dessen Reflex in Hartmanns von Aue Gregorius, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39767