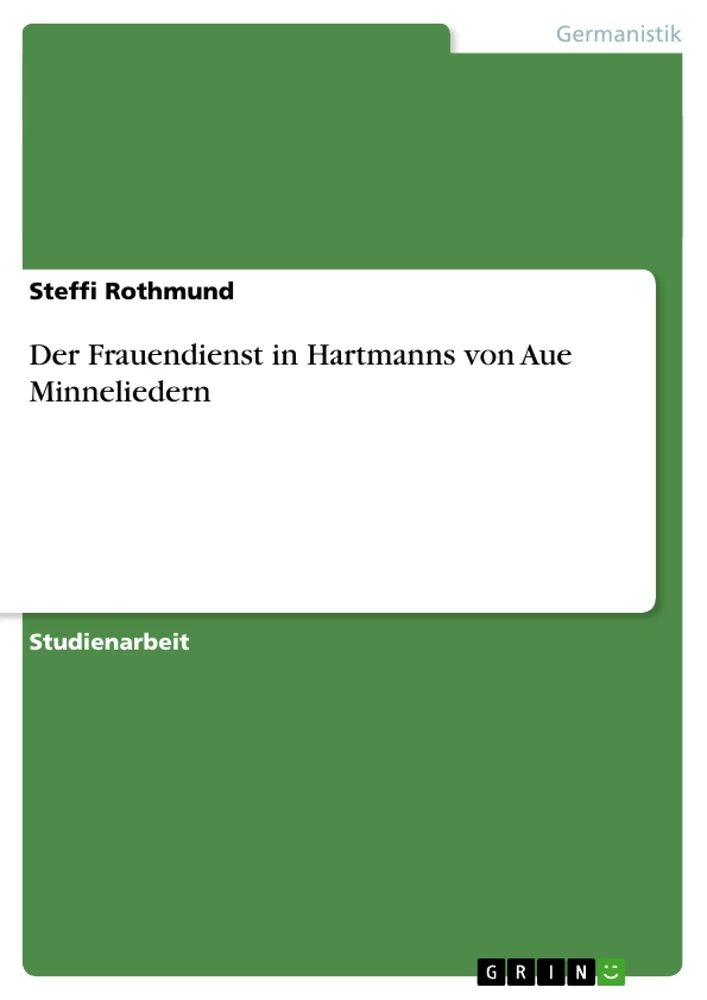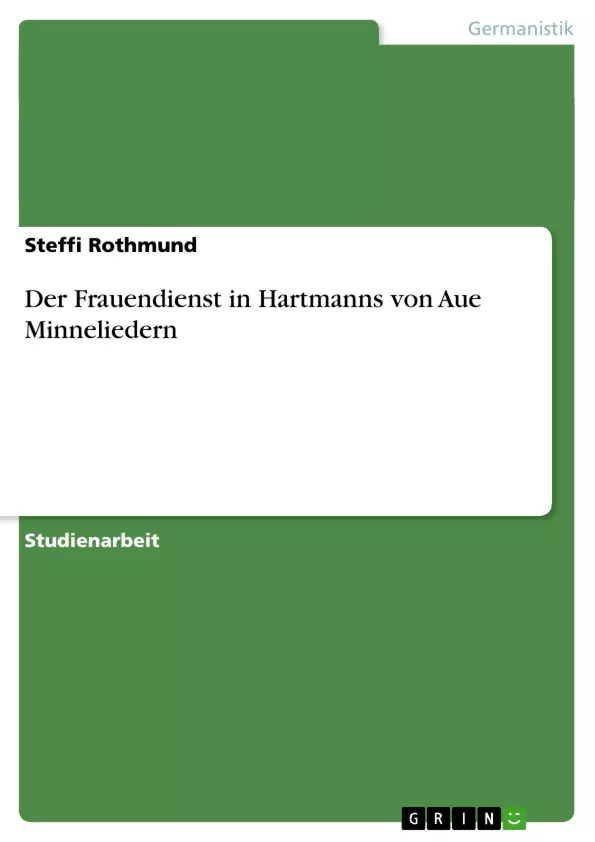„Es hat sich in der Mediävistik die Gewohnheit eingebürgert, die in der mittelalterlichen Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts propagierte Liebesauffassung unabhängig von ihren verschiedenen Erscheinungsformen in der Lyrik und im Roman als ,höfische Liebe’ zu bezeichnen, und dies wird zu der Verwirrung beigetragen haben.“
Um die Verwirrung im voraus zu beseitigen, bietet es sich an, zunächst den Begriff der Hohen Minne von der Minne im Roman abzusetzen und die in der Lyrik übliche Konzeption zu erklären.
Ein grundlegender Unterschied, der das Liebeskonzept beider Gattungen ausmacht ist der, das die Liebe im höfischen Roman in der Regel auf die Ehe beschränkt ist, die in der Lyrik allerdings keine Beachtung findet. Innerhalb dieses Unterschieds differenziert man die dem Roman zugrunde liegende amour courtois von dem Konzept der fin’ amor in der Lyrik. Die Konzeption der fin’amor ist um ca. 1120 in Frankreich bei den Trobadours aufgekommen und wird in Deutschland ab ca. 1180 übernommen. Sie bietet Grundlage für die Konzeption der Hohen Minne:
Unter der Voraussetzung, dass seine Liebe noch unerfüllt ist, umwirbt ein lyrisches Ich eine gesellschaftlich und daher sittlich über ihm stehende Dame, die quasi Idealbild höfischer Vollkommenheit ist. Indem das Sänger-Ich die Dame zur Minneherrin stilisiert, steht sie gleichsam unerreichbar über ihm. Mit der Distanz, die diese Rollenkonstellation ausmacht sind zwei wichtige Aspekte verbunden: Zum Einen erscheint die Frau nicht mehr als Sexualobjekt, dem man sich hemmungslos bemächtigen kann, zum Anderen hat der Sänger seine triuwe und staete unter Beweis zu stellen.
Der mit dem beständigen Dienen verbundene lôn ist aber nicht gerade das sich Erfüllen der Liebe, sondern besteht vielmehr im hohen muot, also gesellschaftlichem Ansehen. Diese Rollenkonstellation ist das Paradoxon der Hohen Minne und steht gleichermaßen für ein neues Geschlechterverhältnis: die Erziehung des Mannes durch die Frau.
So unterscheidet sich die Minne im höfischen Roman vo n ihrer Thematisierung in der Lyrik darin, dass „ der Dienst des Mannes (...) allein der Frau (gilt), und (...) nicht in ritterlichen Bewährungskämpfen (besteht), sondern darin, den Spannungszustand zu bewältigen, der aus unerfülltem Liebesverlangen entsteht.“ [...]
Inhaltsverzeichnis
- I Vorwort
- II Frauendienst in Hartmann von Aues Liedern
- 2.1 Lied I Sît ich den sumer trouc
- 2.2 Lied II: Swes vröide an guoten wîben stât
- 2.3 Die umworbene Dame in den Liedern Hohe Minne als Problemmodell
- 2.4 Verhältnis zur Dienstminne Friedrich von Hausens
- 2.5 Lied XV: Maniger grüezet mich alsô-eine Persiflage auf die Hohe Minne
- III Literaturverzeichnis
- 3.1 Quellen
- 3.2 Darstellungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Konzeption des Frauendienstes in den Liedern Hartmann von Aues, wobei der Fokus auf den Liedern I, II und XV liegt. Ziel ist es, die Darstellung der Hohen Minne in diesen Liedern zu analysieren und das Verhältnis zu anderen Konzepten der Minne, wie der Dienstminne Friedrich von Hausens, zu untersuchen.
- Die Darstellung der Hohen Minne in den Liedern Hartmann von Aues
- Die Rolle der umworbenen Dame in den Liedern
- Das Problemmodell der Hohen Minne
- Das Verhältnis zur Dienstminne Friedrich von Hausens
- Die Persiflage auf die Hohe Minne in Lied XV
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort bietet eine allgemeine Einführung in die Konzeption der Minne im Mittelalter und die Unterscheidung zwischen der Minne im Roman und in der Lyrik. Es wird darauf hingewiesen, dass die Arbeit sich mit der Konzeption des Frauendienstes bei Hartmann von Aue befasst.
Im ersten Kapitel wird Lied I "Sît ich den sumer trouc" analysiert. Die Analyse konzentriert sich auf die programmatische Bedeutung des Liedes für die Hohe Minne, die Darstellung des erfolglosen Werbens und die Reflexion über die Kategorien der Hohen Minne.
Im zweiten Kapitel wird Lied II "Swes vröide an guoten wîben stât" behandelt. Die Analyse konzentriert sich auf die Darstellung der Frau als Idealbild höfischer Vollkommenheit und die Problematik der unerfüllten Liebe.
Im dritten Kapitel wird die Rolle der umworbenen Dame in den Liedern Hartmann von Aues und das Problemmodell der Hohen Minne in diesem Zusammenhang untersucht.
Im vierten Kapitel wird das Verhältnis der Konzeption des Frauendienstes bei Hartmann von Aue zur Dienstminne bei Friedrich von Hausen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Konzeption des Frauendienstes in der mittelalterlichen Lyrik, insbesondere mit der Hohen Minne in den Liedern Hartmann von Aues. Schlüsselbegriffe sind dabei: Frauendienst, Hohe Minne, Dienstminne, Liedanalyse, Hartmann von Aue, Friedrich von Hausen, höfische Liebe, Idealbild, Problemmodell, Persiflage.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Hoher Minne“?
Die Hohe Minne ist ein lyrisches Konzept des Mittelalters, bei dem ein Sänger eine gesellschaftlich höherstehende, unerreichbare Dame umwirbt, wobei der Dienst an ihr im Vordergrund steht.
Wie unterscheidet sich Minne in der Lyrik von der im Roman?
Im höfischen Roman führt die Liebe meist zur Ehe, während sie in der Lyrik (Hohe Minne) oft unerfüllt bleibt und als moralischer Erziehungsprozess des Mannes dient.
Welche Rolle spielt die Dame in Hartmanns Minneliedern?
Sie wird als Idealbild höfischer Vollkommenheit stilisiert und fungiert als Erzieherin des Mannes, der durch seinen Dienst an ihr Tugenden wie Beständigkeit (staete) beweisen muss.
Was ist das Paradoxon der Hohen Minne?
Das Paradoxon besteht darin, dass der Lohn des Dienstes nicht die Erfüllung der Liebe ist, sondern der Gewinn an gesellschaftlichem Ansehen und innerer Veredelung (hoher muot).
Warum gilt Hartmanns Lied XV als Persiflage?
In diesem Lied bricht Hartmann mit den Konventionen der Hohen Minne und macht sich über die starren Regeln des Dienstes und des unerfüllten Verlangens lustig.
- Citar trabajo
- Steffi Rothmund (Autor), 2003, Der Frauendienst in Hartmanns von Aue Minneliedern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/39996