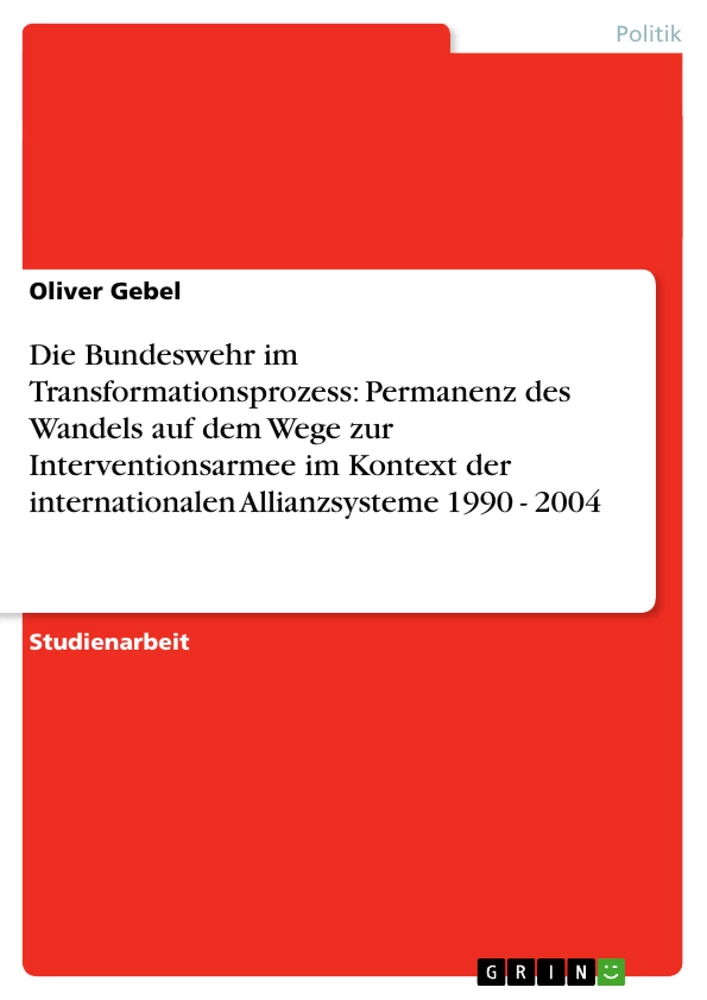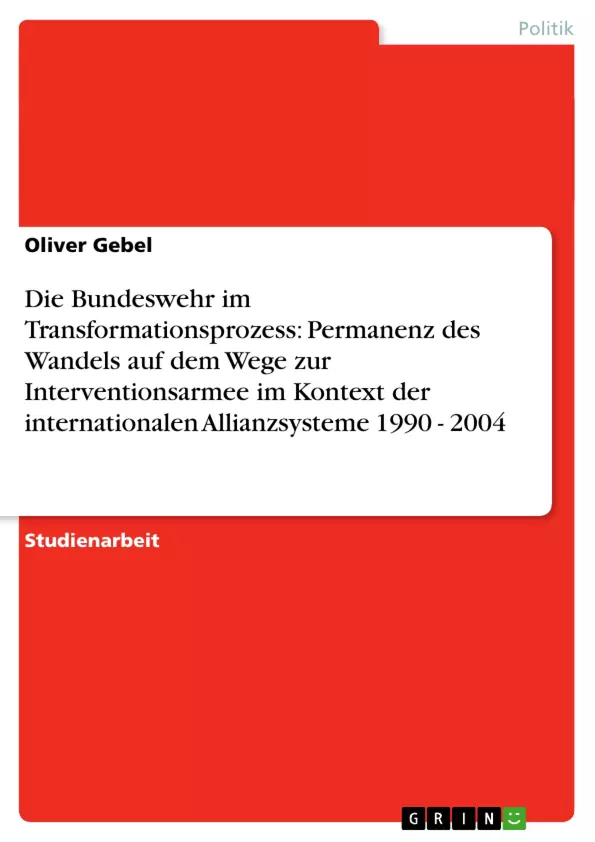Abseits vom klassischen Verteidigungsauftrag und dem Schutz der lokal zu sichernden territorialen Integrität zeigt meine Arbeit konsequent den Weg der Bundeswehr seit dem Kollaps des Ostblocks hin zu einem im multinationalen Verbund mit Partnerarmeen operierenden globalen Akteur der internationalen Sicherheit.
Inhaltsverzeichnis
- I. Die Bundeswehr im Wandel
- I.1. Selbstfindung und Neuorientierung nach der Wiedervereinigung 1990
- I.2. Integration und Reduzierung 1990 - 1998
- I.3. Reformkonzepte der Regierung Schröder 1998 - 2000
- I.4. Der Fortgang der Reformen 2000 - 2002 und die Zäsur des 11. September 2001
- I.5. Die Bundeswehr als Interventionsarmee - Konsequente Anpassung 2002 - 2004
- I.6. Neueste Entwicklungen im Transformationsprozess
- I.7. Die Frage der Wehrpflicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Transformation der Bundeswehr von 1990 bis 2004. Sie analysiert die Anpassungen der Bundeswehr an den Wandel des weltpolitischen Kontextes nach dem Ende des Kalten Krieges und den Herausforderungen des internationalen Terrorismus. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Bundeswehr hin zu einer Interventionsarmee.
- Anpassung der Bundeswehr an den post-Kalten-Krieg-Kontext
- Integration der NVA in die Bundeswehr
- Entwicklung der Bundeswehr zur Interventionsarmee
- Reformkonzepte und deren Umsetzung
- Diskussion um die Wehrpflicht
Zusammenfassung der Kapitel
I. Die Bundeswehr im Wandel: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Transformation der Bundeswehr seit der Wiedervereinigung. Es beleuchtet die Herausforderungen der Integration der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR, die Reduzierung der Truppenstärke und die notwendigen Anpassungen an die sich verändernde Sicherheitslage. Der Wandel von einer rein defensiven zu einer zunehmend interventionsfähigen Armee wird im Kontext der internationalen Allianzsysteme und der deutschen Außenpolitik analysiert. Die verschiedenen Reformansätze der Bundesregierungen werden kritisch bewertet, und der Einfluss des 11. Septembers 2001 auf die Entwicklung der Bundeswehr wird herausgestellt. Die Bedeutung der Bundeswehr als Instrument der deutschen Außenpolitik und ihre Rolle innerhalb internationaler Organisationen wie der NATO und der EU werden umfassend erörtert. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der komplexen Veränderungen, denen sich die Bundeswehr in den Jahren 1990 bis 2004 gegenüber sah.
I.1. Selbstfindung nach der Wiedervereinigung 1990: Der Abschnitt analysiert die anfänglichen Herausforderungen der Bundeswehr nach der deutschen Wiedervereinigung. Der plötzliche Verlust des klar definierten Feindbildes und die Notwendigkeit, die NVA zu integrieren, führten zu einer Phase der Selbstfindung und Neuorientierung. Die massive Reduzierung der Truppenstärke, diktiert durch die Zwei-plus-Vier-Verträge, wird im Detail dargestellt und in den Kontext der internationalen Sicherheitsarchitektur eingeordnet. Der Abschnitt betont die Anpassung der Bundeswehr an eine neue Sicherheitsrealität, die durch das Ende des Kalten Krieges geprägt war.
I.2. Integration und Reduzierung 1990 - 1998: Dieser Teil befasst sich mit der Integration eines Teils der NVA in die Bundeswehr und der damit verbundenen Reduzierung der Truppenstärke. Die politischen und militärischen Herausforderungen dieser Phase, die unter den Verteidigungsministern Stoltenberg und Rühe stattfanden, werden detailliert beschrieben. Der Abschnitt beleuchtet, wie die Bundeswehr versuchte, den Strukturwandel zu bewältigen und gleichzeitig ihre Rolle in der veränderten Sicherheitslandschaft zu definieren. Die Integration der NVA stellte sowohl personelle als auch materielle Herausforderungen dar, die im Kontext der beschriebenen Reformen eingeordnet werden. Es wird dargelegt, wie die Integration und Reduzierung der Streitkräfte die Aufgaben und die Struktur der Bundeswehr nachhaltig beeinflusst haben.
Schlüsselwörter
Bundeswehr, Transformation, Interventionsarmee, Wiedervereinigung, NVA-Integration, Reform, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, NATO, EU, Wehrpflicht, Weltpolitik, 11. September 2001.
Häufig gestellte Fragen zur Bundeswehrtransformation 1990-2004
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Transformation der Bundeswehr von 1990 bis 2004. Sie analysiert die Anpassungen der Bundeswehr an den Wandel des weltpolitischen Kontextes nach dem Ende des Kalten Krieges und den Herausforderungen des internationalen Terrorismus. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Bundeswehr hin zu einer Interventionsarmee.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Anpassung der Bundeswehr an den post-Kalten-Krieg-Kontext, die Integration der NVA in die Bundeswehr, die Entwicklung der Bundeswehr zur Interventionsarmee, verschiedene Reformkonzepte und deren Umsetzung sowie die Diskussion um die Wehrpflicht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in ein Kapitel: "Die Bundeswehr im Wandel". Dieses Kapitel wird weiter unterteilt in Unterkapitel, die die Selbstfindung nach der Wiedervereinigung 1990, die Integration und Reduzierung der Truppenstärke von 1990-1998, die Reformkonzepte der Regierung Schröder (1998-2000), den Fortgang der Reformen (2000-2002) und die Zäsur des 11. Septembers 2001, die Bundeswehr als Interventionsarmee (2002-2004) und neueste Entwicklungen im Transformationsprozess sowie die Frage der Wehrpflicht behandeln.
Was wird im Kapitel "Die Bundeswehr im Wandel" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die Transformation der Bundeswehr seit der Wiedervereinigung. Es beleuchtet die Herausforderungen der Integration der NVA, die Reduzierung der Truppenstärke und die Anpassungen an die verändernde Sicherheitslage. Der Wandel von einer rein defensiven zu einer interventionsfähigen Armee wird im Kontext internationaler Allianzsysteme und der deutschen Außenpolitik analysiert. Die Reformansätze der Bundesregierungen werden kritisch bewertet, und der Einfluss des 11. Septembers 2001 wird herausgestellt. Die Rolle der Bundeswehr in internationalen Organisationen wie NATO und EU wird erörtert.
Was sind die zentralen Herausforderungen der frühen Phase nach der Wiedervereinigung (1990)?
Die anfänglichen Herausforderungen waren der Verlust eines klar definierten Feindbildes und die Notwendigkeit, die NVA zu integrieren. Die massive Truppenreduzierung aufgrund der Zwei-plus-Vier-Verträge und die Anpassung an eine neue Sicherheitsrealität nach dem Ende des Kalten Krieges waren ebenfalls entscheidend.
Wie wird die Integration der NVA und die Reduzierung der Truppenstärke (1990-1998) dargestellt?
Dieser Abschnitt beschreibt die politischen und militärischen Herausforderungen der Integration eines Teils der NVA und der Truppenreduzierung unter Stoltenberg und Rühe. Es wird beleuchtet, wie die Bundeswehr den Strukturwandel bewältigte und ihre Rolle in der veränderten Sicherheitslandschaft definierte. Die personellen und materiellen Herausforderungen der NVA-Integration im Kontext der Reformen werden ebenfalls behandelt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bundeswehr, Transformation, Interventionsarmee, Wiedervereinigung, NVA-Integration, Reform, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, NATO, EU, Wehrpflicht, Weltpolitik, 11. September 2001.
- Quote paper
- Oliver Gebel (Author), 2004, Die Bundeswehr im Transformationsprozess: Permanenz des Wandels auf dem Wege zur Interventionsarmee im Kontext der internationalen Allianzsysteme 1990 - 2004, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40008