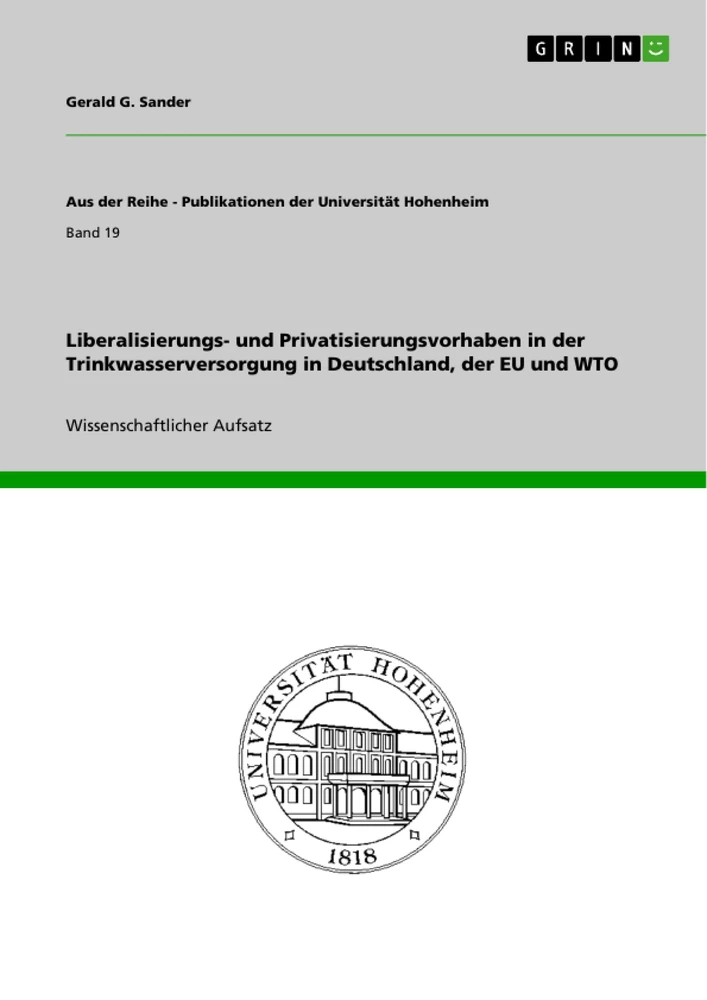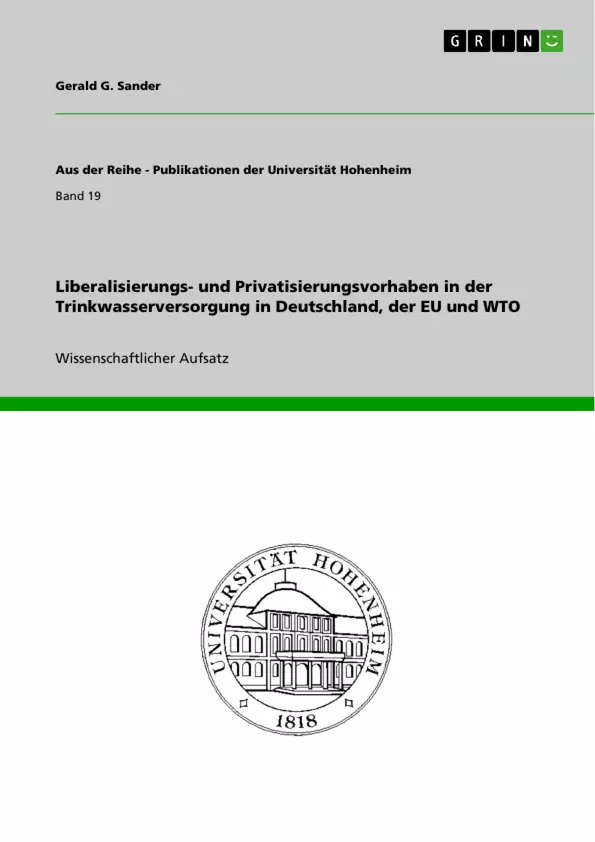Am 22. März 2005, dem „Tag des Wassers“, erklärten die Vereinten Nationen den Zeitraum von 2005 bis 2015 zur internationalen Dekade „Wasser zum Leben“. Dieser Tag soll das Bewusstsein für das nur begrenzt verfügbare Lebensgut weltweit schärfen und an die Einhaltung des sog. Millenniumsziels der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2000 erinnern, den Anteil der Weltbevölkerung ohne nachhaltigen Zugang zu sauberem Trinkwasser bis zum Jahr 2015 zu halbieren. Schon heute ist abzusehen, dass trinkbares Wasser in den nächsten Jahrzehnten ein knappes Gut wird und dieses Ziel kaum zu erreichen sein wird. Von den rund sechs Milliarden Menschen, die auf der Welt leben, haben mehr als 1,1 Mrd. Personen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und 2,4 Mrd. keinen Zugang zu verbesserter Abwasserentsorgung. Täglich sterben fast 30.000 Menschen an Krankheiten, die mit dem Mangel an trinkbarem Wasser oder sanitären Anlagen zusammenhängen. Gründe für die Wasserkrise sind der ständig steigende Wasserverbrauch vor allem der Industrie und das andauernde Bevölkerungswachstum in den Entwicklungsländern. In den südlichen Staaten kommen zur Wasserknappheit zumeist eine starke Verschmutzung sowie eine ineffiziente Wasserbewirtschaftung hinzu. Die globale Bereitstellung von trinkbarem Wasser ist damit eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Viele sehen bezüglich der Ressource Wasser sogar die wachsende Gefahr ernster Verteilungskonflikte zwischen den Staaten. Bei dieser Ausgangslage erwartet eine Handvoll privater, transnational tätiger Unternehmen große Gewinnchancen im Wassersektor und drängt weltweit auf freien Zugang zu den Wassermärkten. Der weltweite jährliche Umsatz der Wasserindustrie wurde für das Jahr 2000 auf immerhin 400 Mrd. US-Dollar geschätzt. Dies entspricht ca. 40% des Umsatzes im Ölsektor und liegt bereits ein Drittel höher als die Umsätze in der Pharmaindustrie. Sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union und im Welthandel wird zurzeit intensiv über Liberalisierungen und Privatisierungen von Diensten im allgemeinen Interesse (sog. Daseinsvorsorge) diskutiert. Den Liberalisierungs- und Privatisierungsvorhaben vonseiten der EU und im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) stehen in Deutschland aber häufig die gewachsenen Strukturen der kommunalen Erbringung von gemeinwohlorientierten Dienstleistungen (Trinkwasserversorgung, Behandlungen in Krankenhäusern, ÖPNV etc.) entgegen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Privatisierung in England/Wales
- Das französische Konzessionsmodell
- Entwicklungen in Deutschland
- Privatisierungsbeispiele
- Die rechtliche Ausgangslage
- Kritikpunkte an einer Liberalisierung und Privatisierung
- Erfahrungen mit Preisentwicklungen
- Trinkwasser – ein besonderes Gut
- Liberalisierung und Privatisierung im Wassersektor ausgewählter Länder
- Formen der Liberalisierung und Privatisierung
- Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt
- Liberalisierungsvorhaben in der Europäischen Union
- Einleitung
- Die EG-Sektorenrichtlinie 2004/17/EG
- Ausblick
- Wasserversorgung in der geplanten EG-Dienstleistungsrichtlinie
- Liberalisierungsbestrebungen im Welthandel
- Die GATS-Verhandlungen
- Annahme internationaler Handelsverträge nach der Europäischen Verfassung
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Buch analysiert die Entwicklungen der Liberalisierung und Privatisierung von Trinkwasserversorgung in Deutschland, der EU und der WTO. Es untersucht die rechtlichen Grundlagen, die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, sowie die potenziellen Gefahren von Marktmechanismen in einem Bereich, der traditionell von der öffentlichen Hand dominiert wurde.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Liberalisierung und Privatisierung im Wassersektor
- Auswirkungen der Liberalisierung und Privatisierung auf die Wasserversorgung und die Umwelt
- Zentrale Argumente für und gegen Liberalisierung und Privatisierung von Trinkwasserversorgung
- Entwicklungen und Tendenzen im Bereich der internationalen Wasserpolitik
- Die Rolle von Akteuren wie der EU und der WTO im Prozess der Liberalisierung und Privatisierung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Kapitel "Einleitung" beleuchtet die Bedeutung von sauberem Trinkwasser als lebensnotwendiges Gut und die Herausforderungen der Wasserversorgung in der Welt. Es setzt den Kontext für die Diskussion um Liberalisierung und Privatisierung im Wassersektor.
- Die Kapitel "Privatisierung in England/Wales", "Das französische Konzessionsmodell" und "Entwicklungen in Deutschland" präsentieren Beispiele für verschiedene Modelle der Privatisierung im Wassersektor. Sie stellen die unterschiedlichen Ansätze und Erfahrungen verschiedener Länder dar.
- Das Kapitel "Die rechtliche Ausgangslage" diskutiert die rechtlichen Rahmenbedingungen der Liberalisierung und Privatisierung im Wassersektor in Deutschland. Es beleuchtet die unterschiedlichen Rechtsgrundlagen und die Bedeutung von gemeinwohlorientierten Dienstleistungen.
- Das Kapitel "Kritikpunkte an einer Liberalisierung und Privatisierung" analysiert die Argumente gegen eine Liberalisierung und Privatisierung der Wasserversorgung. Es beleuchtet die potenziellen Risiken für die Qualität und Verfügbarkeit von Trinkwasser sowie die Auswirkungen auf die Umwelt.
- Das Kapitel "Trinkwasser – ein besonderes Gut" erläutert die Besonderheiten von Wasser als Lebensgrundlage und die Notwendigkeit einer nachhaltigen Bewirtschaftung. Es diskutiert die Rolle der öffentlichen Hand in der Wasserversorgung.
- Das Kapitel "Liberalisierung und Privatisierung im Wassersektor ausgewählter Länder" beschäftigt sich mit verschiedenen Modellen der Liberalisierung und Privatisierung in verschiedenen Ländern. Es untersucht die Erfahrungen und die Auswirkungen dieser Prozesse.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Buches umfassen Liberalisierung, Privatisierung, Trinkwasserversorgung, Wasserwirtschaft, Nachhaltigkeit, öffentliche Daseinsvorsorge, Gesundheitsrisiken, Umweltrisiken, EU-Recht, WTO-Recht, GATS-Verhandlungen.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird über die Privatisierung der Wasserversorgung diskutiert?
Gründe sind der weltweit steigende Wasserverbrauch, ineffiziente Bewirtschaftung in einigen Regionen und das Interesse privater Konzerne an einem Markt mit Milliardenumsätzen.
Welche Rolle spielen die WTO und das GATS-Abkommen?
Im Rahmen der GATS-Verhandlungen wird auf einen freien Marktzugang für Dienstleistungen gedrängt, was auch die öffentliche Daseinsvorsorge wie die Trinkwasserversorgung betreffen kann.
Was sind die Gefahren einer Wasserprivatisierung?
Kritiker warnen vor steigenden Preisen, Vernachlässigung der Infrastruktur, Qualitätsverlusten und der Gefährdung des Menschenrechts auf sauberes Wasser.
Wie unterscheidet sich das deutsche Modell von dem in England?
In Deutschland ist die Wasserversorgung meist kommunal organisiert (Daseinsvorsorge), während in England und Wales eine vollständige Privatisierung der Betriebe und Netze durchgeführt wurde.
Was ist das französische Konzessionsmodell?
Beim Konzessionsmodell bleibt das Eigentum an den Anlagen oft bei der Kommune, aber der Betrieb wird für einen festgelegten Zeitraum an private Unternehmen übertragen.
- Arbeit zitieren
- Dr. Gerald G. Sander (Autor:in), 2005, Liberalisierungs- und Privatisierungsvorhaben in der Trinkwasserversorgung in Deutschland, der EU und WTO, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/40221